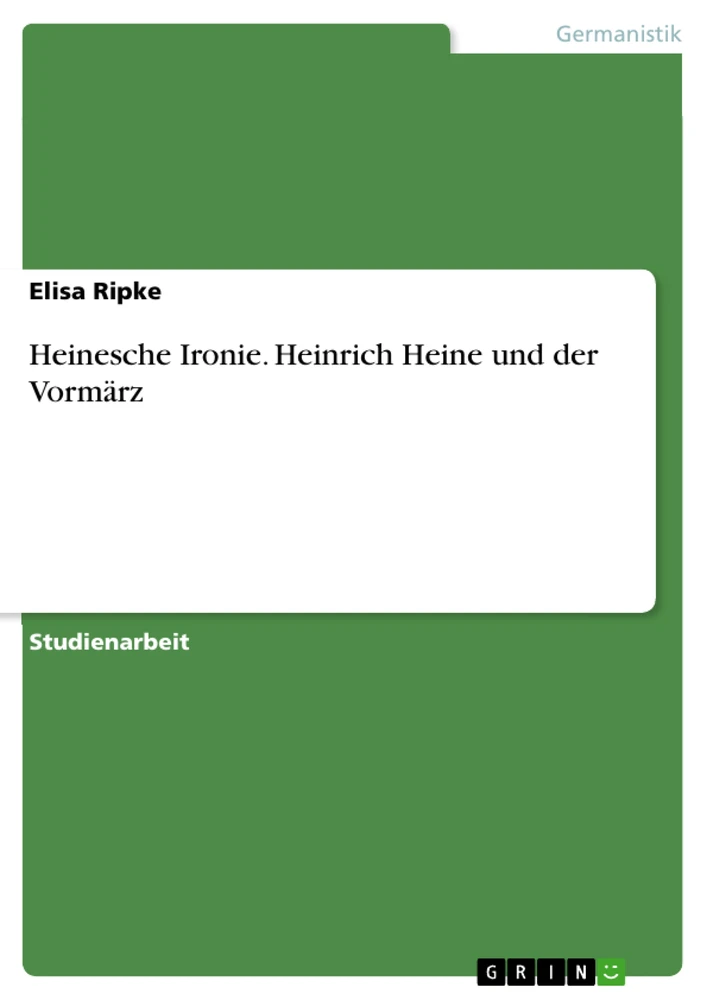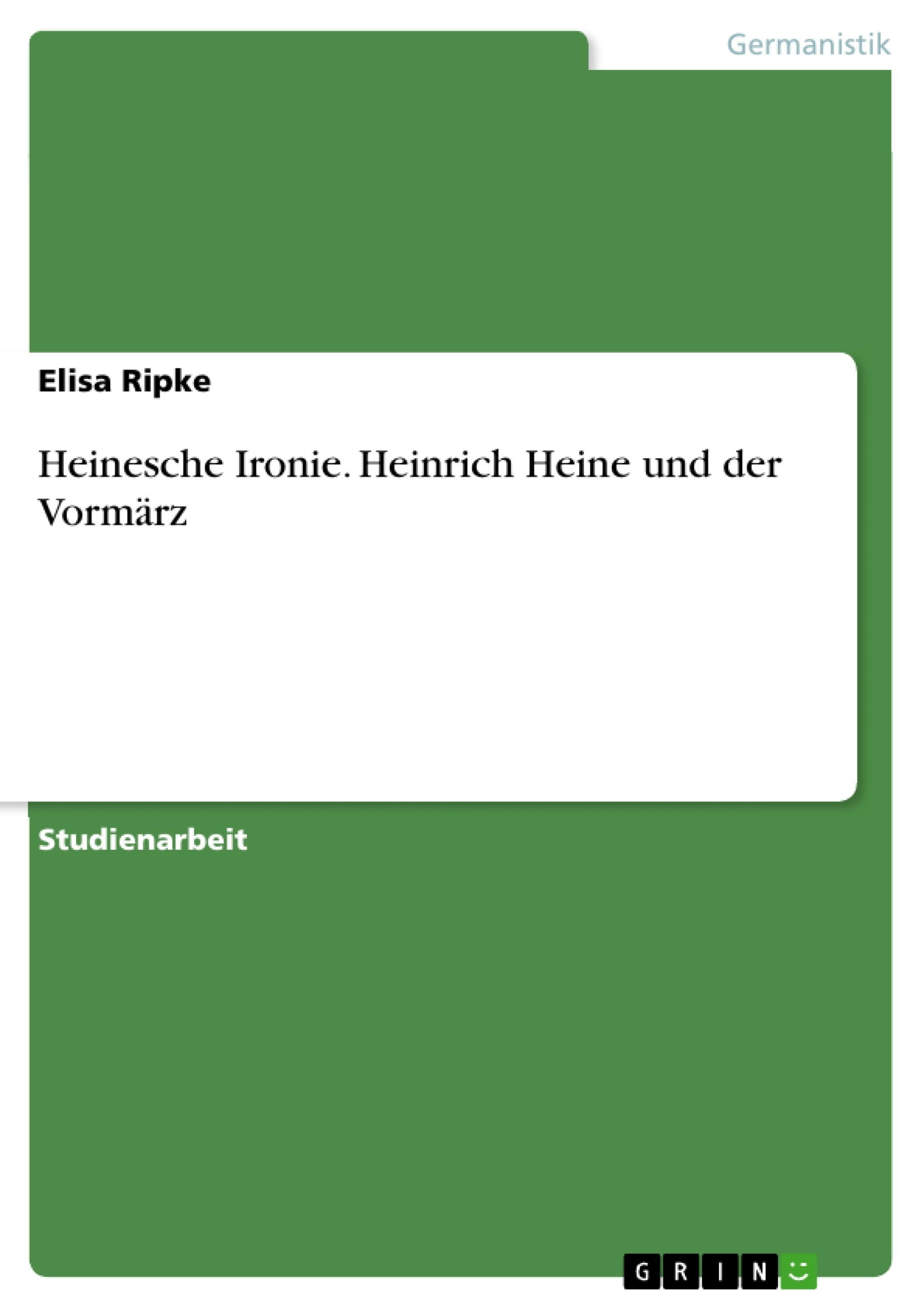Mit dem Wiener Kongress 1814 und der Gründung des Deutschen Bundes 1815 begann die Epoche, die nachträglich Vormärz genannt wurde. Vormärz deshalb, weil die gescheiterte Märzrevolution 1848 das Ende der Epoche markierte. Die politische Situation dieser Zeit hat einen großen Einfluss auf die Literatur. Es kommt zu einer Politisierungswelle, die gegenwärtige Zustände anklagt, kritisiert und verarbeitet. Neben sozialen Themen, wie der Ständegesellschaft und der Armut nach einem raschen Bevölkerungswachstums nach Kriegsende, spielt auch die Frage nach der Nation eine große Rolle. Die Vertreter der Epoche fordern ein geeinigtes Deutschland. Zu den Vertretern zählen überwiegend junge Akademiker, die mit ihren revolutionären Gedanken die Wut der konservativen Machthabern auf sich ziehen. Dies äußert sich 1819 durch die Karlsbader Beschlüsse, welche unter anderem die Vorzensur beinhalteten. Heinrich Heine zählt sowohl zu den Vertretern, als auch den Kritikern der Politisierung jener Epoche. Die politische Dichtung, die negativ auch Tendenzliteratur genannt wird, ist ihm zuwider, da sie, wie der Name schon verdeutlicht durch ihre Parteilichkeit geleitet, zwanghaft als Literatur Einfluss nehmen will. Dies äußert sich auch in seinen Werken, in denen er die Erscheinungen seiner Zeit teilweise auch ironisch verarbeitet. Nicht selten nimmt er dabei Bezug auf seine Zeitgenossen. Dabei spielen sowohl die anderen Vormärzvertreter, als auch Literaten aus dem Biedermeier, welches den Gegensatz zum Vormärz darstellt, eine Rolle. Die unsichere Situation führte die Autoren des Biedermeier weg von der Politik und zurück ins Private.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Heine und der Vormärz - Eine Einordnung
- 1.1.1 Heine und die Romantik
- 1.2 Fragestellung
- 1.3 Ironie
- 1.3.1 Definition
- 1.3.2 Ironie bei Heine
- 1.3.3 Abgrenzung zu anderen Stilmittel – Komik, Satire, Parodie?
- 2. Ironie innerhalb der Zeitgedichte
- 2.1 Die Tendenz (1844)
- 3. Ironisches Zerrbild der Romantik
- 3.1 Mein Herz, mein Herz ist traurig (1827)
- 4. Abschluss und Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von Ironie in den Werken Heinrich Heines im Kontext des Vormärz. Sie beleuchtet die Funktionen und Intentionen der Heineschen Ironie und analysiert deren Manifestation in ausgewählten lyrischen Texten. Die Arbeit befasst sich mit der Abgrenzung der Heineschen Ironie von anderen Stilmitteln und ihrem Verhältnis zur romantischen Ironie.
- Heines Verhältnis zum Vormärz und zur Romantik
- Definition und Funktionen der Ironie
- Analyse der Heineschen Ironie als Stilmittel
- Vergleich mit anderen Stilmitteln wie Komik, Satire und Parodie
- Untersuchung der Ironie in ausgewählten Gedichten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einführende Kapitel bietet zunächst eine Einordnung Heines in den Kontext des Vormärz, einer Epoche geprägt von politischer und sozialer Umwälzung. Es beschreibt Heines ambivalentes Verhältnis zur Politisierung dieser Zeit und seiner Ablehnung der Tendenzliteratur. Weiterhin wird Heines Beziehung zur Romantik beleuchtet, seine Selbstbeschreibung als „entlaufener Romantiker“ und die Verwendung romantischer Stilmittel mit ironischem Unterton werden thematisiert. Die Fragestellung der Arbeit wird formuliert, welche die Analyse der Heineschen Ironie in ausgewählten lyrischen Texten zum Ziel hat. Schließlich erfolgt eine umfassende Definition des Begriffs „Ironie“ aus linguistischer und rhetorischer Perspektive, mit Bezug auf verschiedene Ironie-Typen und -Kategorien.
2. Ironie innerhalb der Zeitgedichte: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der Ironie in Heines Zeitgedichten, insbesondere anhand des Beispiels „Die Tendenz“ (1844). Die Analyse wird sich mit den konkreten Manifestationen der Ironie in dem Gedicht auseinandersetzen, deren Funktion im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des Vormärz erläutern und die Intentionen Heines hinter der Verwendung der Ironie herausarbeiten.
3. Ironisches Zerrbild der Romantik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung der Romantik in Heines Werk unter dem Aspekt der Ironie. Es analysiert, wie Heine die Romantik ironisch verfremdet und kritisiert, und welche Funktionen diese ironische Darstellung im Kontext seines Gesamtwerks einnimmt. Das Gedicht "Mein Herz, mein Herz ist traurig" (1827) wird als Beispiel für die ironische Auseinandersetzung mit romantischen Motiven und Topoi herangezogen und detailliert untersucht. Die Analyse wird die literarischen Mittel der Ironie beleuchten und deren Wirkung auf den Leser untersuchen.
Schlüsselwörter
Heinrich Heine, Vormärz, Ironie, Romantische Ironie, Tendenzliteratur, Zeitgedichte, Lyrik, Stilmittel, Politische Dichtung, Romantik, Kritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Ironie in Heines Werk
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Verwendung von Ironie in den Werken Heinrich Heines, insbesondere im Kontext des Vormärz. Der Fokus liegt auf der Funktion und Intention der Heineschen Ironie in ausgewählten Gedichten und deren Abgrenzung zu anderen Stilmitteln wie Komik, Satire und Parodie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Heines Verhältnis zum Vormärz und zur Romantik, definiert und beschreibt die Funktionen der Ironie, analysiert die Heinesche Ironie als Stilmittel, vergleicht sie mit anderen Stilmitteln und untersucht die Ironie in ausgewählten Gedichten, darunter "Die Tendenz" (1844) und "Mein Herz, mein Herz ist traurig" (1827).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung mit Einordnung Heines in den Vormärz, Definition der Ironie und Formulierung der Forschungsfrage; ein Kapitel zur Analyse der Ironie in Heines Zeitgedichten (am Beispiel "Die Tendenz"); ein Kapitel zum ironischen Zerrbild der Romantik bei Heine (am Beispiel "Mein Herz, mein Herz ist traurig"); und abschließend ein Kapitel mit Zusammenfassung und Reflexion.
Wie wird die Ironie bei Heine definiert und analysiert?
Die Arbeit bietet zunächst eine umfassende Definition von Ironie aus linguistischer und rhetorischer Sicht. Die Analyse der Heineschen Ironie erfolgt dann anhand konkreter Beispiele aus seinen Gedichten, wobei die Funktion und Intention der Ironie im jeweiligen Kontext beleuchtet wird. Der Vergleich mit anderen Stilmitteln hilft, die Besonderheiten der Heineschen Ironie herauszuarbeiten.
Welche Rolle spielt die Romantik in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht Heines ambivalentes Verhältnis zur Romantik, seine Selbstbeschreibung als „entlaufener Romantiker“ und die Verwendung romantischer Stilmittel mit ironischem Unterton. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem ironischen Zerrbild der Romantik in Heines Werk.
Welche Gedichte werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert zwei Gedichte: "Die Tendenz" (1844) als Beispiel für die Ironie in Heines Zeitgedichten und "Mein Herz, mein Herz ist traurig" (1827) als Beispiel für die ironische Auseinandersetzung mit romantischen Motiven.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heinrich Heine, Vormärz, Ironie, Romantische Ironie, Tendenzliteratur, Zeitgedichte, Lyrik, Stilmittel, Politische Dichtung, Romantik, Kritik.
- Quote paper
- Elisa Ripke (Author), 2018, Heinesche Ironie. Heinrich Heine und der Vormärz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452591