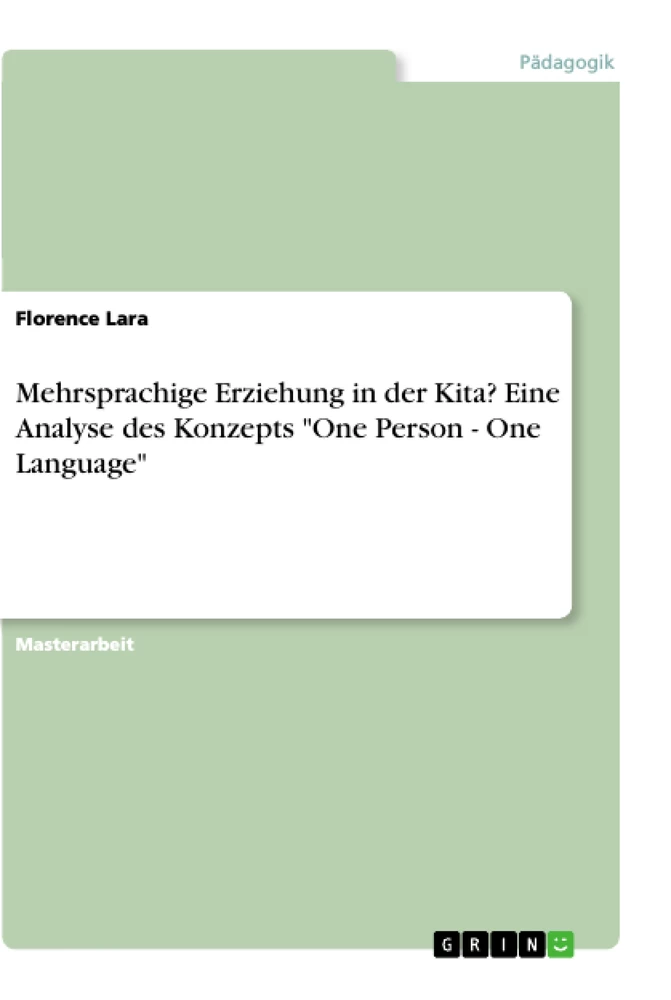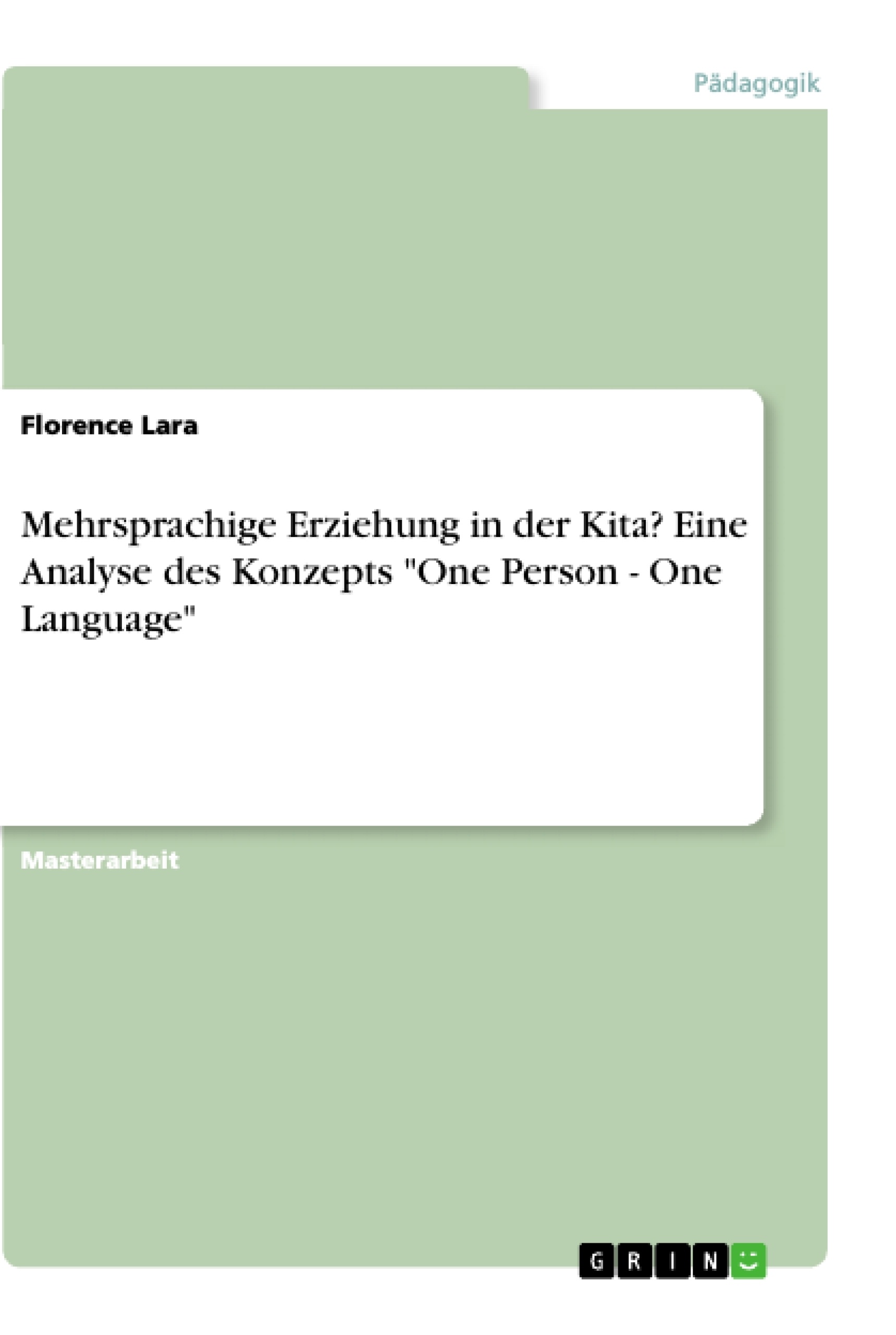Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde das Konzept „One Person – One Language“ untersucht. Dabei geht es um das Potenzial von mehrsprachigem pädagogischen Fachpersonal, welches in Kitas tätig werden könnte, um bei Kindern mit Migrationshintergrund die Erst- sowie Zweitsprache gleichermaßen zu fördern.
Hierbei müssen spezielle Rahmenbedingungen geschaffen werden, wie z.B. eine Schulung der Fachkräfte bezüglich interkultureller Arbeit, Spracherwerb und Mehrsprachigkeit. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, für die in der Konzeption verankerte Sprachförderung entsprechende Sprachförderkräfte sowie mehrsprachige pädagogische Fachkräfte einzusetzen. Dieses Konzept sollte als Bildungsaufgabe einen Platz im Bildungsplan finden. Hauptsächlich geht es bei diesem Konzept darum, die Erst- sowie die Zweitsprache gleichermaßen zu fördern. Das bedeutet, dass die Kinder auch in der Kita ihre Muttersprache sprechen dürfen und sollen. Denn nur so kann ein erfolgreicher Erwerb beider Sprachen ohne Sprachentwicklungsstörung und eine gesunde und stabile Persönlichkeitsentwicklung gewährleistet werden.
Hierbei gilt es zu betonten, dass eine gleichwertige Entwicklung der Sprachen nur in einem Umfeld möglich ist, in welchem die Sprachen auch tatsächlich als gleichwertig angesehen werden. Und hierfür ist wiederum die Grundeinstellung hinsichtlich fremder Sprachen und Kulturen von pädagogischem Fachpersonal in institutionellen vorschulischen Bildungseinrichtungen entscheidend. Denn diese hat maßgeblichen Einfluss auf die gesamte pädagogische Arbeit mit Kindern und auf die Kinder selbst. Aus diesem Grund muss der erste entscheidende Schritt bei pädagogischem Personal in Kitas selbst ansetzen. Und hierfür sind gezielte Leitlinien und Konzepte erforderlich, welche in der Bildungspolitik bestimmt werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Spracherwerb und Mehrsprachigkeit
- 2.1 Phasen der monolingualen kindlichen Sprachentwicklung
- 2.2 Bedeutung von Mehrsprachigkeit
- 2.3 Typen und Formen der Mehrsprachigkeit
- 2.3.1 Zweitspracherwerb
- 2.3.2 Doppelspracherwerb oder Bilingualismus
- 2.3.3 Sprachtrennungsregeln
- 2.3.4 Bedeutung der Erstsprache
- 3 Bedeutung und Funktion von Sprache für Kinder
- 3.1 Sprache und Identität
- 3.2 Kultur, Sprache und Identität
- 3.2.1 Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund
- 4 Mehrsprachigkeit in institutionellen Bildungseinrichtungen
- 4.1 Statistiken
- 4.2 Mehrsprachigkeit aus Sicht des pädagogischen Fachpersonals in Kitas und der Kinder
- 4.3 Sprachförderkonzepte und -maßnahmen in der Kita
- 4.4 Frühe Kindheitliche Bildung, Erziehung und Betreuung: Der pädagogische Auftrag der Kita
- 4.5 Bikulturelle Bildung als Konzept
- 5 Das Konzept „One Person – One Language“ in der Kita: Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung
- 5.1 Beschreibung des Konzepts
- 5.2 Einsatz von ausländischen Fachkräften
- 5.3 Interkulturelle Erziehung: Voraussetzungen, Ziele und Grenzen
- 5.3.1 Elternarbeit
- 5.4 Qualitative Interviews mit Kita-Personal
- 5.4.1 Qualitative Befragung - Das Leitfadeninterview
- 5.4.2 Auswertungsmethode
- 5.4.3 Ergebnisse
- 6 Ausblick
- 7 Literaturverzeichnis
- 8 Abbildungsverzeichnis
- 9 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit in Kindertagesstätten (Kitas) in Deutschland, insbesondere im Kontext von Kindern mit Migrationshintergrund. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Mehrsprachigkeit für die kindliche Entwicklung und Integration, beleuchtet verschiedene Sprachförderkonzepte und bewertet die Anwendbarkeit des "One Person – One Language"-Konzepts.
- Bedeutung der Mehrsprachigkeit für die kindliche Entwicklung
- Sprachförderung in Kitas für Kinder mit Migrationshintergrund
- Herausforderungen und Chancen des "One Person – One Language"-Konzepts
- Rollen und Perspektiven des pädagogischen Personals
- Interkulturelle Erziehung und Elternarbeit in Kitas
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland und deren oft geringeren Bildungserfolg. Sie stellt die Problematik des unzureichenden Deutschspracherwerbs heraus und hebt die Bedeutung der Mehrsprachigkeit im Kontext von Kitas hervor. Die Arbeit fokussiert sich auf Kinder, deren Eltern über geringe Deutschkenntnisse verfügen und deren Kinder erst in der Kita Deutsch lernen.
2 Spracherwerb und Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel beleuchtet den Spracherwerbsprozess, insbesondere im Kontext der Mehrsprachigkeit. Es beschreibt verschiedene Phasen der monolingualen Sprachentwicklung, definiert Mehrsprachigkeit und deren verschiedene Typen und Formen (z.B. Bilingualismus, Zweitspracherwerb), und diskutiert die Bedeutung der Erstsprache für die kindliche Entwicklung.
3 Bedeutung und Funktion von Sprache für Kinder: Dieses Kapitel untersucht die enge Verknüpfung von Sprache, Identität und Kultur. Es analysiert den Einfluss der sprachlichen und kulturellen Herkunft auf den Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund, wobei der Fokus auf den Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit liegt.
4 Mehrsprachigkeit in institutionellen Bildungseinrichtungen: Dieses Kapitel präsentiert Statistiken zur Mehrsprachigkeit in Kitas, untersucht die Perspektiven von pädagogischem Personal und Kindern dazu, und analysiert verschiedene Sprachförderkonzepte und Maßnahmen. Es beleuchtet den pädagogischen Auftrag der Kita im Kontext der Mehrsprachigkeit und beschreibt bikulturelle Bildungskonzepte.
5 Das Konzept „One Person – One Language“ in der Kita: Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung: Dieses Kapitel beschreibt das "One Person – One Language"-Konzept, untersucht den Einsatz von ausländischen Fachkräften und analysiert die Voraussetzungen, Ziele und Grenzen interkultureller Erziehung, inklusive der Zusammenarbeit mit Eltern. Qualitative Interviews mit Kita-Personal liefern Einblicke in die Praxis.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Spracherwerb, Kinder mit Migrationshintergrund, Kita, Sprachförderung, Interkulturelle Erziehung, Bilingualismus, "One Person – One Language", Bildungserfolg, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Mehrsprachigkeit in der Kita
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit in deutschen Kindertagesstätten (Kitas), insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Mehrsprachigkeit für die kindliche Entwicklung und Integration, der Analyse verschiedener Sprachförderkonzepte und der Bewertung des "One Person – One Language"-Konzepts.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Bedeutung der Mehrsprachigkeit für die kindliche Entwicklung, Sprachförderung in Kitas für Kinder mit Migrationshintergrund, Herausforderungen und Chancen des "One Person – One Language"-Konzepts, Rollen und Perspektiven des pädagogischen Personals, sowie interkulturelle Erziehung und Elternarbeit in Kitas.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Spracherwerb und Mehrsprachigkeit, Bedeutung und Funktion von Sprache für Kinder, Mehrsprachigkeit in institutionellen Bildungseinrichtungen, Das Konzept „One Person – One Language“ in der Kita: Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung, Ausblick, Literaturverzeichnis, Abbildungsverzeichnis und Anhang. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Mehrsprachigkeit in der Kita.
Was wird im Kapitel "Spracherwerb und Mehrsprachigkeit" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den Spracherwerbsprozess, insbesondere im Kontext der Mehrsprachigkeit. Es beschreibt verschiedene Phasen der monolingualen Sprachentwicklung, definiert Mehrsprachigkeit und deren verschiedene Typen und Formen (z.B. Bilingualismus, Zweitspracherwerb), und diskutiert die Bedeutung der Erstsprache für die kindliche Entwicklung.
Was wird im Kapitel zum "One Person – One Language"-Konzept behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt das "One Person – One Language"-Konzept, untersucht den Einsatz von ausländischen Fachkräften und analysiert die Voraussetzungen, Ziele und Grenzen interkultureller Erziehung, inklusive der Zusammenarbeit mit Eltern. Qualitative Interviews mit Kita-Personal liefern Einblicke in die Praxis und deren Umsetzung.
Welche Methoden wurden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet qualitative Interviews mit Kita-Personal als Forschungsmethode. Die Auswertungsmethode wird im Kapitel 5.4.2 beschrieben.
Welche Zielgruppe spricht die Arbeit an?
Die Arbeit richtet sich an Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung, Wissenschaftler*innen, die sich mit Mehrsprachigkeit und interkultureller Bildung befassen, sowie an alle, die sich für die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit in Kitas interessieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mehrsprachigkeit, Spracherwerb, Kinder mit Migrationshintergrund, Kita, Sprachförderung, Interkulturelle Erziehung, Bilingualismus, "One Person – One Language", Bildungserfolg, Integration.
Wo finde ich die vollständigen Ergebnisse der Studie?
Die vollständigen Ergebnisse der Studie sind in der vollständigen Masterarbeit enthalten, die im Anhang die vollständigen Transkripte der Interviews enthält.
- Citar trabajo
- Florence Lara (Autor), 2017, Mehrsprachige Erziehung in der Kita? Eine Analyse des Konzepts "One Person - One Language", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452502