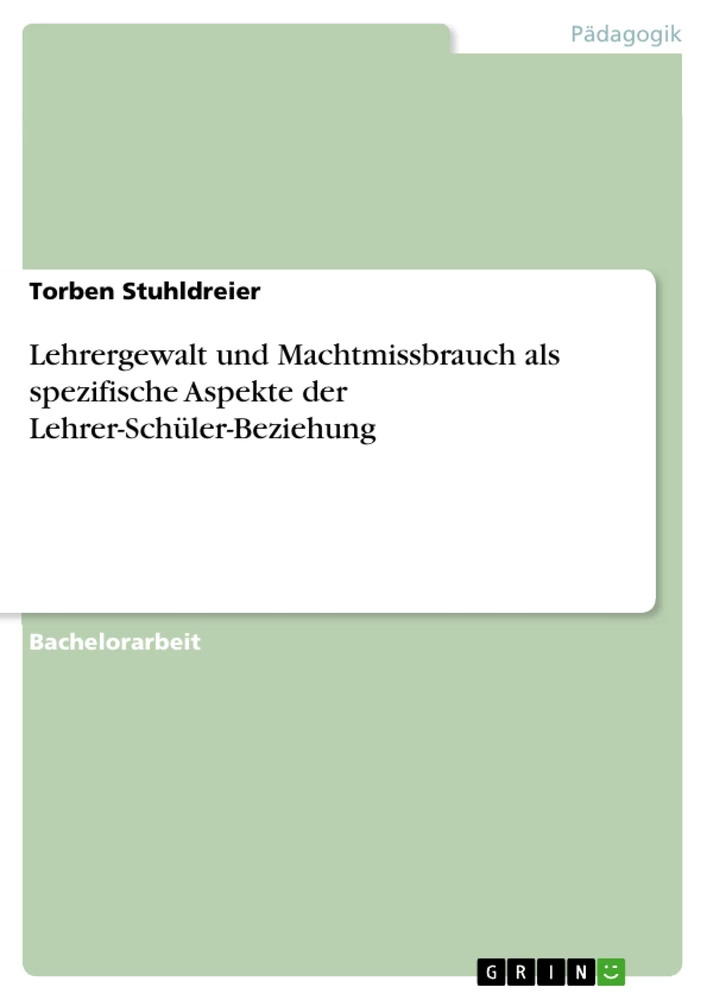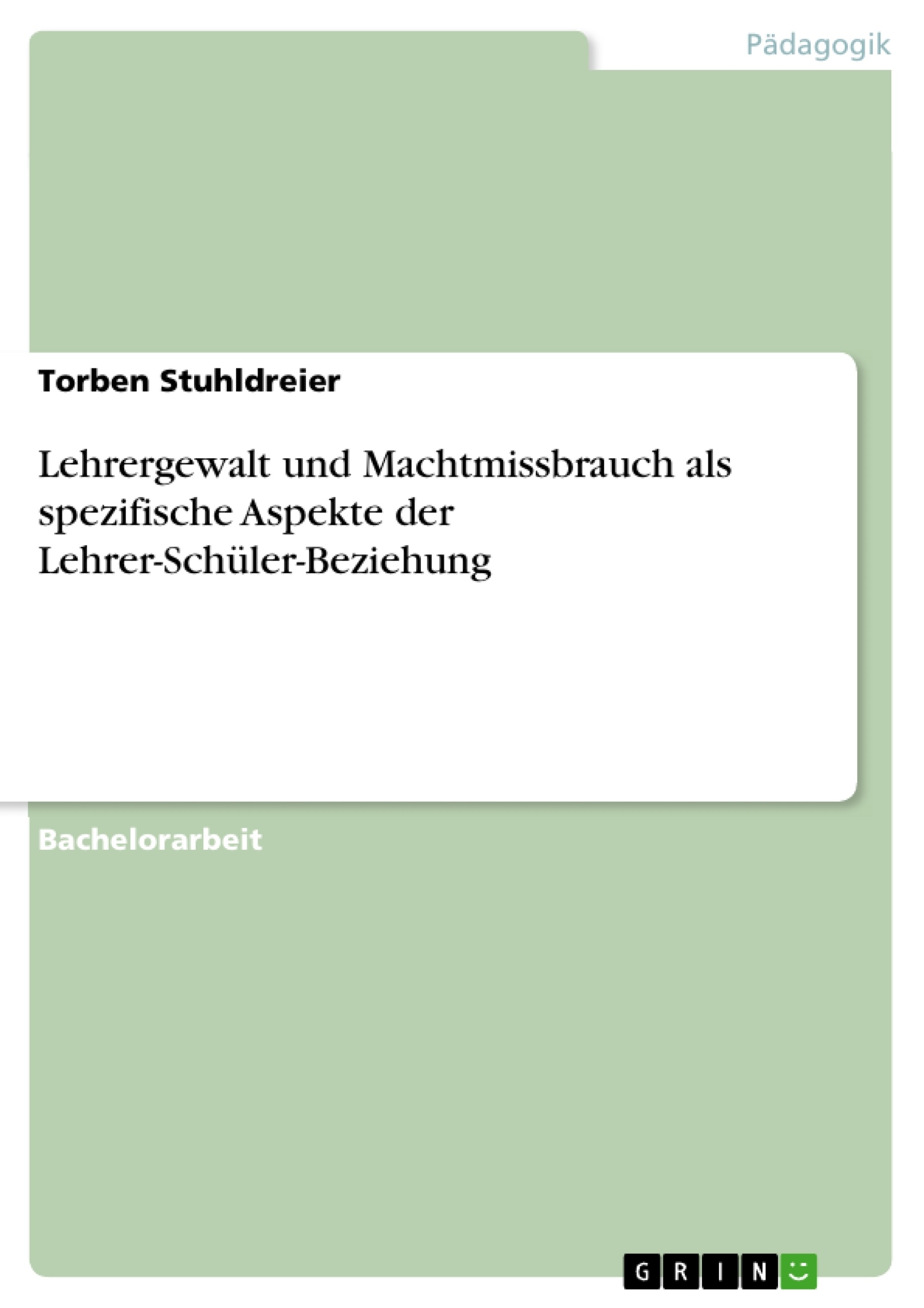Diese Bachelor-Arbeit setzt sich mit dem Thema „Lehrergewalt und Machtmissbrauch als spezifische Aspekte der Lehrer-Schüler-Beziehung“ auseinander. Einige spektakuläre Einzelfälle haben in den 1990er Jahren in Deutschland eine intensive mediale Debatte und in der Folge eine rege empirische Forschung zur tatsächlichen Verbreitung von Gewalt in Schulen ausgelöst. Die Studien der letzten zwei Jahrzehnte beziehen sich dabei fast ausschließlich auf die Gewalt von Schülern.
In dieser Bachelor-Arbeit wird darauf hingewiesen, dass Lehrergewalt beziehungsweise der Machtmissbrauch von Lehrern gegenüber ihren Schülern in der öffentlichen und medialen Debatte und in der wissenschaftlichen Forschung über „Gewalt in der Schule“ bislang kaum berücksichtigt wurde und wird. Der Fokus der Öffentlichkeit und der wissenschaftlichen Forschung liegt fast ausschließlich auf der Gewalt von Schülern gegen Mitschüler, Lehrer und Sachen.
Um erfolgreich im Umgang mit Gewalt zwischen Lehrkräften und Schülern zu sein ist es wichtig, der beschriebenen Tabuisierung von Lehrergewalt entgegenzuwirken; es ist erforderlich anzuerkennen, dass Machtmissbrauch von Lehrern existiert. Es ist mehrfach konstatiert worden, dass die Tabuisierung der Lehrergewalt in Forschung und Öffentlichkeit nicht zu legitimieren ist. Dies impliziert eine Forderung nach größerer Beachtung der hier behandelten Perspektive. Selbstverständlich darf dabei das gewalttätige Verhalten der Schüler nicht aus dem Blickfeld geraten. Schüler- und Lehrergewalt sollten gleichrangig und differenziert untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffe und Definitionen – Gewalt, Macht und Machtmissbrauch
- 3. Die Lehrer-Schüler-Beziehung
- 3.1 Grundlegende Charakteristika der Lehrer-Schüler-Beziehung
- 3.2 Wandel der wissenschaftlichen Betrachtungsweise
- 3.3 Das transaktionale Modell der Schüler-Lehrer-Beziehung (nach Nickel 1976)
- 3.4 Erwartungen als Stör- und Fehlerquellen für die Wahrnehmung und die Handlungsentscheidung
- 4. Gewalt und Machtmissbrauch von Lehrern gegenüber Schülern
- 4.1 TIMMS-Studie in Österreich (vgl. Krumm/Lamberger-Baumann/Haider 1997)
- 4.2 Studentenbefragung (vgl. Krumm/Weiß 2000a; Krumm 1999b)
- 4.3 Bremer Schülerbefragung (vgl. Leithäuser/Meng 2003)
- 4.4 Qualitative Arbeit zum Mobbing von Lehrern gegenüber Schülern (vgl. Hoos 1999)
- 5. Erklärungsansätze für Lehrergewalt bzw. Machtmissbrauch von Lehrern gegenüber Schülern
- 5.1 Struktureller und situativer Erklärungsansatz
- 5.2 Personenbezogenen Erklärungsansätze
- 6. Breitflächiges Supervisionsprogramm als Maßnahme gegen Machtmissbrauch von Lehrern?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Thema Lehrergewalt und Machtmissbrauch im Kontext der Lehrer-Schüler-Beziehung. Ziel ist es, die einseitige Forschungslage zu diesem Thema aufzuzeigen und verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Die Arbeit analysiert das Ausmaß und die Erscheinungsformen von Lehrergewalt, untersucht mögliche Erklärungsansätze und diskutiert präventive Maßnahmen.
- Einseitige wissenschaftliche Betrachtung von Gewalt in der Schule
- Ausmaß und Formen von Lehrergewalt und Machtmissbrauch
- Erklärungsansätze für Lehrergewalt
- Präventive Maßnahmen gegen Machtmissbrauch
- Das transaktionale Modell der Lehrer-Schüler-Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Lehrergewalt und Machtmissbrauch ein und beleuchtet die einseitige Fokussierung der bisherigen Forschung auf Schülergewalt. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, die Perspektive der Lehrergewalt stärker zu berücksichtigen und begründet die Relevanz des Themas anhand von Studien und Medienberichten, die die weit verbreitete Unterrepräsentation dieses Problems aufzeigen. Der Mangel an Forschung und der Widerstand in Medien und Wissenschaft werden deutlich herausgestellt.
2. Begriffe und Definitionen – Gewalt, Macht und Machtmissbrauch: Dieses Kapitel (nicht im vorliegenden Text enthalten) würde voraussichtlich eine klare Definition von Gewalt, Macht und Machtmissbrauch im Kontext der Lehrer-Schüler-Beziehung liefern. Es würde verschiedene Formen von Gewalt und Machtmissbrauch differenzieren und ein theoretisches Fundament für die weitere Analyse legen. Die Definitionen wären essenziell für die objektive Beurteilung der in den folgenden Kapiteln dargestellten Fallbeispiele und Studien.
3. Die Lehrer-Schüler-Beziehung: Dieses Kapitel analysiert die Lehrer-Schüler-Beziehung, ihre grundlegenden Charakteristika und ihren Wandel in der wissenschaftlichen Betrachtung. Es wird auf das transaktionale Modell von Nickel (1976) eingegangen, welches die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler als wechselseitigen Prozess darstellt. Weiterhin werden Störfaktoren und Fehlerquellen in der Wahrnehmung und Handlungsentscheidung von Lehrern im Kontext der Beziehung beleuchtet, um ein umfassendes Bild der komplexen Dynamiken zu liefern.
4. Gewalt und Machtmissbrauch von Lehrern gegenüber Schülern: Dieses Kapitel präsentiert eine Auswahl an quantitativen und qualitativen Studien zum Thema Lehrergewalt. Die TIMMS-Studie in Österreich, Studentenbefragungen und die Bremer Schülerbefragung bieten Daten zum Ausmaß der Gewalt. Qualitative Arbeiten, wie die von Hoos (1999), geben Einblick in die konkreten Erfahrungen und die Auswirkungen von Mobbing durch Lehrer. Die Zusammenstellung verschiedener Forschungsansätze ermöglicht eine vielschichtige Darstellung des Problems.
5. Erklärungsansätze für Lehrergewalt bzw. Machtmissbrauch von Lehrern gegenüber Schülern: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze für Lehrergewalt und Machtmissbrauch. Es unterscheidet zwischen strukturellen und situativen Faktoren sowie personenbezogenen Ursachen. Die Analyse dieser Faktoren ist wichtig, um das Problem besser zu verstehen und effektive Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Die Kapitel fasst verschiedene Erklärungsmodelle zusammen und diskutiert deren jeweilige Bedeutung im Kontext des Themas.
6. Breitflächiges Supervisionsprogramm als Maßnahme gegen Machtmissbrauch von Lehrern?: Dieses Kapitel (nicht im vorliegenden Text im Detail enthalten) würde vermutlich ein konkretes Modell zur Prävention von Lehrergewalt und Machtmissbrauch vorstellen und analysieren. Es würde vermutlich die Wirksamkeit und die Grenzen dieses Ansatzes kritisch diskutieren und die Implikationen für die Praxis beleuchten. Es bietet eine mögliche Lösungsstrategie für das behandelte Problem.
Schlüsselwörter
Lehrergewalt, Machtmissbrauch, Lehrer-Schüler-Beziehung, Gewaltforschung, transaktionales Modell, Prävention, Supervision, Schülerbefragung, qualitative Forschung, quantitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Lehrergewalt und Machtmissbrauch
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Thema Lehrergewalt und Machtmissbrauch im Kontext der Lehrer-Schüler-Beziehung. Sie beleuchtet die einseitige Forschungslage, analysiert Ausmaß und Erscheinungsformen von Lehrergewalt, untersucht mögliche Erklärungsansätze und diskutiert präventive Maßnahmen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die einseitige wissenschaftliche Betrachtung von Gewalt in der Schule, das Ausmaß und die Formen von Lehrergewalt und Machtmissbrauch, Erklärungsansätze für Lehrergewalt, präventive Maßnahmen gegen Machtmissbrauch und das transaktionale Modell der Lehrer-Schüler-Beziehung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffe und Definitionen (Gewalt, Macht, Machtmissbrauch), Die Lehrer-Schüler-Beziehung, Gewalt und Machtmissbrauch von Lehrern gegenüber Schülern, Erklärungsansätze für Lehrergewalt, und ein Breitflächiges Supervisionsprogramm als Maßnahme gegen Machtmissbrauch.
Welche Studien werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Studien, darunter die TIMMS-Studie in Österreich (Krumm/Lamberger-Baumann/Haider 1997), Studentenbefragungen (Krumm/Weiß 2000a; Krumm 1999b), die Bremer Schülerbefragung (Leithäuser/Meng 2003) und qualitative Arbeiten zum Mobbing von Lehrern gegenüber Schülern (Hoos 1999).
Welche Erklärungsansätze für Lehrergewalt werden diskutiert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen strukturellen und situativen Erklärungsansätzen sowie personenbezogenen Ursachen für Lehrergewalt und Machtmissbrauch.
Welche präventiven Maßnahmen werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit eines breitflächigen Supervisionsprogramms als Maßnahme gegen Machtmissbrauch von Lehrern. Die Details zu diesem Ansatz sind im vorliegenden Text jedoch nicht im Detail enthalten.
Wie werden Gewalt, Macht und Machtmissbrauch definiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Kapitel (nicht im vorliegenden Text enthalten), welches klare Definitionen von Gewalt, Macht und Machtmissbrauch im Kontext der Lehrer-Schüler-Beziehung liefern soll. Verschiedene Formen von Gewalt und Machtmissbrauch werden differenziert und ein theoretisches Fundament für die weitere Analyse gelegt.
Was ist das transaktionale Modell der Lehrer-Schüler-Beziehung?
Die Arbeit beschreibt das transaktionale Modell von Nickel (1976), welches die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler als wechselseitigen Prozess darstellt. Es wird analysiert, wie Störfaktoren und Fehlerquellen in der Wahrnehmung und Handlungsentscheidung von Lehrern die Beziehung beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lehrergewalt, Machtmissbrauch, Lehrer-Schüler-Beziehung, Gewaltforschung, transaktionales Modell, Prävention, Supervision, Schülerbefragung, qualitative Forschung, quantitative Forschung.
Wie ist die Einleitung aufgebaut?
Die Einleitung führt in das Thema Lehrergewalt und Machtmissbrauch ein und beleuchtet die einseitige Fokussierung der bisherigen Forschung auf Schülergewalt. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, die Perspektive der Lehrergewalt stärker zu berücksichtigen und begründet die Relevanz des Themas anhand von Studien und Medienberichten.
- Quote paper
- Torben Stuhldreier (Author), 2017, Lehrergewalt und Machtmissbrauch als spezifische Aspekte der Lehrer-Schüler-Beziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452118