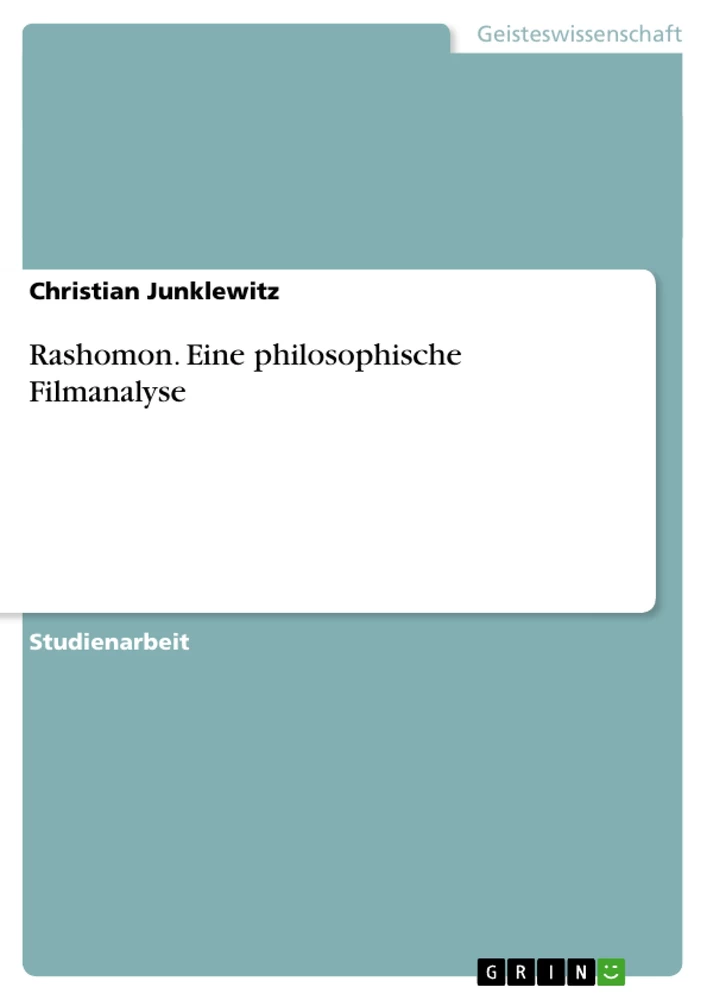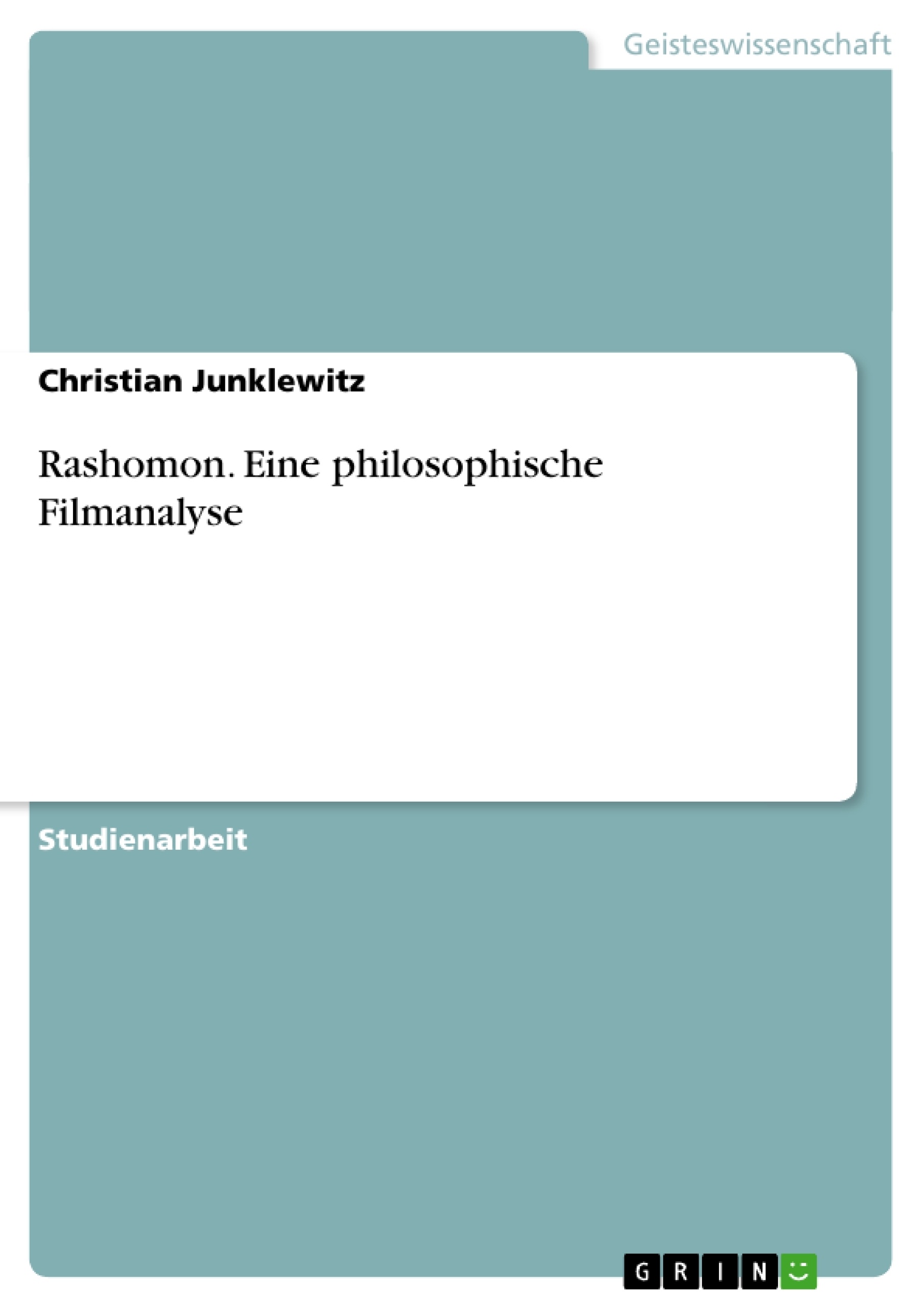Im Rahmen eines Philosophieseminars die Analyse eines Spielfilms vorzunehmen, scheint zunächst ziemlich gewagt: Spielfilme dienen, so das Alltagsverständnis, der Unterhaltung und Entspannung. Der Zuschauer will seinen Spaß haben. Deswegen geht er ins Kino. Da scheint die Philosophie mit ihren intellektuell fordernden, oft nur schwer verständlichen Diskursen und manchmal Jahrhunderte dauernden Disputen reichlich deplaziert. Doch das ist sie nicht.
Spielfilme sind zwar Unterhaltung, aber keine Berieselung. Der Kinobesucher ist zwar Zuschauer, aber dabei keineswegs so passiv, wie manche Theorien ihn erscheinen lassen. Filme fordern, wie andere Kunstwerke, die Wahrnehmung des Betrachters heraus, weil in ihnen (schon durch die filmtypischen Eigenschaften wie Kadrierung und Montage) nichts so erscheint, wie wir es aus dem Alltag kennen. Das Mechanische, Automatische, die Routinen unserer Alltagswahrnehmung werden verfremdet und aufgebrochen. Dabei spielt der Zuschauer eine höchst aktive Rolle: Denn erst in seinen mentalen Prozeßen entsteht diese Verfremdung.“Der Zuschauer sucht im Werk aktiv nach Hinweisen [cues] und reagiert darauf mit den Wahrnehmungsfähigkeiten [viewing skills], die er durch seinen Umgang mit anderen Kunstwerken und mit dem Alltagsleben erworben hat”. Das Anschauen eines Films ist ein Ereignis von größter mentaler Aktivität. Der Zuschauer akzeptiert nicht nur, daß er dieser geistigen Anstrengung unterzogen wird, er verlangt es sogar. Offenbar ist es nämlich genau diese Aktivität, dieses Suchen und Finden von Hinweisen, wie er die Handlungselemente untereinander, aber auch mit seinem Leben, mit seinen innersten Gefühlen und Problemen verbinden kann, das, was ihm beim Filmesehen Vergnügen und Spaß bereitet. Im täglichen Leben - im Beruf, im Straßenverkehr, im Kaufhaus - spielt Philosophie (für die meisten) keine Rolle: Alles wird routiniert, automatisch, pragmatisch erledigt. Im Film ist das anders: Hier erwartet der Zuschauer die Herausforderung, das Besondere, das, was im Alltag nicht vorkommt oder zu kurz kommt. Hier kann in dramatischer Form (ähnlich dem Theater) das ausgetragen werden, was den Menschen in seinem Innersten bewegt und berührt. Dazu gehören insbesondere die menschlichen Grundfragen und -probleme, also genau jener Bereich, mit dem sich die Philosophie beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Am Anfang war...das Leid
- 2. Gegenüberstellung von Optimismus und Pessimismus
- 2.1. Die beste aller möglichen Welten
- 2.2. Die schlechteste aller möglichen Welten
- 2.3. Pessimistische Kritik der optimistischen- Optimistische Kritik der pessimistischen Weltbilder
- 3. Rashomon
- 3.1. Inhalt
- 3.2. "The Great Rashomon Murder Mystery"
- 3.3. Zum Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der philosophischen Analyse des Films "Rashomon" von Akira Kurosawa. Das Ziel ist es, die Thematik des Films im Kontext der Gegenüberstellung von metaphysischem Optimismus und Pessimismus zu betrachten und die Problematik der menschlichen Wahrnehmung im Rahmen des Films zu beleuchten.
- Die Frage nach dem menschlichen Leiden als Ausgangspunkt der Analyse
- Gegenüberstellung von optimistischen und pessimistischen Weltbildern
- Die Bedeutung der menschlichen Wahrnehmung und die Frage nach der Wahrheit
- Die Rolle des Films als Beispiel und Lösungsversuch der Problematik
- Die philosophischen Implikationen des Films "Rashomon"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung der philosophischen Analyse von Spielfilmen. Kapitel 1 thematisiert die Problematik des Leidens in der Welt und die Frage nach dem Umgang damit. Kapitel 2 stellt zwei exponierte Vertreter der optimistischen und pessimistischen Weltbilder, Gottfried Wilhelm Leibniz und Arthur Schopenhauer, einander gegenüber. In Kapitel 3 wird der Film "Rashomon" analysiert und hinsichtlich seiner Thematik und seiner philosophischen Implikationen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: metaphysischer Optimismus, Pessimismus, menschliches Leiden, Wahrnehmung, Wahrheit, Rashomon, Akira Kurosawa, Philosophie, Film, Filmkunst.
- Quote paper
- Christian Junklewitz (Author), 2000, Rashomon. Eine philosophische Filmanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45142