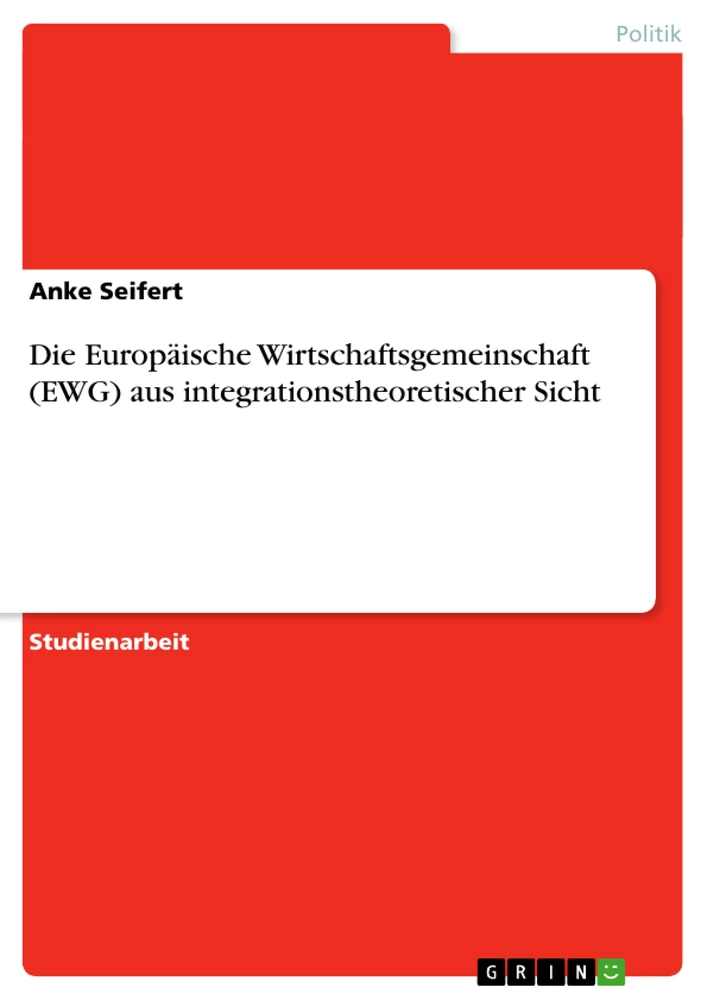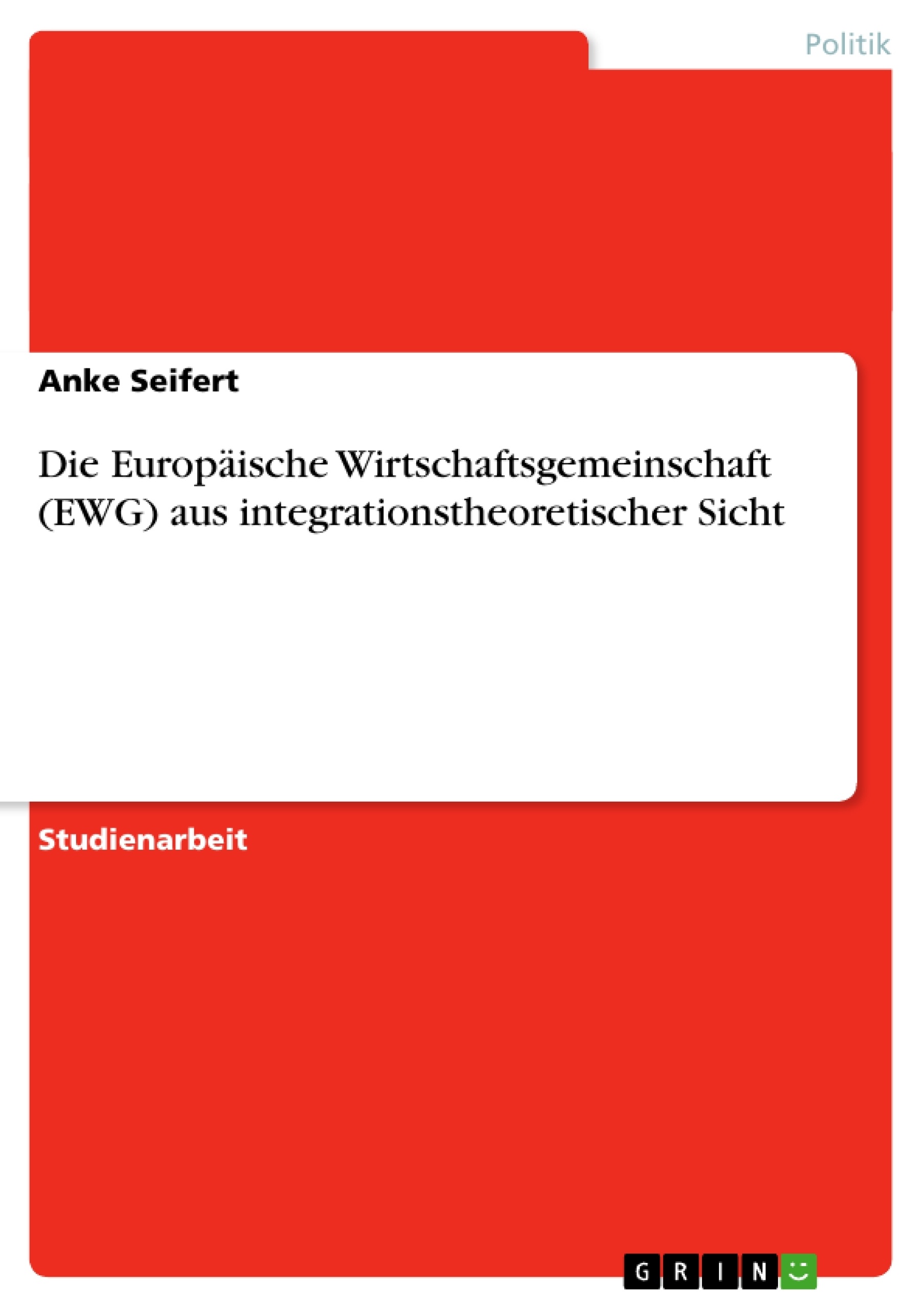Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Integrationstheorien, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden und für sich in Anspruch nehmen, den Integrationsprozess des Europas der 50er Jahre bis hin zur heutigen Europäischen Union erklären zu können. Ob wirklich nur eine Theorie in der Lage ist oder ob mehrere Theorien vonnöten sind, diesen wohl einzigartigen Prozess des Zusammenwachsens zu erklären oder es gar unmöglich ist, dieses europäische Phänomen glaubhaft erfassen zu können, soll in dieser Seminararbeit anhand der Entstehung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) beleuchtet werden. Die EWG wurde ausgewählt, weil die Gründungsverträge (EURATOM, EWG, Römische Verträge, EGKS) bei vielen Autoren als Ursprünge des europäischen Integrationsprozesses gelten, indem sie durch legislative und administrative Befugnisse der Organe eine neue Rechtspersönlichkeit geschaffen haben. Mit der EWG ist ein supranationales System entstanden, auf dessen Institutionen Staaten einen Teil ihrer Souveränität abgaben. Die Autoren der im Literaturverzeichnis aufgelisteten Bücher rekrutieren sich hauptsächlich aus dem historischen und politischen Akademikerkreis. Ihre Sichtweise der Bedeutung der EWG ist jedoch ambivalent...
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Integrationstheorien
- 1. Der Föderalismus
- 2. Der Intergouvernmentalismus
- 3. Der (Neo-)Funktionalismus
- III. Der Aufbau und die Struktur der EWG
- 1. Die Entstehung der EWG (historische Grundlagen)
- 2. Die Organe der EWG
- 3. Die Rechtsprechung in der EWG
- IV. Die Anwendbarkeit der Integrationstheorien auf die EWG
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entstehung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) unter dem Blickwinkel verschiedener Integrationstheorien. Ziel ist es, die Anwendbarkeit dieser Theorien auf den EWG-Integrationsprozess zu analysieren und die Bedeutung der EWG als Ursprung des europäischen Integrationsprozesses zu beleuchten.
- Analyse verschiedener Integrationstheorien (Föderalismus, Intergouvernmentalismus, (Neo-)Funktionalismus)
- Historische Grundlagen und Entstehung der EWG
- Aufbau und Struktur der EWG-Institutionen
- Rechtsprechung innerhalb der EWG
- Anwendbarkeit der Integrationstheorien auf die EWG
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der europäischen Integration und der verschiedenen Integrationstheorien ein. Sie begründet die Wahl der EWG als Untersuchungsgegenstand aufgrund ihrer Bedeutung als Ursprung des europäischen Integrationsprozesses und der ambivalenten Sichtweise der Autoren in der Forschung. Die Arbeit konzentriert sich auf drei zentrale Integrationstheorien und beschreibt den Aufbau und die Struktur der EWG sowie deren historische Grundlagen. Schließlich wird der Versuch unternommen, die vorgestellten Theorien auf die EWG anzuwenden.
II. Die Integrationstheorien: Dieses Kapitel stellt drei zentrale Integrationstheorien vor: den Föderalismus, den Intergouvernmentalismus und den (Neo-)Funktionalismus. Es werden die grundlegenden Prinzipien jeder Theorie erläutert und ihre jeweiligen Antworten auf die fundamentalen Fragen der regionalen Integration (Warum, Wie, Wer, Wohin) dargelegt. Der Vergleich der Theorien hebt deren unterschiedliche Ansätze und Organisationsprinzipien hervor, besonders im Hinblick auf die Rolle nationaler Regierungen und supranationaler Institutionen. Der Föderalismus wird als Vorbild für eine zukünftige „Vereinigte Staaten von Europa“ vorgestellt. Der Intergouvernmentalismus, im Gegensatz zum Föderalismus, betont die Zusammenarbeit nationaler Staaten im Rahmen einer begrenzten Regierungszusammenarbeit.
III. Der Aufbau und die Struktur der EWG: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der EWG, ihre historischen Grundlagen und die treibenden Kräfte hinter ihrer Gründung. Es analysiert die Struktur der neu geschaffenen Organe der EWG im Detail, inklusive ihrer Aufgaben und Kompetenzen. Darüber hinaus wird der Aufbau der Institutionen erörtert und die Bedeutung der Rechtsprechung innerhalb der EWG hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Funktionsweise des supranationalen Systems und der Abgabe eines Teils der nationalen Souveränität durch die Mitgliedsstaaten.
Schlüsselwörter
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), Integrationstheorien, Föderalismus, Intergouvernmentalismus, (Neo-)Funktionalismus, Supranationalität, nationale Souveränität, europäische Integration, Römische Verträge, Institutionen, Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und Integrationstheorien
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Entstehung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und analysiert deren Entwicklung im Kontext verschiedener Integrationstheorien. Der Fokus liegt auf der Anwendbarkeit dieser Theorien auf den EWG-Integrationsprozess und der Bedeutung der EWG als Ursprung der europäischen Integration.
Welche Integrationstheorien werden behandelt?
Die Arbeit analysiert drei zentrale Integrationstheorien: den Föderalismus, den Intergouvernmentalismus und den (Neo-)Funktionalismus. Es werden die Prinzipien jeder Theorie erläutert und ihre jeweiligen Antworten auf grundlegende Fragen der regionalen Integration (Warum, Wie, Wer, Wohin) verglichen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Integrationstheorien, Aufbau und Struktur der EWG, Anwendbarkeit der Integrationstheorien auf die EWG und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der EWG und der Integrationstheorien.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik der europäischen Integration und der verschiedenen Integrationstheorien ein. Sie begründet die Wahl der EWG als Untersuchungsgegenstand und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
Was wird im Kapitel "Integrationstheorien" behandelt?
Dieses Kapitel stellt die drei zentralen Integrationstheorien (Föderalismus, Intergouvernmentalismus, (Neo-)Funktionalismus) vor, erläutert deren Prinzipien und vergleicht ihre unterschiedlichen Ansätze und Organisationsprinzipien im Hinblick auf die Rolle nationaler Regierungen und supranationaler Institutionen.
Was wird im Kapitel "Aufbau und Struktur der EWG" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der EWG, ihre historischen Grundlagen, die Struktur der EWG-Organe (inklusive Aufgaben und Kompetenzen), den Aufbau der Institutionen und die Bedeutung der Rechtsprechung innerhalb der EWG.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das HTML liefert keine explizite Zusammenfassung des Fazits. Das Fazit würde die Ergebnisse der Analyse der Anwendbarkeit der Integrationstheorien auf die EWG zusammenfassen und die Bedeutung der EWG für den europäischen Integrationsprozess bewerten.)
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), Integrationstheorien, Föderalismus, Intergouvernmentalismus, (Neo-)Funktionalismus, Supranationalität, nationale Souveränität, europäische Integration, Römische Verträge, Institutionen, Rechtsprechung.
Welche historischen Grundlagen der EWG werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung der EWG und ihre historischen Grundlagen, einschließlich der treibenden Kräfte hinter ihrer Gründung.
Wie wird die Anwendbarkeit der Integrationstheorien auf die EWG analysiert?
(Die genaue Methodik der Analyse ist im bereitgestellten HTML nicht detailliert beschrieben. Die Arbeit analysiert vermutlich, inwieweit die verschiedenen Theorien die Entwicklung und den Aufbau der EWG erklären können.)
- Quote paper
- Anke Seifert (Author), 2004, Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) aus integrationstheoretischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45116