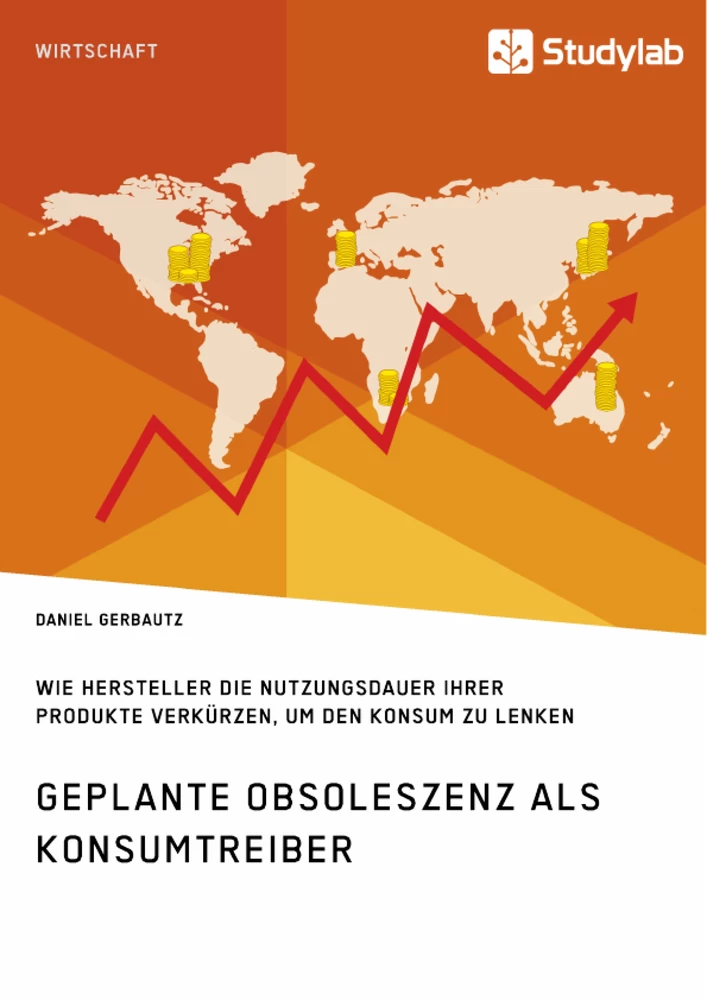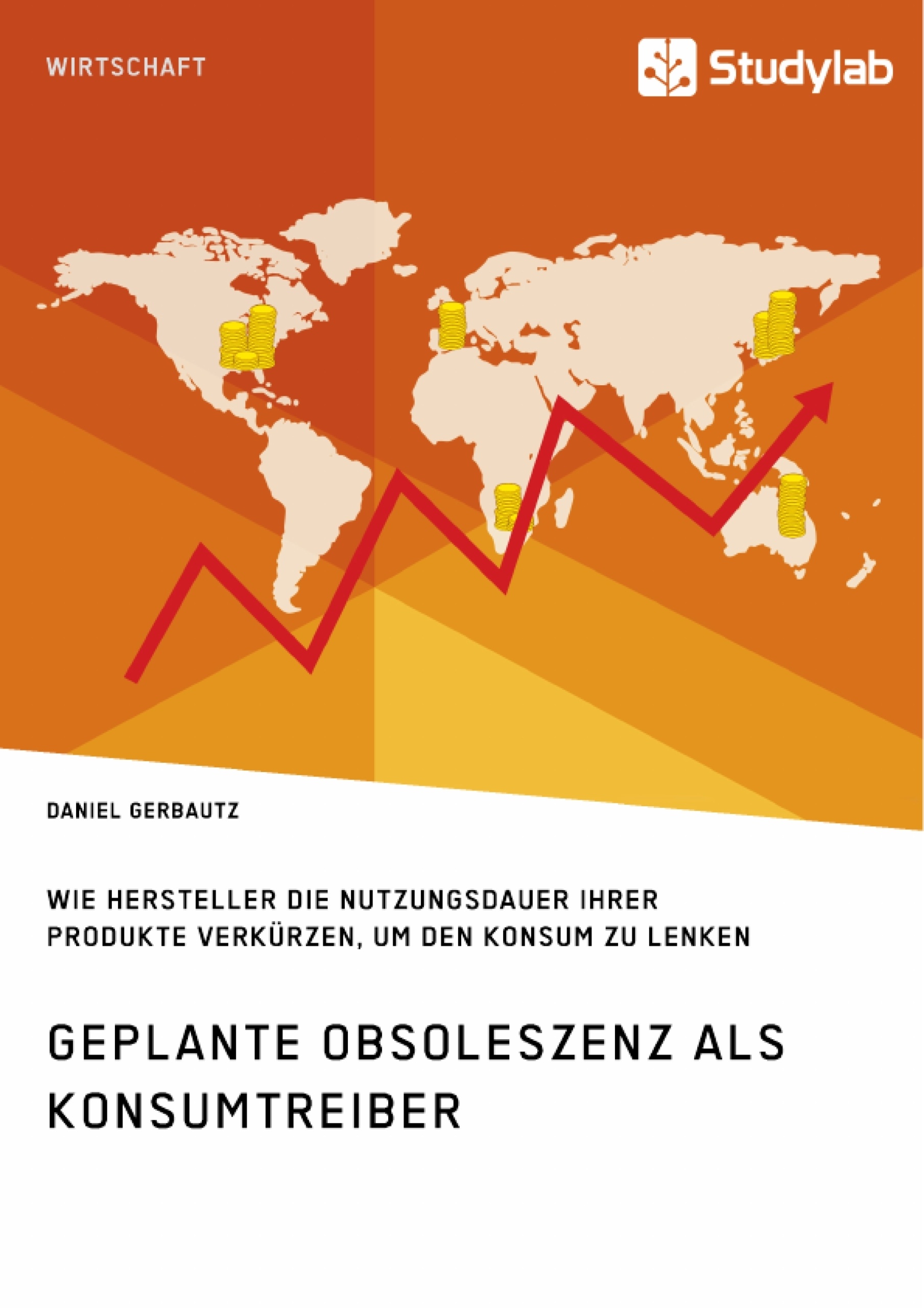Experten zufolge leben wir heute in einer Wegwerfgesellschaft. Diese ist von einem massiven Konsum geprägt. Wir kaufen immer mehr und immer häufiger. Die unzähligen Werbeanzeigen, die täglich auf Konsumenten einprasseln, tragen ihren Teil zu dieser Entwicklung bei.
Doch sind an den negativen Auswirkungen des Konsums wirklich nur die Verbraucher schuld? Daniel Gerbautz deckt in seiner Publikation auf, dass die Hersteller oftmals die Lebensdauer ihrer Produkte vorsätzlich verkürzen. So ist eine andauernde Nachfrage gesichert.
Gerbautz zeigt, welche Produktgruppen besonders betroffen sind und wie die Industrie bei einer geplanten Obsoleszenz ihrer Produkte vorgeht. Doch die Konsumenten sind den Praktiken der Hersteller nicht hilflos ausgesetzt. Gerbautz erklärt, wie die Verbraucher ein Umdenken bewirken können.
Aus dem Inhalt
- Konsumverhalten;
- Nachhaltigkeit;
- Recycling;
- Nutzungsdauer;
- Verschleiß
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Geplante Obsoleszenz – wie alles begann
- 3 Erklärung von Begriffen
- 3.1 Obsoleszenz
- 3.2 Werkstoffliche Obsoleszenz
- 3.3 Funktionale Obsoleszenz
- 3.4 Psychologische Obsoleszenz
- 3.5 Ökonomische Obsoleszenz
- 3.6 Nachhaltiger Konsum
- 3.7 Der Markt
- 4 Hauptsächlich betroffene Produktgruppen
- 5 Nutzungsdauer - der Versuch einer Definition
- 5.1 Die Nutzungsdauer
- 5.2 Die Grundnutzendauer = Lebensdauer
- 5.3 Die Wertdauer
- 5.4 Die Existenzdauer
- 6 Verlängerung der Nutzungsdauer
- 6.1 Wirtschaften in Kreisläufen (W.i.K.)
- 7 Verringerung des Nutzen eines Konsumgutes
- 8 Warum kauft der Konsument?
- 8.1 Die Kaufentscheidung
- 8.2 Ist Glück und Zufriedenheit käuflich?
- 8.3 Das Genussstreben
- 8.4 Erlebnisdrang und Neugier
- 9 Die Aufgabe der Werbung
- 10 Die Macht des Verbrauchers
- 11 Was den Konsumenten glücklich macht
- 12 Werbefakten
- 13 Wirtschaftswachstum als Muss? – Steht der Konsument im Kaufzwang?
- 14 Kaufen ohne Kaufkraft – Die Erfindung der Ratenzahlung
- 15 Folgen des Verkaufes von Konsumgütern unter dem Wert
- 16 Nachhaltiger Konsum - Was kann jeder von uns tun?
- 16.1 Gebrauchtwarenbörsen
- 16.2 Gütesiegel
- 16.3 Sharing
- 16.4 Regionalität
- 16.5 Verlängerung der Nutzungsdauer
- 17 Zeitgerechtes Wirtschaftssystem - Ja oder Nein?
- 18 Der Weg zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell
- 19 Geplanter Verschleiß und die ungleiche Verteilung von Vermögen
- 20 Verlängerung der Nutzungsdauer als nachhaltige Lösung?
- 21 Wie wirkt sich eine längere Nutzungsdauer auf die Gesamtwirtschaft aus?
- 22 Rohstoffgewinnung 2.0
- 22.1 Recyclinggerechtes Konstruieren
- 23 Exkurs: WKO Studie zur tatsächlichen Nutzungsdauer
- 24 Henry Ford und sein „Model T“ – Eines der ersten Opfer moderner geplanter Obsoleszenz
- 25 Warum halten Produkte kürzer als früher?
- 26 Fragebogenauswertung
- 26.1 Haben Sie schon von geplanter Obsoleszenz gehört?
- 26.2 Wie geht der Konsument mit geplanter Obsoleszenz um?
- 26.3 Worin sehen Sie die Ursache für geplante Obsoleszenz?
- 26.4 Was kann als einzelner Konsument unternommen werden?
- 26.5 Was kann von Gesetzeswegen getan werden?
- 26.6 Welche Kriterien beachten Sie wenn Sie kaufen? (offene Frage)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der geplanten Obsoleszenz und deren Auswirkungen auf Konsumverhalten und Wirtschaft. Sie beleuchtet die historischen Wurzeln, erklärt verschiedene Arten der Obsoleszenz und analysiert die Rolle von Werbung und Konsumentenverhalten. Ein Schwerpunkt liegt auf Möglichkeiten zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten und den damit verbundenen ökonomischen und ökologischen Implikationen.
- Historische Entwicklung der geplanten Obsoleszenz
- Verschiedene Arten und Ursachen von Obsoleszenz
- Der Einfluss von Werbung und Marketing
- Strategien zur Verlängerung der Produktlebensdauer
- Ökonomische und ökologische Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Geplante Obsoleszenz ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Sie hebt die Relevanz des Themas für Konsumenten, Wirtschaft und Umwelt hervor und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
2 Geplante Obsoleszenz – wie alles begann: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln der geplanten Obsoleszenz und zeigt auf, wie sich diese Praxis im Laufe der Zeit entwickelt hat. Es werden frühe Beispiele und die dahinterstehenden Motive erläutert.
3 Erklärung von Begriffen: Hier werden die verschiedenen Arten der Obsoleszenz – werkstofflich, funktional, psychologisch und ökonomisch – präzise definiert und voneinander abgegrenzt. Der Begriff des nachhaltigen Konsums wird ebenfalls erläutert und in den Kontext der geplanten Obsoleszenz eingeordnet. Der Marktmechanismus als treibende Kraft wird diskutiert.
4 Hauptsächlich betroffene Produktgruppen: Dieses Kapitel identifiziert und beschreibt Produktgruppen, die besonders stark von geplanter Obsoleszenz betroffen sind. Es werden typische Beispiele genannt und die Gründe für die besonders kurze Lebensdauer dieser Produkte analysiert.
5 Nutzungsdauer - der Versuch einer Definition: Das Kapitel befasst sich mit der Definition von Nutzungsdauer und differenziert zwischen Grundnutzungsdauer, Wertdauer und Existenzdauer. Es analysiert den Unterschied dieser Konzepte und deren Bedeutung im Kontext der geplanten Obsoleszenz.
6 Verlängerung der Nutzungsdauer: Dieses Kapitel erörtert verschiedene Strategien zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten und stellt Konzepte wie das Wirtschaften in Kreisläufen vor. Es werden konkrete Maßnahmen und deren Auswirkungen auf Konsumverhalten und Wirtschaft diskutiert.
7 Verringerung des Nutzen eines Konsumgutes: Hier werden die Methoden untersucht, mit denen Hersteller den Nutzen eines Produkts über die Zeit absichtlich verringern, um den Konsum anzukurbeln. Es werden konkrete Beispiele aus der Praxis analysiert.
8 Warum kauft der Konsument?: Dieses Kapitel analysiert die Kaufentscheidungen von Konsumenten und die dahinterstehenden Motive. Es werden Faktoren wie Genussstreben, Erlebnisdrang und der Einfluss von Werbung untersucht.
9 Die Aufgabe der Werbung: Hier wird die Rolle der Werbung bei der Gestaltung des Konsumverhaltens im Kontext der geplanten Obsoleszenz untersucht. Es wird analysiert, wie Werbung den Konsum von Produkten mit kurzer Lebensdauer fördert.
10 Die Macht des Verbrauchers: Das Kapitel beleuchtet die Macht des Verbrauchers als Einflussfaktor auf die Strategien der Hersteller. Es diskutiert Möglichkeiten, wie Konsumenten Einfluss auf die Produktionsweise und die Lebensdauer von Produkten nehmen können.
11 Was den Konsumenten glücklich macht: Dieser Abschnitt untersucht den Zusammenhang zwischen Konsum, Glück und Zufriedenheit. Es wird hinterfragt, ob und inwieweit Konsum tatsächlich zu Glück und Zufriedenheit beiträgt.
12 Werbefakten: Dieses Kapitel präsentiert relevante Daten und Fakten zum Thema Werbung und Konsumverhalten, um die zuvor getroffenen Aussagen zu untermauern.
13 Wirtschaftswachstum als Muss? – Steht der Konsument im Kaufzwang?: Hier wird die Abhängigkeit des Wirtschaftswachstums vom Konsum kritisch hinterfragt. Es wird diskutiert, ob der Konsument tatsächlich im Kaufzwang steht und welche Alternativen es gibt.
14 Kaufen ohne Kaufkraft – Die Erfindung der Ratenzahlung: Dieses Kapitel beleuchtet die Erfindung der Ratenzahlung und deren Auswirkungen auf das Konsumverhalten. Es wird analysiert, wie die Ratenzahlung den Konsum ankurbelt und welche Folgen dies hat.
15 Folgen des Verkaufes von Konsumgütern unter dem Wert: Hier werden die Konsequenzen des Verkaufs von Produkten unter ihrem tatsächlichen Wert, also unter Berücksichtigung ihrer Produktionskosten und der Lebensdauer, analysiert.
16 Nachhaltiger Konsum - Was kann jeder von uns tun?: Dieses Kapitel beschreibt Möglichkeiten für nachhaltigen Konsum und stellt verschiedene Strategien vor, wie jeder Einzelne zum Umweltschutz beitragen kann. Gebrauchtwarenbörsen, Gütesiegel, Sharing-Modelle und Regionalität werden als Beispiele genannt.
17 Zeitgerechtes Wirtschaftssystem - Ja oder Nein?: Hier wird ein zeitgemäßes Wirtschaftssystem kritisch diskutiert und alternative Modelle vorgestellt.
18 Der Weg zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell: Dieses Kapitel skizziert mögliche Wege zu einem nachhaltigeren Wirtschaftsmodell und diskutiert die Herausforderungen und Chancen.
19 Geplanter Verschleiß und die ungleiche Verteilung von Vermögen: Der Zusammenhang zwischen geplanter Obsoleszenz und der ungleichen Vermögensverteilung wird hier untersucht und analysiert.
20 Verlängerung der Nutzungsdauer als nachhaltige Lösung?: Das Kapitel diskutiert die Bedeutung der Verlängerung der Nutzungsdauer als Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.
21 Wie wirkt sich eine längere Nutzungsdauer auf die Gesamtwirtschaft aus?: Hier werden die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer längeren Nutzungsdauer von Produkten analysiert.
22 Rohstoffgewinnung 2.0: Das Kapitel widmet sich dem Thema Rohstoffgewinnung im Kontext der Nachhaltigkeit und stellt recyclinggerechtes Konstruieren als Ansatz vor.
24 Henry Ford und sein „Model T“ – Eines der ersten Opfer moderner geplanter Obsoleszenz: Dieses Kapitel beleuchtet das Beispiel von Henry Ford und seinem Model T als frühes Beispiel für geplante Obsoleszenz.
25 Warum halten Produkte kürzer als früher?: Dieses Kapitel untersucht die Gründe, warum Produkte heutzutage oft eine kürzere Lebensdauer haben als früher.
Schlüsselwörter
Geplante Obsoleszenz, Konsumverhalten, Nutzungsdauer, Nachhaltigkeit, Wirtschaftswachstum, Werbung, Marketing, Produktdesign, Recycling, Rohstoffe, Konsument, Kaufentscheidung, Lebenszyklus, Wertdauer, Kreislaufwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Geplante Obsoleszenz"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen der geplanten Obsoleszenz und deren Auswirkungen auf Konsumverhalten und Wirtschaft. Sie beleuchtet die historischen Wurzeln, erklärt verschiedene Arten der Obsoleszenz und analysiert die Rolle von Werbung und Konsumentenverhalten. Ein Schwerpunkt liegt auf Möglichkeiten zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten und den damit verbundenen ökonomischen und ökologischen Implikationen.
Welche Arten von Obsoleszenz werden behandelt?
Die Arbeit differenziert zwischen werkstofflicher, funktionaler, psychologischer und ökonomischer Obsoleszenz. Diese werden präzise definiert und voneinander abgegrenzt.
Welche Produktgruppen sind besonders betroffen?
Die Arbeit identifiziert und beschreibt Produktgruppen, die besonders stark von geplanter Obsoleszenz betroffen sind. Es werden typische Beispiele genannt und die Gründe für die besonders kurze Lebensdauer dieser Produkte analysiert.
Wie wird die Nutzungsdauer definiert?
Das Kapitel „Nutzungsdauer“ differenziert zwischen Grundnutzungsdauer (Lebensdauer), Wertdauer und Existenzdauer. Die Bedeutung dieser Konzepte im Kontext der geplanten Obsoleszenz wird analysiert.
Welche Strategien zur Verlängerung der Nutzungsdauer werden vorgestellt?
Die Arbeit erörtert Strategien zur Verlängerung der Nutzungsdauer, darunter Konzepte wie das Wirtschaften in Kreisläufen (W.i.K.). Konkrete Maßnahmen und deren Auswirkungen werden diskutiert.
Wie beeinflussen Hersteller den Nutzen eines Produkts?
Die Arbeit untersucht Methoden, mit denen Hersteller den Nutzen eines Produkts über die Zeit absichtlich verringern, um den Konsum anzukurbeln. Konkrete Beispiele werden analysiert.
Warum kaufen Konsumenten? Welche Motive werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Kaufentscheidungen und Motive wie Genussstreben, Erlebnisdrang und den Einfluss von Werbung.
Welche Rolle spielt Werbung?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Werbung bei der Gestaltung des Konsumverhaltens im Kontext der geplanten Obsoleszenz und wie sie den Konsum von Produkten mit kurzer Lebensdauer fördert.
Welche Macht hat der Verbraucher?
Die Arbeit beleuchtet die Macht des Verbrauchers als Einflussfaktor auf die Strategien der Hersteller und diskutiert Möglichkeiten, wie Konsumenten Einfluss auf die Produktionsweise und die Lebensdauer von Produkten nehmen können.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Konsum, Glück und Zufriedenheit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Konsum, Glück und Zufriedenheit und hinterfragt, ob und inwieweit Konsum tatsächlich zu Glück und Zufriedenheit beiträgt.
Ist Wirtschaftswachstum zwingend an Konsum gebunden?
Die Arbeit hinterfragt kritisch die Abhängigkeit des Wirtschaftswachstums vom Konsum und diskutiert, ob der Konsument tatsächlich im Kaufzwang steht und welche Alternativen es gibt.
Welche Rolle spielt die Ratenzahlung?
Die Arbeit beleuchtet die Erfindung der Ratenzahlung und deren Auswirkungen auf das Konsumverhalten und wie sie den Konsum ankurbelt.
Was sind die Folgen des Verkaufs von Konsumgütern unter ihrem Wert?
Die Arbeit analysiert die Konsequenzen des Verkaufs von Produkten unter ihrem tatsächlichen Wert, unter Berücksichtigung ihrer Produktionskosten und Lebensdauer.
Wie kann nachhaltiger Konsum umgesetzt werden?
Die Arbeit beschreibt Möglichkeiten für nachhaltigen Konsum und stellt Strategien vor, wie jeder Einzelne zum Umweltschutz beitragen kann (z.B. Gebrauchtwarenbörsen, Gütesiegel, Sharing-Modelle, Regionalität).
Wie könnte ein zeitgemäßes Wirtschaftssystem aussehen?
Die Arbeit diskutiert kritisch ein zeitgemäßes Wirtschaftssystem und stellt alternative Modelle vor.
Wie kann ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell erreicht werden?
Die Arbeit skizziert mögliche Wege zu einem nachhaltigeren Wirtschaftsmodell und diskutiert Herausforderungen und Chancen.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen geplanter Obsoleszenz und Vermögensverteilung?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen geplanter Obsoleszenz und der ungleichen Vermögensverteilung.
Ist die Verlängerung der Nutzungsdauer eine nachhaltige Lösung?
Die Arbeit diskutiert die Bedeutung der Verlängerung der Nutzungsdauer als Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.
Welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen hat eine längere Nutzungsdauer?
Die Arbeit analysiert die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer längeren Nutzungsdauer von Produkten.
Was ist recyclinggerechtes Konstruieren?
Die Arbeit behandelt das Thema Rohstoffgewinnung im Kontext der Nachhaltigkeit und stellt recyclinggerechtes Konstruieren als Ansatz vor.
Welche Rolle spielte Henry Ford und sein Model T?
Die Arbeit beleuchtet das Beispiel von Henry Ford und seinem Model T als frühes Beispiel für geplante Obsoleszenz.
Warum halten Produkte heute kürzer als früher?
Die Arbeit untersucht die Gründe, warum Produkte heutzutage oft eine kürzere Lebensdauer haben als früher.
- Quote paper
- Daniel Gerbautz (Author), 2019, Geplante Obsoleszenz als Konsumtreiber. Wie Hersteller die Nutzungsdauer ihrer Produkte verkürzen, um den Konsum zu lenken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450768