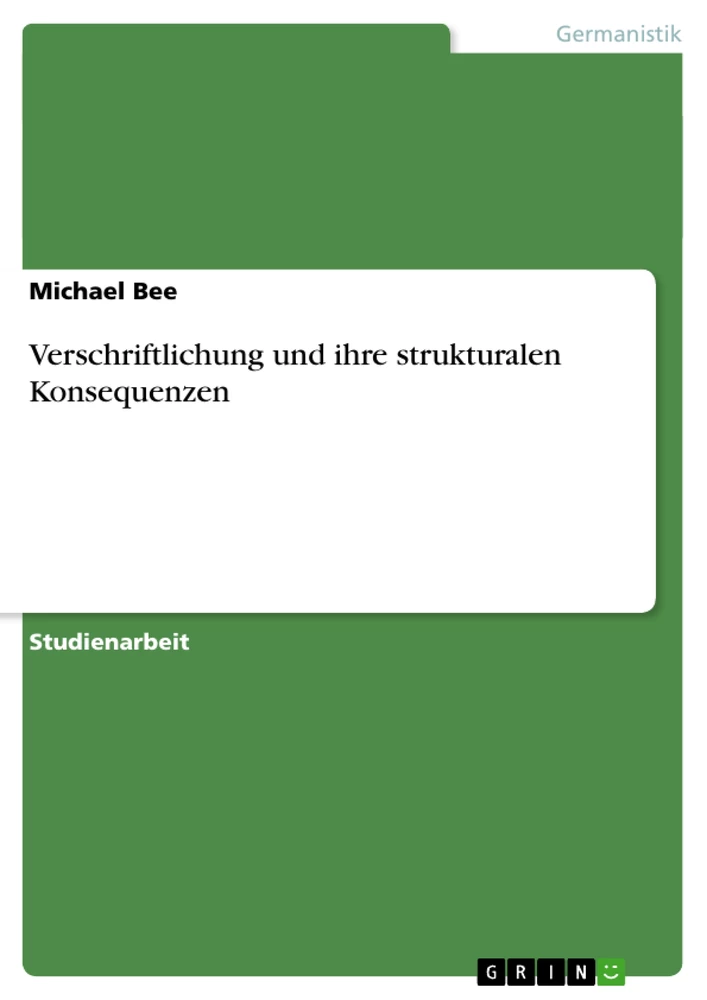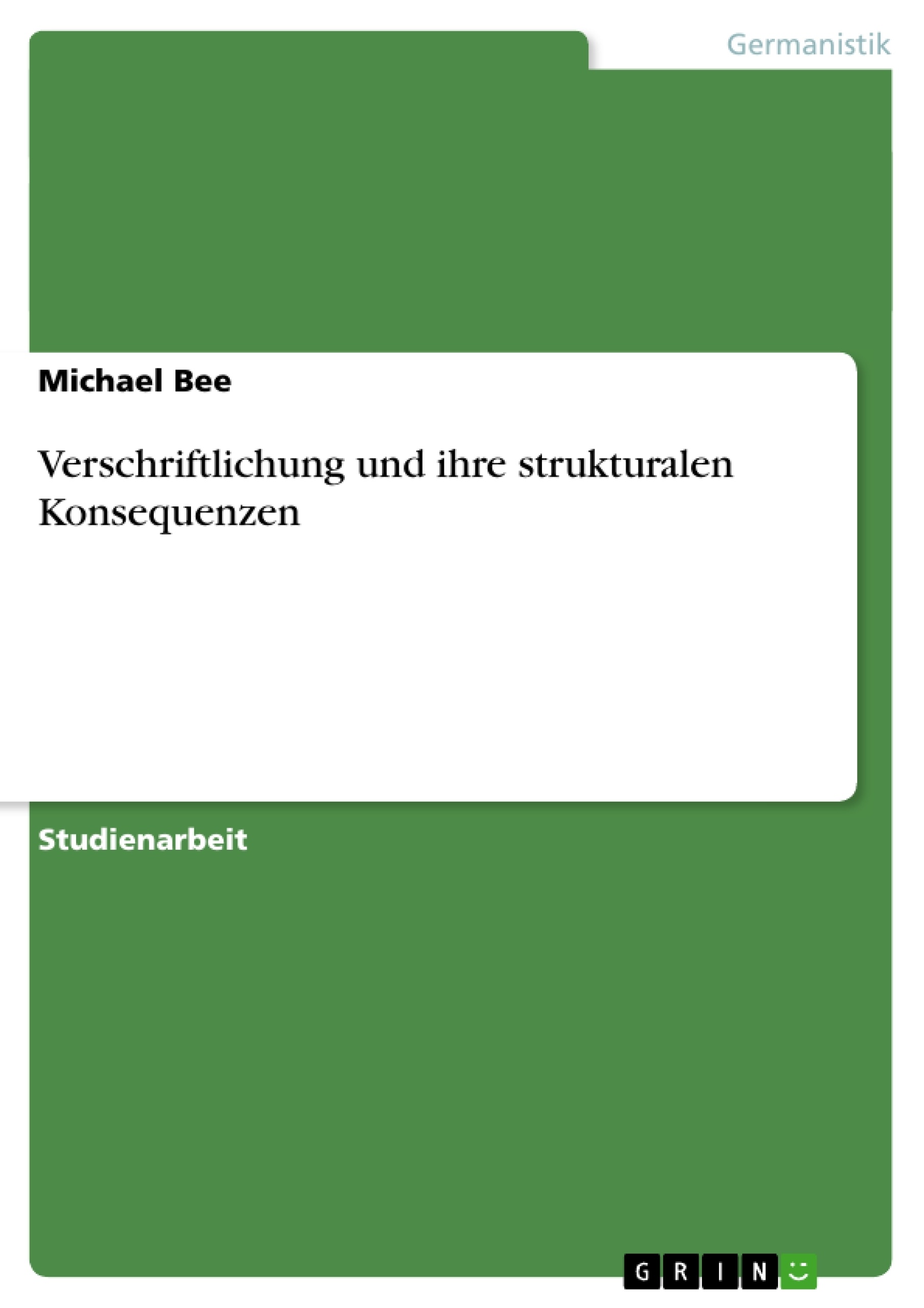„Mündliche Kommunikation ist sowohl ontogenetisch wie phylogenetisch als auch in der alltäglichen Erfahrungswelt der meisten Menschen die grundlegende Form des Sprachgebrauchs.“ (Schoenthal 2000: 460) Diese Einschätzung von Gisela Schoenthal im Metzler Lexikon Sprache (2000) scheint auf den ersten Blick stichhaltig und einleuchtend: Gesprochene Sprache gilt als eine anthropologische Univeralie und mag als gattungskostituierendes Merkmal des Menschen gewertet werden. Die gesprochene Sprache sei in allen Gesellschaften und zu allen Zeiten das zentrale Mittel menschlicher Interaktion. Sie scheine nicht nur älter als die Schrift zu sein, auch in der individuellen menschlichen Entwicklung gehe der Spracherwerb dem Schriftspracherwerb im Normalfall voraus. Der Lexikoneintrag erweist sich allerdings problematisch, wenn man seine Kehrseite und die daraus resultierenden Implikationen betrachtet. Wenn gesprochene Sprache einen primären und unmittelbaren Stellenwert besitzt, wie ist dann geschriebene Sprache einzuschätzen? Besitzt sie eine – in Relation zur gesprochenen Sprache – sekundäre Bedeutung? Ist sie gar abhängig von gesprochener Sprache und somit von geringerem sprachwissenschaftlichem Interesse? Beschäftigt man sich mit Strukturen schriftlicher Kommunikation sind diese Fragen von fundamentaler Bedeutung, da sie den Forschungsgegenstand a priori perspektivieren und einen problemorientierten Blick erschweren. Daher erscheint es ratsam, zunächst einen Blick auf den Forschungsstreit zwischen Autonomie- und Dependenztheoretikern zu werfen. Erst im Anschluss daran ist es möglich, eine differenzierte Analyse der spezifischen Strukturen von Schriftlichkeit zu skizzieren.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung: Autonomie- und Dependenztheorie im Widerstreit
- Die Flüchtigkeit sprachlichen Handelns und ihre Überwindung durch Vertextung
- Verschriftlichung und ihre strukturalen Konsequenzen
- Die Dissoziierung von Produzenten und Rezipienten als konstituierendes Merkmal schriftlicher Kommunikation
- Verschriftlichung und ihre strukturalen Konsequenzen
- Expeditive Prozeduren
- Deiktische Prozeduren
- Nennende Prozeduren
- Operative Prozeduren
- Malende Prozeduren
- Fazit und Ausblick: Die Expansion technisch gestützter Schriftlichkeit als Relevanzverlust strukturaler Unterschiede
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation und die Konsequenzen der Verschriftlichung. Sie beleuchtet den Forschungsstreit zwischen Autonomie- und Dependenztheoretikern und analysiert spezifische Strukturen der Schriftlichkeit. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Kommunikationsformen.
- Der Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation
- Die Forschungsdebatte um Autonomie und Dependenz der Schriftlichkeit
- Strukturelle Konsequenzen der Verschriftlichung
- Analyse prototypischer Merkmale mündlicher und schriftlicher Sprache
- Die Überwindung der Flüchtigkeit mündlicher Kommunikation durch Vertextung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Autonomie- und Dependenztheorie im Widerstreit: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und diskutiert den Gegensatz zwischen der Auffassung der Schriftlichkeit als abhängig von der Mündlichkeit (Dependenztheorie) und der Sichtweise der Schriftlichkeit als eigenständiges System (Autonomie-Theorie). Es werden verschiedene Positionen von Sprachwissenschaftlern vorgestellt, die die Eigenständigkeit der Schriftlichkeit betonen und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung beider Kommunikationsformen hervorheben. Die Einleitung betont die Bedeutung der Klärung dieser theoretischen Grundlagen für die anschließende Analyse der Strukturen schriftlicher Kommunikation.
Die Flüchtigkeit sprachlichen Handelns und ihre Überwindung durch Vertextung: Der Abschnitt konzentriert sich auf die Flüchtigkeit als prototypisches Merkmal mündlicher Kommunikation. Obwohl technische Aufzeichnungsmethoden diese Flüchtigkeit reduzieren, bleibt die Sprechhandlung ein einmaliges Ereignis, begrenzt auf den Raum und die Zeit der Interaktion. Die Arbeit kontrastiert diese Flüchtigkeit mit den Möglichkeiten der Vertextung, die die Speicherung und Weitergabe von Informationen über die Grenzen des unmittelbaren Kontextes hinaus ermöglichen. Es werden Beispiele prä-literaler Kulturen genannt, die verschiedene mnemotechnische Verfahren nutzten, um die Flüchtigkeit der gesprochenen Sprache zu überwinden und Wissen zu konservieren, wie z.B. Versmaß, Reim und Melodie.
Verschriftlichung und ihre strukturalen Konsequenzen: Dieses Kapitel analysiert die strukturellen Veränderungen, die die Umwandlung von mündlicher in schriftliche Sprache mit sich bringt. Es wird die Dissoziierung von Produzent und Rezipient als konstituierendes Merkmal schriftlicher Kommunikation hervorgehoben. Der Text untersucht verschiedene Prozeduren, die mit der Verschriftlichung einhergehen, wie z.B. expeditive, deiktische, nennende, operative und malende Prozeduren, und analysiert deren Auswirkungen auf die Struktur des Textes. Der Fokus liegt auf der systematischen Erfassung der unterschiedlichen strukturellen Konsequenzen des Übergangs von der gesprochenen zur geschriebenen Sprache.
Schlüsselwörter
Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Verschriftlichung, Autonomie, Dependenz, Sprachwissenschaft, Kommunikation, Textlinguistik, Gesprächsanalyse, Vertextung, Strukturen, Funktionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Autonomie und Dependenz der Schriftlichkeit
Was ist der zentrale Gegenstand dieses Textes?
Der Text untersucht den Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation und die Konsequenzen der Verschriftlichung. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Forschungsstreit zwischen Autonomie- und Dependenztheoretikern bezüglich der Schriftlichkeit und der Analyse spezifischer Strukturen der Schriftlichkeit. Der Text beleuchtet Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Kommunikationsformen.
Welche Theorien werden im Text diskutiert?
Der Text diskutiert die gegensätzlichen Theorien der Autonomie und Dependenz der Schriftlichkeit. Die Autonomie-Theorie betrachtet Schriftlichkeit als eigenständiges System, während die Dependenz-Theorie sie als abhängig von der Mündlichkeit sieht. Der Text präsentiert verschiedene Positionen von Sprachwissenschaftlern zu diesem Thema und betont die Bedeutung der Klärung dieser theoretischen Grundlagen für das Verständnis der Strukturen schriftlicher Kommunikation.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Text umfasst folgende Kapitel: Eine Vorbemerkung zum Gegensatz zwischen Autonomie- und Dependenztheorie, ein Kapitel über die Flüchtigkeit mündlicher Kommunikation und ihre Überwindung durch Vertextung, ein Kapitel zur Analyse der strukturellen Konsequenzen der Verschriftlichung (inkl. expeditiver, deiktischer, nennender, operativer und malender Prozeduren) und abschließend ein Fazit und Ausblick zum Relevanzverlust struktureller Unterschiede durch technisch gestützte Schriftlichkeit.
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation laut diesem Text?
Ein zentraler Unterschied liegt in der Flüchtigkeit mündlicher Kommunikation im Gegensatz zur dauerhaften Verfügbarkeit schriftlicher Texte. Die Verschriftlichung führt zur Dissoziierung von Produzent und Rezipient und bewirkt strukturelle Veränderungen in der Kommunikation, die im Text detailliert analysiert werden (z.B. durch die verschiedenen Prozeduren).
Welche strukturellen Konsequenzen der Verschriftlichung werden behandelt?
Der Text analysiert verschiedene Prozeduren, die mit der Verschriftlichung einhergehen, darunter: expeditive (effiziente), deiktische (auf Zeigewörter bezogene), nennende (Benennungs-), operative (handlungsorientierte) und malende (bildhafte) Prozeduren. Diese Prozeduren beeinflussen die Struktur und den Aufbau schriftlicher Texte.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Textes wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Verschriftlichung, Autonomie, Dependenz, Sprachwissenschaft, Kommunikation, Textlinguistik, Gesprächsanalyse, Vertextung, Strukturen, Funktionen.
Welche Methoden werden in diesem Text angewendet?
Der Text verwendet eine vergleichende Analyse von mündlicher und schriftlicher Kommunikation, theoretische Diskussionen zu bestehenden Theorien (Autonomie vs. Dependenz) und eine strukturelle Analyse der schriftlichen Sprache, um die Konsequenzen der Verschriftlichung zu beleuchten.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für Personen gedacht, die sich wissenschaftlich mit Sprachwissenschaft, Textlinguistik oder Kommunikationswissenschaft befassen und sich für die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von mündlicher und schriftlicher Kommunikation interessieren.
- Citar trabajo
- Michael Bee (Autor), 2005, Verschriftlichung und ihre strukturalen Konsequenzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45073