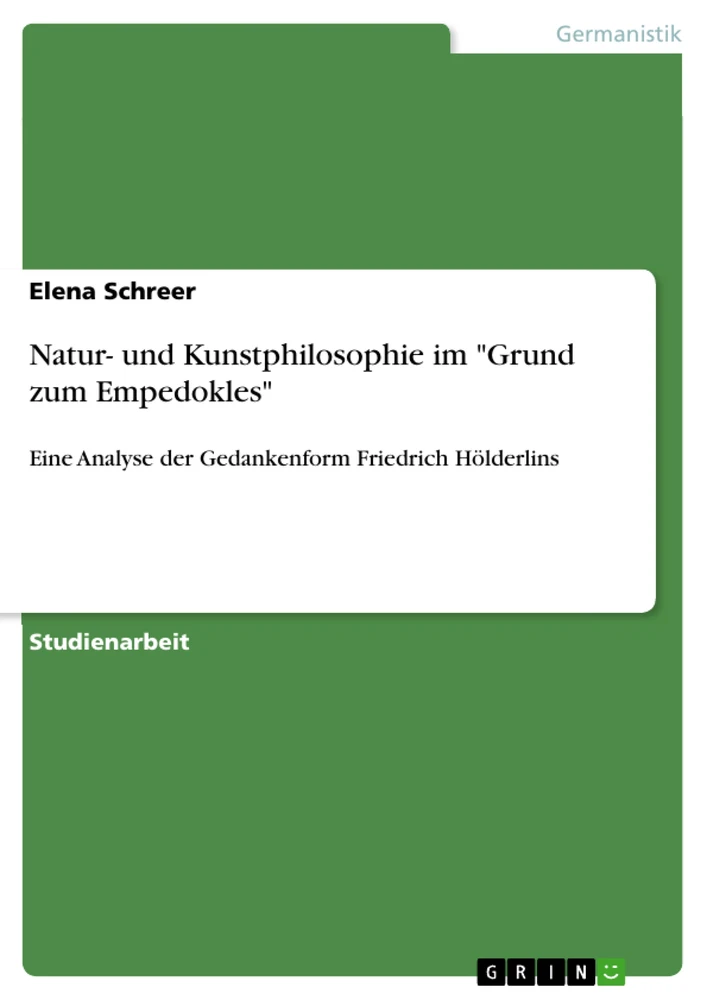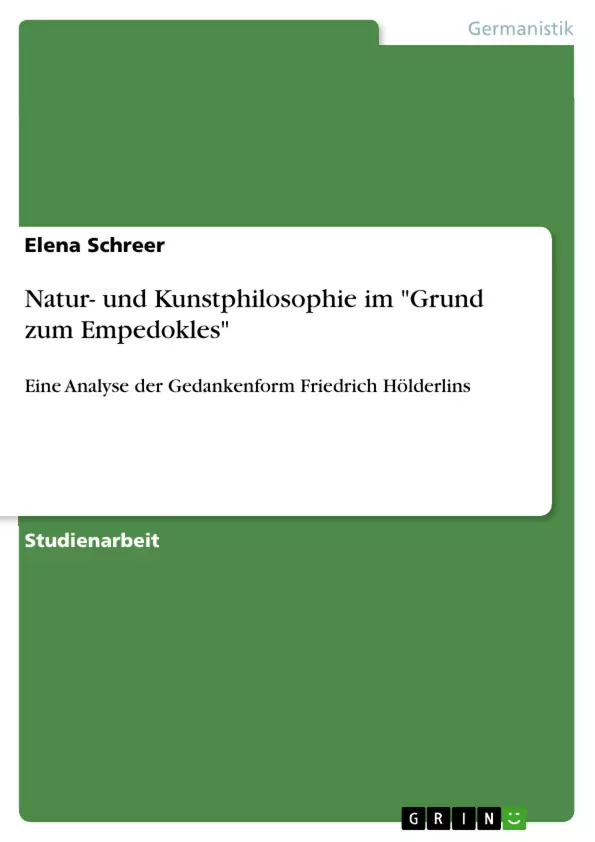Als Philosoph und Dichter, der sich nach seiner Profession in Jena (1794-1795) ausschließlich der Poesie zugewandt hat, liegen den Werken Friedrich Hölderlins (1770-1843), wie dem Tod des Empedokles, bewusstseins- und religions-philosophische Motive zugrunde. Im Empedokles-Drama, welches die Grundlage dieser Arbeit darstellt, stellen die Religions- und Naturphilosophie wichtige Themenbereiche sowohl auf geschichtlicher als auch auf poetischer Ebene dar. Den primären Forschungsgegenstand dieser Arbeit bildet Hölderlins Schrift zum Grund des Empedokles.
Bei diesem handelt es sich um einen theoretischen Text, der primär zur Selbstverständigung Hölderlins bestimmt war und die Bedeutung seines Trauerspiels reflektiert. Da die Passage ursprünglich nicht zur Veröffentlichung bestimmt war, kann die komplexe Passage für den neutralen Leser einige Verständnisschwierigkeiten aufwerfen, die hier aufgelöst werden sollen. Nach einer kurzen Erläuterung zur Entstehung und Textkonstruktion des Empedokles-Projekts, indem unter anderem auf die Bedeutung der Tragödie eingegangen wird, soll im Verlauf dieser Arbeit den Fragen nachgegangen werden, was die Natur- und Kunstphilosophie im Grund zum Empedokles aussagt, welche Komponenten sie vereinigt und inwieweit sich diese gegenseitig bedingen oder konträr zueinander stehen.
Daraufhin wird eine Verbindung zu Hölderlins Auffassung über Bewusstsein und Geist hergestellt, in der die Zusammenhänge von Poesie, Religion und Mythos diskutiert werden. Sie sollen Aufschluss darüber geben, welches Ziel Hölderlin als Dichter durch seine Philosophie über Natur und Kunst in seinen Werken verfolgt. In einem abschließenden Fazit werden die wichtigsten Erkenntnisse und Zusammenhänge der Arbeit noch einmal zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung und Textkonstruktion
- 2.1 Zur Bedeutung der Tragödie
- 3. Natur- und Kunstphilosophie
- 3.1 Begriffspaare Natur und Kunst
- 3.2 Begriffspaare organisch und aorgisch
- 4. Bewusstsein und Geist
- 4.1 Poesie
- 4.2 Religion
- 4.3 Mythos
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Friedrich Hölderlins „Grund zum Empedokles“, einen theoretischen Text, der die philosophischen und poetologischen Grundlagen seines Trauerspiels „Der Tod des Empedokles“ beleuchtet. Die Analyse konzentriert sich auf die darin enthaltene Natur- und Kunstphilosophie und deren Zusammenhang mit Hölderlins Verständnis von Bewusstsein, Geist, Poesie, Religion und Mythos.
- Natur- und Kunstphilosophie bei Hölderlin
- Die Bedeutung der Tragödie in Hölderlins Werk
- Der Zusammenhang von Poesie, Religion und Mythos
- Hölderlins poetologische Konzeption
- Die philosophische Selbstverständigung Hölderlins im „Grund zum Empedokles“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt den „Grund zum Empedokles“ als zentralen Forschungsgegenstand vor. Sie beschreibt das Werk als einen theoretischen Text zur Selbstverständigung Hölderlins, der die Bedeutung seines Trauerspiels „Der Tod des Empedokles“ reflektiert. Die Einleitung umreißt die Forschungsfragen der Arbeit, die sich auf die Natur- und Kunstphilosophie, sowie den Zusammenhang von Poesie, Religion und Mythos in Hölderlins Werk konzentrieren. Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Passagen des „Grund zum Empedokles“ für den Leser verständlicher zu machen und Hölderlins Zielsetzung als Dichter zu beleuchten.
2. Entstehung und Textkonstruktion: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und den verschiedenen Fassungen des unvollendeten Dramas „Der Tod des Empedokles“. Es wird auf den „Frankfurter Plan“, die verschiedenen Fassungen des Dramas und den „Grund zum Empedokles“ eingegangen, wobei letzterer als Hauptfokus der Arbeit hervorgehoben wird. Die Kapitelstruktur des „Grund zum Empedokles“ wird erläutert und die Inspirationsquelle des Dramas, die Lehren und Lebensbeschreibung des antiken Philosophen Empedokles, wird beleuchtet. Der Abschnitt betont die Bedeutung der Tragödie im Werk Hölderlins und legt die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel, indem er den Kontext des „Grund zum Empedokles“ innerhalb des Gesamtwerks darstellt.
2.1 Zur Bedeutung der Tragödie: Dieser Unterabschnitt analysiert Hölderlins Auffassung von Tragödie. Er betont das Paradoxon des Ursprünglichen, das in seiner Schwäche erscheint und dessen "Zeichen" mit "0" gesetzt werden muss, um den verborgenen Grund jeder Natur zu offenbaren. Die Passage zeigt einen zentralen Aspekt von Hölderlins poetologischer Konzeption auf und verweist auf seine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Erscheinung und Wesen.
Schlüsselwörter
Friedrich Hölderlin, Empedokles, Naturphilosophie, Kunstphilosophie, Tragödie, Poesie, Religion, Mythos, Bewusstsein, Geist, „Grund zum Empedokles“, poetologische Konzeption, Selbstverständigung.
Häufig gestellte Fragen zum "Grund zum Empedokles" von Friedrich Hölderlin
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Hölderlins „Grund zum Empedokles“, einen theoretischen Text, der die philosophischen und poetologischen Grundlagen seines Trauerspiels „Der Tod des Empedokles“ beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Natur- und Kunstphilosophie und deren Verbindung zu Hölderlins Verständnis von Bewusstsein, Geist, Poesie, Religion und Mythos.
Welche Themen werden im "Grund zum Empedokles" behandelt?
Die zentralen Themen sind Hölderlins Natur- und Kunstphilosophie, die Bedeutung der Tragödie in seinem Werk, der Zusammenhang von Poesie, Religion und Mythos, seine poetologische Konzeption und seine philosophische Selbstverständigung im "Grund zum Empedokles".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehung und Textkonstruktion des "Grund zum Empedokles" (inkl. eines Unterkapitels zur Bedeutung der Tragödie), ein Kapitel zur Natur- und Kunstphilosophie und ein Kapitel zu Bewusstsein und Geist (Poesie, Religion, Mythos), sowie ein Fazit. Die Einleitung stellt den Text und die Forschungsfragen vor. Kapitel 2 behandelt die Entstehung und Struktur des Werkes und die Bedeutung der Tragödie. Kapitel 3 und 4 befassen sich mit der Natur- und Kunstphilosophie und dem Verhältnis von Poesie, Religion und Mythos.
Was ist die Bedeutung des "Grund zum Empedokles" im Gesamtwerk Hölderlins?
Der "Grund zum Empedokles" wird als ein theoretischer Text zur Selbstverständigung Hölderlins gesehen, der die Bedeutung seines Trauerspiels "Der Tod des Empedokles" reflektiert und seine philosophischen und poetologischen Ansichten beleuchtet. Er liefert somit wichtige Einblicke in Hölderlins Denken und künstlerische Konzeption.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Hölderlin, Empedokles, Naturphilosophie, Kunstphilosophie, Tragödie, Poesie, Religion, Mythos, Bewusstsein, Geist, „Grund zum Empedokles“, poetologische Konzeption, Selbstverständigung.
Wie wird die Tragödie in Hölderlins Werk verstanden?
Der Text hebt das Paradoxon des Ursprünglichen hervor, das in seiner Schwäche erscheint und dessen "Zeichen" mit "0" gesetzt werden muss, um den verborgenen Grund jeder Natur zu offenbaren. Dies zeigt einen zentralen Aspekt von Hölderlins poetologischer Konzeption und seinem Verhältnis von Erscheinung und Wesen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für Friedrich Hölderlins Werk, insbesondere den "Grund zum Empedokles", interessieren und ein tieferes Verständnis seiner philosophischen und poetologischen Ansichten erlangen möchten. Sie ist besonders für akademische Zwecke geeignet.
- Quote paper
- Elena Schreer (Author), 2018, Natur- und Kunstphilosophie im "Grund zum Empedokles", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450263