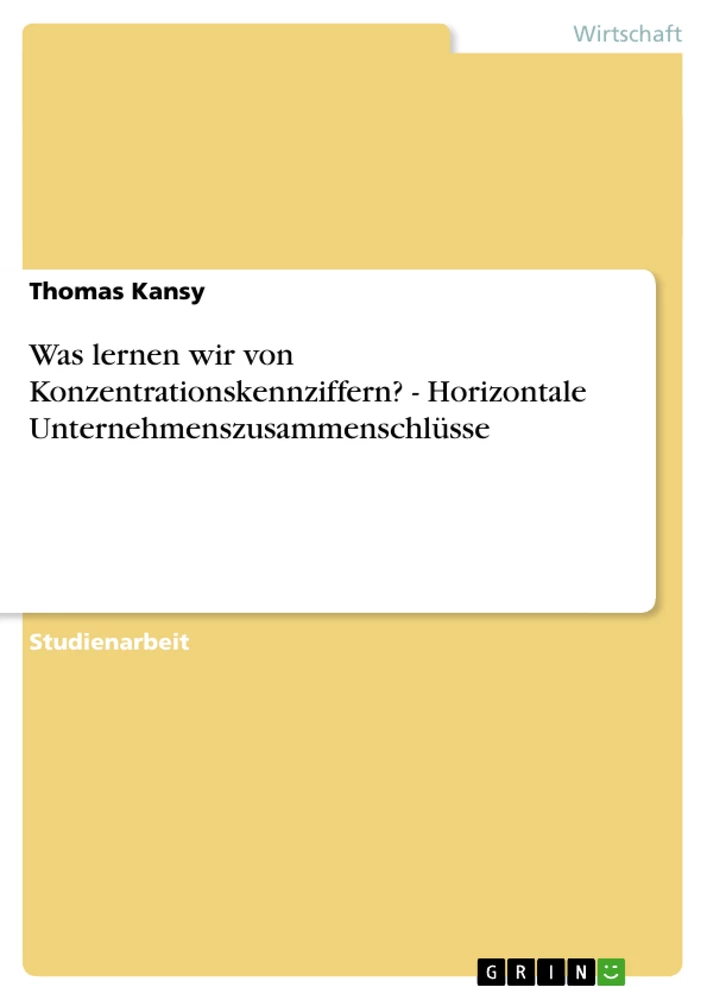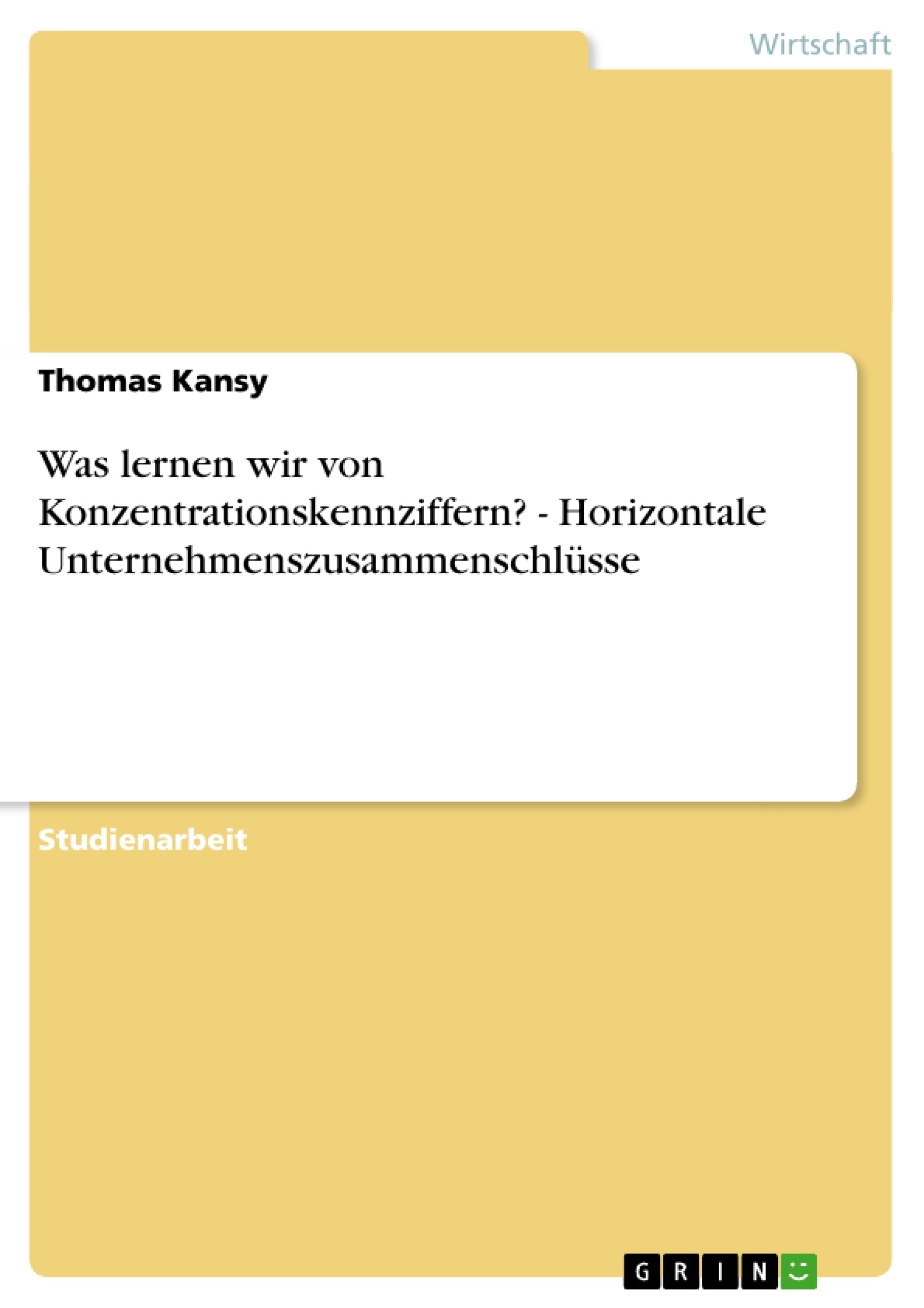Unter einem Unternehmenszusammenschluss oder einer Fusion wird in dieser Arbeit die Vereinigung von Unternehmungen auf dem Vertragswege verstanden. Der Begriff Unternehmenszusammenschluss wird hier im weiten Sinn verwendet. Eine feindliche Übernahme, also ein Übernahmeangebot an die Aktionäre, ohne dass das Management damit einverstanden ist, fällt auch darunter.
Ein horizontaler Unternehmenszusammenschluss ist eine Vereinigung von zwei oder mehr Wettbewerbern, die sich auf dem gleichen Markt für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen befinden. Dieser Markt kann auch räumlich getrennt sein wie in Kapitel 2.3 bei den Unternehmensmotiven für Zusammenschlüsse deutlich wird. Damit ist gemeint, dass ein Unternehmen die gleichen Produkte anbietet wie ein anderes, aber nicht im gleichen Staat tätig ist. Die beiden Unternehmen würden in einer solchen Situation zu einem gegebenem Zeitpunkt nicht i n direkter Konkurrenz zueinander stehen, haben möglicherweise aber einen Anreiz zu fusionieren. Daneben gibt es vertikale Fusionen, bei denen sich Unternehmen auf verschiedenen (vorgelagerten oder nachgelagerten) Produktionsstufen zusammenschließen. Der Vollständigkeit halber seien noch die konglomeraten Fusionen erwähnt, die Vereinigungen von Firmen sind, die weder direkte Rivalen noch Produzenten in der selben Wertschöpfungskette sind und die in der Seminararbeit nicht berücksichtigt werden. Im Jahre 2002 haben sich die Fusionsaktivitäten, nach Angaben des Bundeskartellamts, weltweit merklich abgekühlt. Gründe dafür sind unter anderem die Börsenbaisse der vergangenen Jahre und die Abschwächung der früheren Fusionseuphorie. Investoren und Fondsverwalter fragen nachdrücklicher nach den möglichen Vorteilen einer Fusion. Die Börsenbaisse hat Einfluss auf eine wichtige Akquisitionswährung, nämlich die Aktienkurse des übernehmenden Unternehmens. In manchen Branchen herrschte jedoch rege Fusionstätigkeit, u.a. in der Chemie- und Pharmaindustrie, in der leitungsgebundenen Energiewirtschaft und in der Mineralölindustrie. Dort kam es zu tief greifenden Umstrukturierungen. Die folgende Abbildung zeigt Anzahl und Art der beim Bundeskartellamt angemeldeten Fusionen. Die überwiegende Mehrheit waren in allen Jahren horizontale Zusammenschlüsse mit Produktausweitung, was bedeutet, dass das erworbene Unternehmen und der Erwerber auf benachbarten Märkten der gleichen Wirtschaftsstufe tätig sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Motive für Unternehmenszusammenschlüsse aus Sicht der Unternehmen
- 2.1 Effizienzmotiv
- 2.2 Marktmachtmotiv
- 2.3 Andere Motive
- 3. Kartellrechtliche Rahmenbedingung
- 3.1 Deutsche Fusionskontrolle
- 3.2 EG-Fusionskontrolle
- 4. Auswirkungen von (horizontalen) Fusionen auf den Wettbewerb
- 5. Konzentrationsmaße als schlechtes Mittel für die Bewertung von horizontalen Unternehmenszusammenschlüssen
- 6. Alternative Bewertungsindikatoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht horizontale Unternehmenszusammenschlüsse und hinterfragt die Aussagekraft von Konzentrationskennziffern bei deren Bewertung. Die Arbeit analysiert die Motive für Fusionen aus Unternehmenssicht, die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen auf den Wettbewerb. Ziel ist es, alternative Bewertungsindikatoren aufzuzeigen.
- Motive für horizontale Unternehmenszusammenschlüsse
- Kartellrechtliche Regulierung von Fusionen
- Auswirkungen horizontaler Fusionen auf den Wettbewerb
- Kritik an Konzentrationsmaßen als Bewertungsmaßstab
- Alternative Bewertungsmethoden für horizontale Fusionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff des Unternehmenszusammenschlusses, insbesondere den horizontalen Zusammenschluss, und skizziert den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund der Fusionsaktivitäten in den Jahren 2002 und 2003. Sie hebt die Bedeutung der Untersuchung von Fusionsmotiven und der Kritik an traditionellen Bewertungsmethoden hervor. Der Fokus liegt auf der Analyse der Auswirkungen horizontaler Fusionen, wobei vertikale und konglomerate Fusionen nur kurz erwähnt werden.
2. Motive für Zusammenschlüsse aus Sicht der Unternehmen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Motiven von Unternehmen für Fusionen. Im Mittelpunkt steht das Effizienzmotiv, welches durch verschiedene Kategorien von Effizienzgewinnen, wie Rationalisierungsgewinne, Größen- und Verbundvorteile sowie technologischen Fortschritt, erläutert wird. Die Ausführungen basieren auf dem Konzept der Produktionsfunktion und zeigen, wie Fusionen zu Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen führen können. Weitere Motive werden kurz angerissen.
3. Kartellrechtliche Rahmenbedingung: Dieses Kapitel beschreibt die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmenszusammenschlüsse in Deutschland und der Europäischen Union. Es analysiert die deutschen und europäischen Fusionskontrollverfahren und deren Bedeutung für die Zulassung von Fusionen. Der Fokus liegt auf der Prüfung der wettbewerbsrechtlichen Bedenken und der Notwendigkeit von Zusagen oder Auflagen zur Genehmigung von Fusionen. Die Ausführungen zeigen die Bedeutung der kartellrechtlichen Kontrolle für den Schutz des Wettbewerbs.
4. Auswirkungen von (horizontalen) Fusionen auf den Wettbewerb: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen horizontaler Fusionen auf den Wettbewerb. Es analysiert, wie Fusionen zu Marktmachtkonzentration, Preisänderungen und Innovationen führen können. Der Abschnitt beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Fusionen und den Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft, wobei die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bewertung von Fusionen im Hinblick auf ihre wettbewerbspolitische Relevanz hervorgehoben wird. Quantitative Daten zur Anzahl und Art von Fusionen werden präsentiert und interpretiert.
5. Konzentrationsmaße als schlechtes Mittel für die Bewertung von horizontalen Unternehmenszusammenschlüssen: Dieses Kapitel kritisiert die Verwendung von Konzentrationsmaßen als alleiniges Instrument zur Bewertung horizontaler Unternehmenszusammenschlüsse. Es argumentiert, dass diese Maße die komplexen Auswirkungen von Fusionen auf den Wettbewerb nur unzureichend erfassen und daher eine ungenügende Grundlage für wettbewerbspolitische Entscheidungen darstellen. Die Kritik an der Methode wird detailliert dargelegt.
6. Alternative Bewertungsindikatoren: Dieses Kapitel erörtert alternative Bewertungsindikatoren für horizontale Unternehmenszusammenschlüsse, die die Schwächen der traditionellen Konzentrationsmaße überwinden sollen. Die vorgeschlagenen Indikatoren berücksichtigen u.a. die Effizienzgewinne, die Innovationspotenziale und die Auswirkungen auf die Verbraucher. Es werden anspruchsvollere Ansätze zur Beurteilung der Auswirkungen von Fusionen vorgeschlagen.
Schlüsselwörter
Horizontale Unternehmenszusammenschlüsse, Fusionen, Kartellrecht, Fusionskontrolle, Konzentrationsmaße, Effizienzgewinne, Wettbewerbspolitik, Marktmacht, Bewertungsindikatoren, Synergieeffekte.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Horizontale Unternehmenszusammenschlüsse
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht horizontale Unternehmenszusammenschlüsse und hinterfragt kritisch die Aussagekraft von Konzentrationskennziffern bei deren Bewertung. Sie analysiert die Motive für Fusionen aus Unternehmenssicht, die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen auf den Wettbewerb. Ziel ist es, alternative Bewertungsindikatoren aufzuzeigen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Motive für horizontale Unternehmenszusammenschlüsse, die kartellrechtliche Regulierung von Fusionen, die Auswirkungen horizontaler Fusionen auf den Wettbewerb, die Kritik an Konzentrationsmaßen als Bewertungsmaßstab und alternative Bewertungsmethoden für horizontale Fusionen.
Welche Motive für horizontale Unternehmenszusammenschlüsse werden betrachtet?
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Effizienzmotiv, das durch verschiedene Kategorien von Effizienzgewinnen (Rationalisierungsgewinne, Größen- und Verbundvorteile, technologischer Fortschritt) erläutert wird. Weitere Motive werden ebenfalls kurz angerissen.
Wie werden die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen behandelt?
Die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmenszusammenschlüsse in Deutschland und der Europäischen Union werden beschrieben, inklusive der Analyse der deutschen und europäischen Fusionskontrollverfahren und deren Bedeutung für die Zulassung von Fusionen.
Welche Auswirkungen horizontaler Fusionen auf den Wettbewerb werden untersucht?
Die Arbeit analysiert, wie Fusionen zu Marktmachtkonzentration, Preisänderungen und Innovationen führen können. Die komplexen Zusammenhänge zwischen Fusionen und ihren Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft werden beleuchtet.
Warum wird die Verwendung von Konzentrationsmaßen kritisiert?
Die Hausarbeit argumentiert, dass Konzentrationsmaße die komplexen Auswirkungen von Fusionen auf den Wettbewerb nur unzureichend erfassen und daher eine ungenügende Grundlage für wettbewerbspolitische Entscheidungen darstellen. Die Kritik an der Methode wird detailliert dargelegt.
Welche alternativen Bewertungsindikatoren werden vorgeschlagen?
Die Arbeit erörtert alternative Bewertungsindikatoren, die die Schwächen der traditionellen Konzentrationsmaße überwinden sollen. Diese berücksichtigen u.a. die Effizienzgewinne, die Innovationspotenziale und die Auswirkungen auf die Verbraucher.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Horizontale Unternehmenszusammenschlüsse, Fusionen, Kartellrecht, Fusionskontrolle, Konzentrationsmaße, Effizienzgewinne, Wettbewerbspolitik, Marktmacht, Bewertungsindikatoren, Synergieeffekte.
Welche Kapitel beinhaltet die Hausarbeit und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Hausarbeit besteht aus sechs Kapiteln: Einleitung (Definition des Begriffs, Kontext der Arbeit), Motive für Zusammenschlüsse aus Unternehmenssicht (Effizienzmotiv im Vordergrund), Kartellrechtliche Rahmenbedingungen (deutsche und EU-Fusionskontrolle), Auswirkungen horizontaler Fusionen auf den Wettbewerb, Konzentrationsmaße als ungeeignetes Bewertungsmittel und schließlich alternative Bewertungsindikatoren.
- Quote paper
- Thomas Kansy (Author), 2005, Was lernen wir von Konzentrationskennziffern? - Horizontale Unternehmenszusammenschlüsse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45025