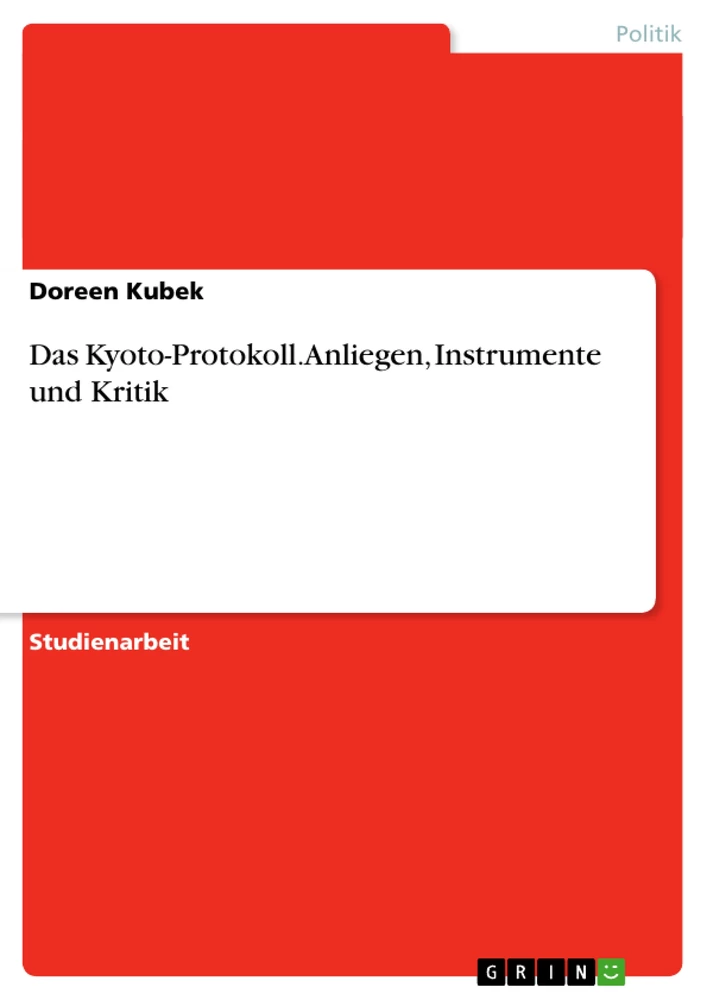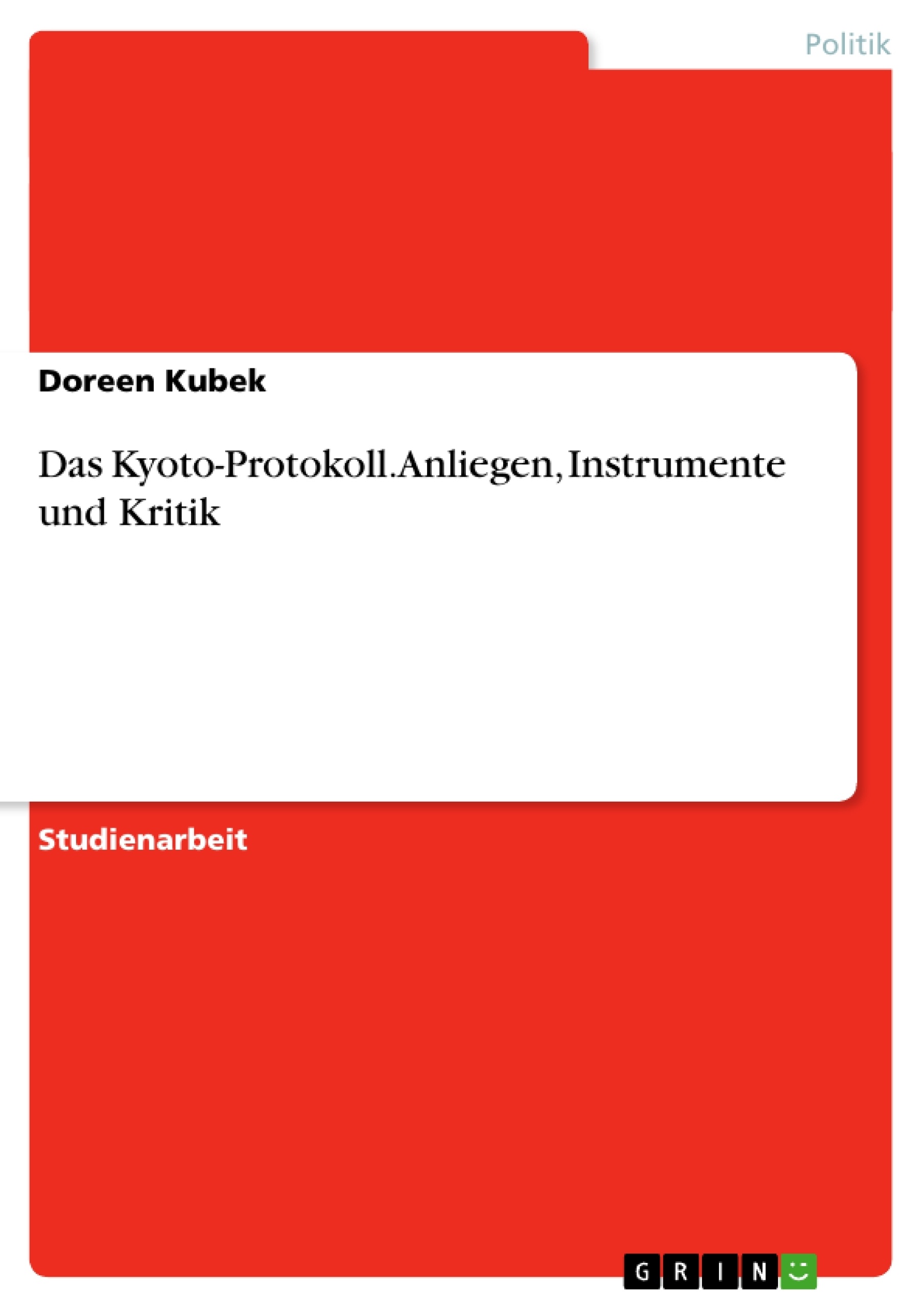Bereits seit vielen Jahren weisen Forscher auf einen stattfindenden Klimawandel hin, der maßgeblich durch den Umgang der Menschen mit ihrer Umwelt bestimmt wird. Die Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung, bewirkte ein Ansteigen der Durchschnittstemperatur, deren Auswirkungen bereits heute spürbar sind und in den nächsten Jahrzehnten drastische Folgen für die Natur und den Menschen nach sich ziehen können. Jedoch wurde auch festgestellt, dass mit einer Begrenzung und Verringerung des Ausstoßes verschiedener Treibhausgase, die Erderwärmung und der Klimawandel sowie die damit für den Menschen verbundenen Gefahren abgemildert werden können.
Anfang der 90er Jahre wurde die daraus resultierende globale Aufgabe endlich aufgegriffen und erste Schritte in Richtung einer internationalen Klimapolitik gemacht. Ein Ergebnis dessen war im Jahr 1997 das Kyoto-Protokoll, das bis jetzt als einziger Meilenstein internationaler Klimaschutzpolitik anzusehen ist. Lange war es unsicher, ob es jemals in Kraft treten würde - doch nun ist es soweit: Das Kyoto-Protokoll verpflichtet ab dem 16. Februar 2005 nach jahrelangen zähen Verhandlungen, über 30 Industriestaaten völkerrechtlich verbindlich zur Reduktion ihrer Emissionen.
Hinsichtlich dieses Ereignisses, wie man es zweifelsohne nennen muss, stellt sich die Frage, was das Kyoto-Protokoll bedeutet, was es beinhaltet und vor allem wie wirksam es eigentlich sein kann. Dem versucht sich die vorliegende Arbeit zu widmen. Zunächst sollen der natürliche und der anthropogene Treibhauseffekt und daraus folgende Prognosen kurz als Grundlagen dargestellt werden, um die Notwendigkeit aktiver Klimaschutzpolitik zu verdeutlichen. Im Anschluss daran wird das Kyoto-Protokoll in seinen klimapolitischen Zusammenhängen, Inhalten und Instrumenten erläutert und schließlich sollen wesentliche Kritikpunkte angesprochen werden, da die Einbeziehung von Kritik notwendig ist, um eine zusammenfassende Bewertung des Protokolls zu ermöglichen. Da der Rahmen dieser Ausarbeitung in Anbetracht der Fülle des Themas äußerst begrenzt ist, muss angemerkt sein, dass dies nur insgesamt eine kurze Erläuterung sein kann, die Präzisierung bezüglich vieler damit verbundener Themen bedarf. So müssten z.B. erneuerbare Energien, das übergeordnete Ziel der Nachhaltigkeit und politische und institutionelle Gefüge der internationalen Politik näher betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klimawandel und Treibhauseffekt
- Natürlicher und anthropogener Treibhauseffekt
- Auswirkungen und Prognosen
- Das Kyoto-Protokoll
- Der Weg nach Kyoto
- Inhalte
- Instrumente: Flexible Mechanismen
- Emission Bubble (EB)
- Joint Implementation (JI)
- Clean Development Mechanism (CDM)
- International Emission Trading (IET)
- Kritik und Probleme
- Emissionsreduktionen reichen nicht aus
- Die Problematik der Senken
- Wirtschaft vor Umweltschutz
- Neo-Kolonialisierung
- Das Fehlen der USA
- 2012- und danach?
- Zusammenfassung und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Kyoto-Protokoll und untersucht dessen Bedeutung, Inhalt und Wirksamkeit im Hinblick auf den globalen Klimaschutz. Ziel ist es, ein umfassendes Bild des Protokolls zu zeichnen, seine wichtigsten Punkte zu beleuchten und die damit verbundenen Kritikpunkte zu diskutieren.
- Der natürliche und anthropogene Treibhauseffekt
- Die Auswirkungen des Klimawandels
- Die Inhalte des Kyoto-Protokolls
- Die flexiblen Mechanismen zur Emissionsreduktion
- Kritikpunkte und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Klimawandel und seine Ursachen dar, die zur Entwicklung des Kyoto-Protokolls führten. Es wird darauf hingewiesen, dass der Klimawandel als das größte Umweltproblem des 21. Jahrhunderts angesehen wird und dass die globale Erwärmung durch menschliche Aktivitäten verursacht wird. Die Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung hat den natürlichen Treibhauseffekt verstärkt, was zu einem Anstieg der Durchschnittstemperatur führt.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Kyoto-Protokoll und seiner Entstehung. Es werden die Inhalte des Protokolls, insbesondere die flexiblen Mechanismen, erläutert. Dazu zählen Joint Implementation (JI), Clean Development Mechanism (CDM) und International Emission Trading (IET).
Im dritten Kapitel werden verschiedene Kritikpunkte am Kyoto-Protokoll diskutiert. Es wird argumentiert, dass die vereinbarten Emissionsreduktionen nicht ausreichend sind, dass die Problematik der Senken nicht ausreichend berücksichtigt wird, dass wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen und dass das Protokoll zu einer neo-kolonialen Entwicklung führen könnte. Schließlich wird die Abwesenheit der USA und die Frage nach dem Zeitraum nach 2012 thematisiert.
Schlüsselwörter
Kyoto-Protokoll, Klimawandel, Treibhauseffekt, Emissionsreduktion, Flexible Mechanismen, Kritik, Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Internationale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel des Kyoto-Protokolls?
Das Ziel ist die völkerrechtlich verbindliche Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen durch Industriestaaten, um die Erderwärmung abzumildern.
Was sind die "Flexiblen Mechanismen" im Kyoto-Protokoll?
Dazu gehören Joint Implementation (JI), der Clean Development Mechanism (CDM) und der internationale Emissionshandel (IET).
Warum standen die USA dem Protokoll kritisch gegenüber?
Die USA lehnten das Protokoll ab, da sie wirtschaftliche Nachteile befürchteten und die fehlende Verpflichtung von Schwellenländern wie China kritisierten.
Was ist der Unterschied zwischen natürlichem und anthropogenem Treibhauseffekt?
Der natürliche Effekt macht Leben auf der Erde erst möglich; der anthropogene Effekt wird durch menschliche Aktivitäten (Industrie, Verkehr) verstärkt und führt zum Klimawandel.
Welche Kritik gibt es am Kyoto-Protokoll?
Kritiker bemängeln, dass die Reduktionsziele zu gering sind, Schlupflöcher wie "Senken" (Wälder) existieren und wirtschaftliche Interessen oft über den Umweltschutz gestellt werden.
- Quote paper
- Doreen Kubek (Author), 2005, Das Kyoto-Protokoll. Anliegen, Instrumente und Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44968