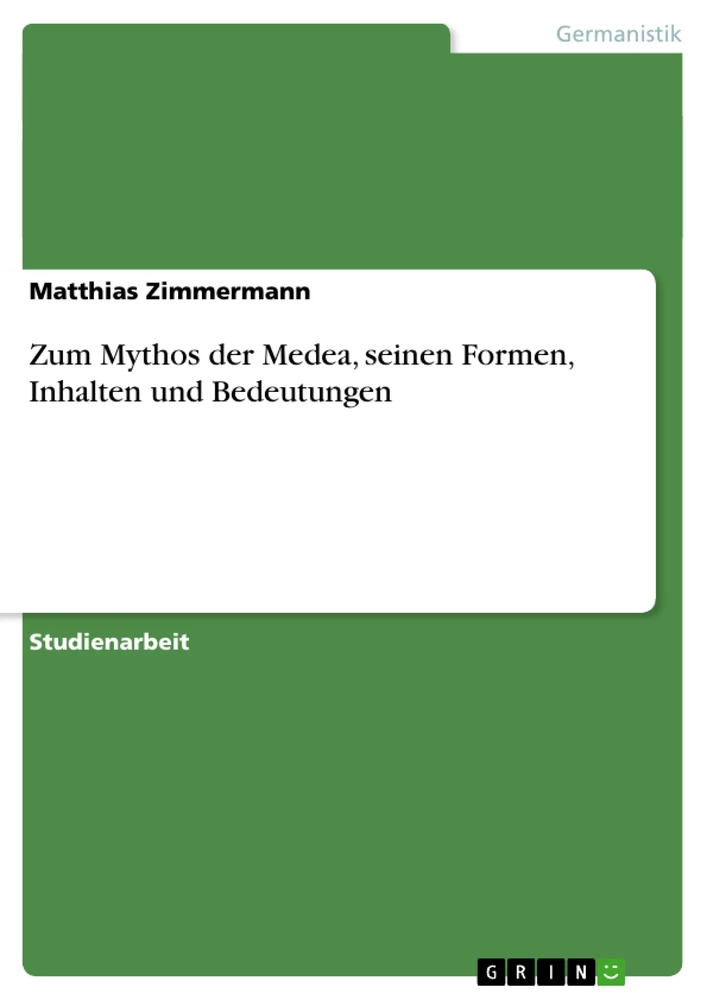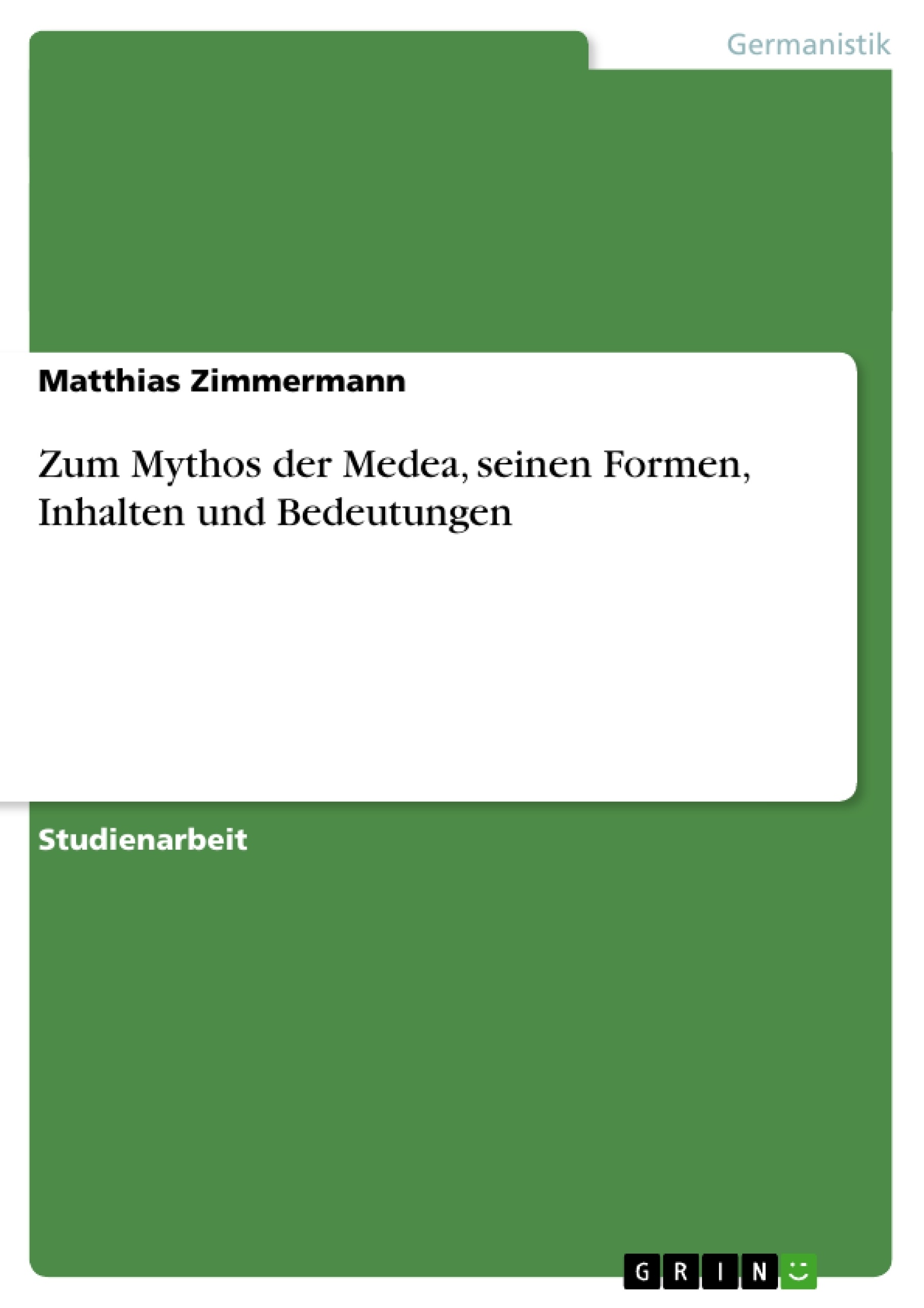Es wird wohl nie jemand – gleich Borges’ Bibliothek von Babel – eine Bibliothek eröffnen, in welcher sich in ihren heiligen Hallen auf hunderten Metern hoher Regale das gesammelte Schweigen der Menschheit drängt. Macht schon die Idee einer solchen Bibliothek eigentlich keinen Sinn?
Doch! So seltsam es auch klingen mag, hat doch das Schweigen eine rege (wenn auch weitgehend unbekannte) Geschichte des Verschweigens hinter sich. Und genau hier trifft es sich mit der Frau (als solcher).
Es scheint, wir befinden uns an einer Kreuzung, denn wieder trifft jemand auf dieser Straße mit den beiden schon Anwesenden zusammen – Medea. Auch ihre Geschichte ist eine, die nahezu ausschließlich von Männern niedergelegt wurde. Dabei steht außer Frage, dass Männer auf andere Art und Weise und mit eigener Motivation diese Geschichte niedergelegt haben, als Frauen es getan hätten. Daher muss dieser Sachverhalt bei der Untersuchung von Medeas Reise durch die Jahrtausende immer mitreflektiert wer- den, denn er hat dazu geführt, dass bestimmte Dinge betont und andere verschwiegen wurden.
Und warum Medea? Weil sie eine Frau ist. Dennoch soll es um Medea gehen, denn sie ist einerseits eine Polarisationsfigur männlicher Weiblichkeitsprojektionen und zugleich in den letzten Jahren innerhalb der verstärkten Selbstbeschreibung durch Frauen eine Identifikationsfigur weiblichen Schreibens. Und weil zu einer guten Kreuzung eigentlich immer vier Straßen gehören, kommt als letzter noch der Mythos in den Kreis der Besehenen. Seine Gemeinsamkeit mit den anderen, die sich über die besondere Verfasstheit ihrer Geschichte identifizieren, ist nicht unbedingt offensichtlich, geht man doch allgemein davon aus, dass der Mythos zeitlos ist. Doch bei einem zweiten Blick ist schnell klar, dass er „sehr wohl eine Geschichte hat: die seiner Interpretation.“
Nun, wo sie schon alle vier – das Schweigen (als das prototypische Außen), die Frau (als prototypischer Schweiger), Medea (als prototypische Frau), und der Mythos (als erste Besitzergreifung aller drei) – hier auf einer Kreuzung versammelt stehen, sollen sie auch zu Wort kommen, oder wenigstens sollen die Worte miteinander ringen, die über sie auffindbar waren. Pate bei diesem Gespräch steht das Werk Christa Wolfs und vor allem ihr Buch „Medea. Stimmen“, das sich des Quartetts – zumindest in meiner Lesart – behutsam annimmt.
Inhaltsverzeichnis
- An Stelle einer Einleitung....
- I. Mythos Medea....
- 1.1 Der Ursprung…..\n
- Erstes Intermezzo - der Mythos vom Mythos.....
- 1.2 Euripides' Medea......
- Zweites Intermezzo – „imaginierte Weiblichkeit“ und ,,Weiblichkeitswahn\".
- II. Das Schweigen…………..\n
- III. Die Andere in Vielen – Christa Wolfs Medea…......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Mythos der Medea und seinem Schweigen, insbesondere im Kontext von Christa Wolfs „Medea. Stimmen“. Sie untersucht die vielschichtigen Formen und Bedeutungen des Mythos, fokussiert dabei auf die verschwiegenen und verschweigenden Aspekte und analysiert diese vor dem Hintergrund des Schweigens als Phänomen.
- Das Schweigen der Medea als Ausdruck ihrer inneren Zerrissenheit und als Spiegelbild der männlichen Dominanz in der antiken Welt
- Die Rolle des Mythos in der Konstruktion von Geschlechterrollen und der Darstellung von Weiblichkeit
- Die Interpretation des Mythos durch verschiedene Kulturen und Epochen
- Die Bedeutung des Schweigens als Mittel der Macht und als Form des Widerstands
- Die Analyse von Christa Wolfs „Medea. Stimmen“ im Kontext der modernen Interpretation des Mythos
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Ursprünge des Medea-Mythos ein und untersucht seine verschiedenen Formen und Bedeutungen in unterschiedlichen antiken Quellen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der verschwiegenen und verschweigenden Aspekte des Mythos. Das zweite Kapitel widmet sich Euripides’ Medea, einer der bekanntesten Versionen des Mythos. Hier werden die Darstellung der Titelfigur und ihre Motivlagen im Kontext der antiken Gesellschaft untersucht. Das dritte Kapitel widmet sich dem Schweigen der Medea und analysiert die verschiedenen Formen des Schweigens als Ausdruck von Schmerz, Trauer, Wut und Widerstand. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Christa Wolfs "Medea. Stimmen" und untersucht, wie die Autorin den Mythos neu interpretiert und dabei die Figur der Medea mit ihren eigenen Erfahrungen und Perspektiven verbindet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Schweigens, des Mythos, der Weiblichkeit und der Macht. Im Fokus steht die Analyse des Medea-Mythos und seiner verschiedenen Interpretationen, insbesondere im Kontext des Schweigens als Ausdruck von Unterdrückung und Widerstand. Es werden dabei wichtige Konzepte wie "imaginierte Weiblichkeit", "Weiblichkeitswahn" und "das Andere" beleuchtet, die für das Verständnis der komplexen Dynamik zwischen Sprache, Geschlecht und Macht von Bedeutung sind.
- Quote paper
- Matthias Zimmermann (Author), 2003, Zum Mythos der Medea, seinen Formen, Inhalten und Bedeutungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44913