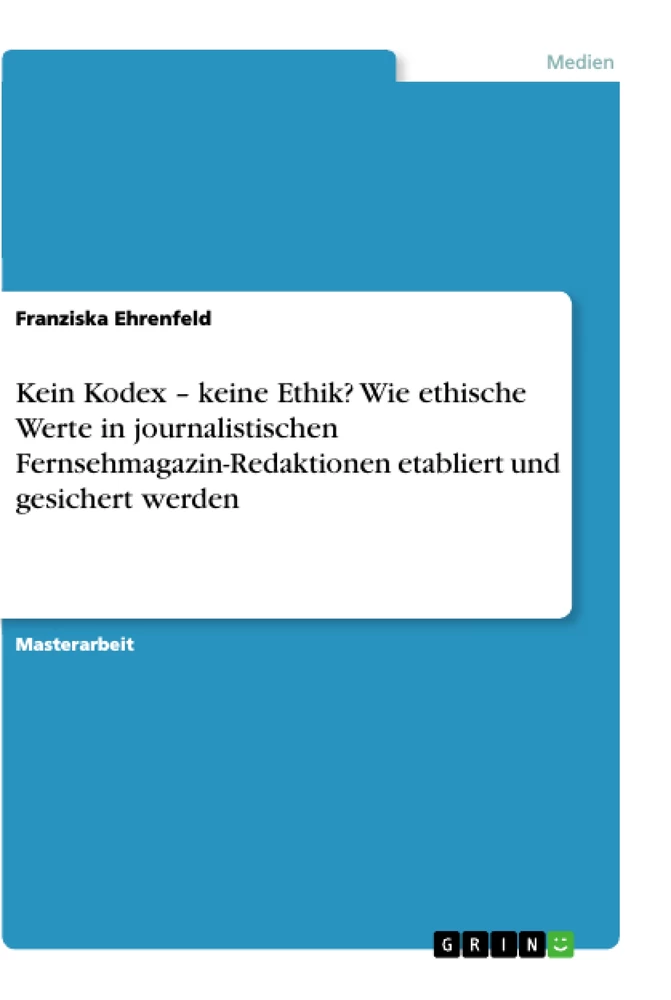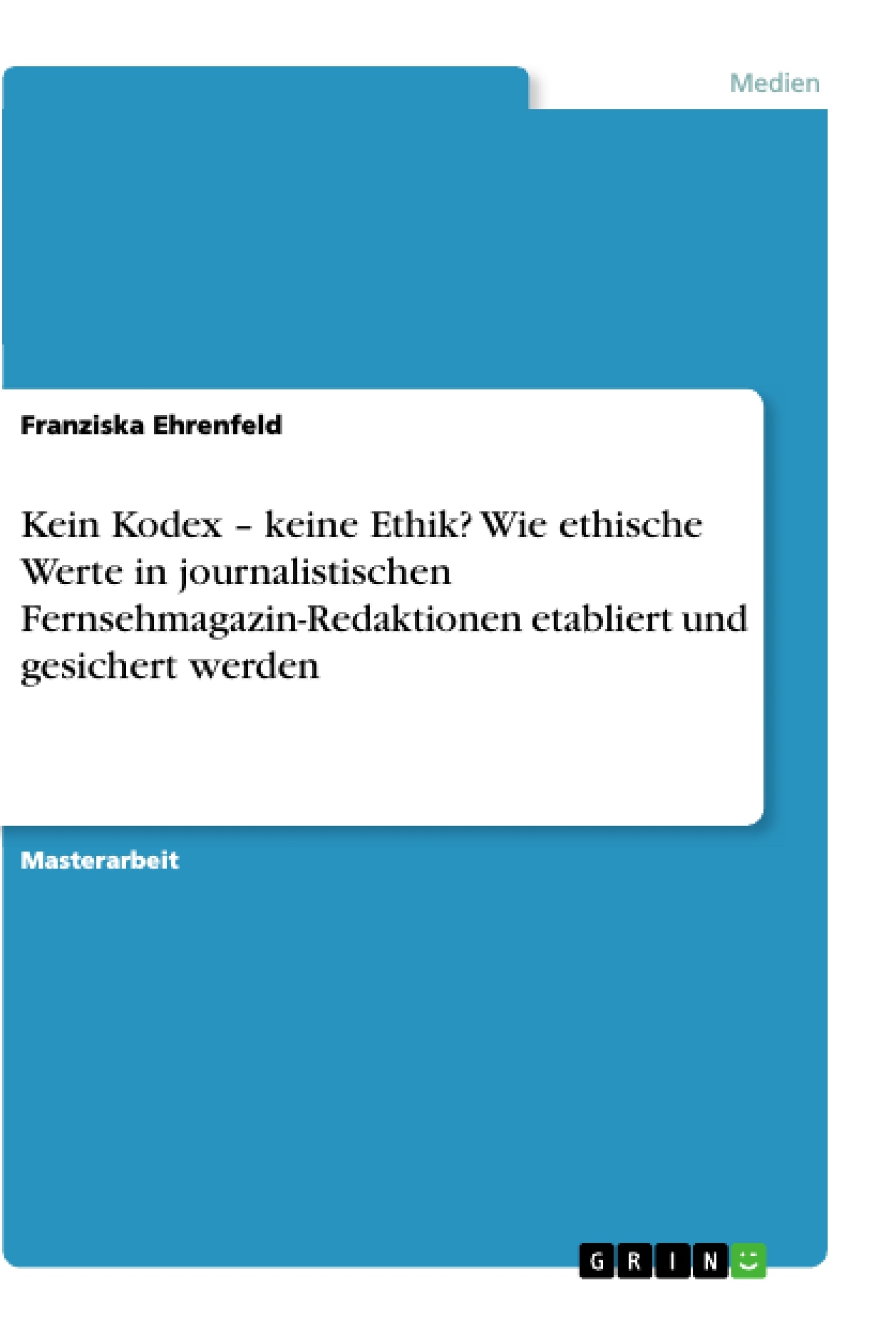Vor dem Hintergrund, dass es für den Fernsehjournalismus kein Äquivalent zu den Publizistischen Grundsätzen des Deutschen Presserats – kurz: Pressekodex – gibt, wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht, auf welcher Basis deutsche Fernsehmagazin-Redaktionen ethische Entscheidungen bei der Berichterstattung treffen und wie die Einhaltung dieser Normen gesichert wird.
Dazu wurden fünf Leitfadeninterviews mit Redakteuren in verantwortlichen Positionen verschiedener Fernsehmagazin-Redaktionen geführt und überwiegend qualitativ ausgewertet.Als Grundlage dafür wurden außerdem die vorliegenden redaktions- und unternehmenseigenen Kodizes auf ihre Genauigkeit im Vergleich zum Pressekodex und dem Medienkodex des Netzwerks Recherche inhaltlich analysiert.
Das Ergebnis dieser Analyse war, dass die redaktions- und unternehmenseigenen Kodizes weitaus unkonkreter sind als der Pressekodex. Viele reichen, was die Präzision angeht, nicht einmal an den nur einseitigen, stichpunktartigen Medienkodex heran. Die Auswertung der Leitfadeninterviews ergab, dass diese Kodizes trotzdem einen hohen Stellenwert als Basis für redaktionelle, ethische Entscheidungen haben.
Der Pressekodex ist für alle untersuchten Redaktionen ebenfalls von Bedeutung – wenn auch nicht in sehr großem Umfang. Der Medienkodex spielt hingegen nahezu keine Rolle im redaktionellen Alltag.
Wichtigstes Instrument zur Etablierung und Sicherung von Ethik im Fernsehmagazin-Journalismus scheint der Dialog zwischen den Mitarbeitern zu sein. Darüber hinaus gibt es verschiedene Formen von Institutionen, die als Kontrollinstanzen auftreten können, meist aber andere Hauptaufgaben und kaum Sanktionierungsmöglichkeiten haben.
Die Etablierung eines allgemeingültigen Fernsehkodex nach dem Vorbild des Pressekodex wäre grundsätzlich eine sinnvolle Möglichkeit, Ethik zu stärken und die fernsehjournalistische Berichterstattung gegenüber dem Publikum zu legitimieren. Allerdings stieß diese Idee bei den Befragten eher nicht auf Anklang, da diese mit der derzeitigen Lage der Ethiksicherung überaus zufrieden sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Theoretische Grundlagen
- 1. Journalismusethik – wieso?
- 1.1 Erhalt der Pressefreiheit durch verantwortungsvollen Journalismus
- 1.2 Die Komplexität journalistischen Handelns
- 1.3 Qualitätsverlust?
- 1.3.1 Der Zusammenhang von Ethik und Qualität
- 1.4 Reflexion, Steuerung und Orientierung
- 2. Besonderheiten der Journalismusethik
- 2.1 Anforderungen
- 2.2 Bedeutung der Redaktion
- 2.3 Spannungsfeld Journalismusethik
- 2.4 Sicherung von Ethik
- 2.5 Problematik
- 3. Institutionalisierung von Ethik
- 3.1 Regelwerke
- 3.2 Ombudsleute
- 3.3 Presserat und Pressekodex als Exempel
- 3.3.1 Geschichte
- 3.3.2 Inhalt und Funktionsweise des Pressekodex
- 3.3.3 Der Pressekodex in der Diskussion
- 3.3.4 Akzeptanz des Pressekodex bei Journalisten
- 3.3.5 Ein allgemeiner Kodex auch fürs Fernsehen?
- 4. Regulierung beim Fernsehen
- 4.1 Privat-kommerzielles Fernsehen
- 4.2 Öffentlich-rechtliches Fernsehen
- 4.3 Problematik
- 5. Besondere Relevanz der Ethik beim Fernsehen
- 5.1 Fernsehen als Leitmedium
- 5.2 Wirkung und Glaubwürdigkeit
- 5.3 Komplexität
- 6. Besonderheiten des fernsehjournalistischen Alltags und Auswirkungen auf die Ethik
- 6.1 Produktionsschritte
- 6.2 Aktuelle Entwicklungen
- 6.2.1 Zunehmende Dominanz der Bilder
- 6.2.2 Ressourcenknappheit
- 7. Wie kann Fernseh-Journalismusethik erfolgreich etabliert werden?
- 7.1 Verantwortungsverteilung
- 7.2 Regelwerke
- 7.3 Kontrolle
- 7.4 Chancen des Internets nutzen
- 7.5 Sensibilisierung
- III. Positionierung des Themas in der Forschungslandschaft
- 1. Einordnung
- 1.1 Forschungsprojekt zu Arbeitsabläufen und -bedingungen in Redaktionen von Blöbaum, Kutscha, Bonk und Karthaus (2011)
- 1.2 MediaAcT-Studie zur journalistischen Perspektive auf die Media Accountability (2012)
- 2. Forschungslücke
- IV. Methode und Forschungsdesign
- 1. Forschungsfragen
- 2. Methoden
- 2.1 Qualitative Leitfadeninterviews
- 2.1.1 Design des Leitfadens
- 2.1.2 Auswahl der Experten
- 2.2 Qualitative Inhaltsanalyse der Ethik-Kodizes
- 3. Gegenstand der Untersuchung
- 3.1 Hallo Niedersachsen (NDR)
- 3.2 RTL Nord (Niedersachsen und Bremen)
- 3.3 Leute heute (ZDF)
- 3.4 Sat.1 Frühstücksfernsehen
- 3.5 Report Mainz (SWR)
- 4. Durchführung
- 5. Auswertungsstrategie
- 5.1 Auswertung der Leitfadeninterviews
- 5.2 Inhaltsanalyse der Kodizes
- V. Ergebnisse
- 1. Gegenüberstellung der für die Redaktionen gültigen Kodizes
- 1.1 Hallo Niedersachsen
- 1.2 RTL Nord
- 1.3 Leute heute
- 1.4 Sat.1 Frühstücksfernsehen
- 1.5 Report Mainz
- 1.6 Zwischenfazit
- 2. Beantwortung der Forschungsfragen
- 2.1 Welche Rolle spielt der Pressekodex des Deutschen Presserats innerhalb von Fernsehredaktionen?
- 2.2 Welche Rolle spielt der Medienkodex des Netzwerks Recherche innerhalb von Fernsehredaktionen?
- 2.3 Welche Rolle spielen redaktionseigene beziehungsweise unternehmenseigene Kodizes?
- 2.4 Wie werden ethische Normen in der Redaktion etabliert?
- 2.5 Wer diskutiert wann und wie über journalistische Ethik?
- 2.6 Wer überprüft die Einhaltung ethischer Vorgaben und wie geschieht das?
- 2.7 Welche Sanktionsmittel gibt es bei Verstößen gegen die ethischen Normen?
- 2.8 Was passiert, wenn falsche Informationen gesendet wurden?
- 2.9 Ist die Verantwortung in der Redaktion angemessen verteilt?
- 2.10 Gibt es Unterschiede hinsichtlich der Etablierung und Sicherung von ethischen Standards zwischen Redaktionen von öffentlich-rechtlichen und privat-kommerziellen Sendern?
- 2.11 Gibt es Unterschiede hinsichtlich der Etablierung und Sicherung von ethischen Standards zwischen Redaktionen von nachrichtlichen, boulevardesken und investigativen Sendungen?
- 2.12 Braucht die Fernsehberichterstattung einen eigenen, allgemeinen ethischen Kodex?
- 2.13 Sonstige Erkenntnisse
- 3. Fazit
- VI. Kritische Reflexion der Arbeit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ethischen Entscheidungsprozesse in deutschen Fernsehmagazin-Redaktionen und die Mechanismen zur Sicherstellung ethischer Standards. Die Arbeit analysiert, wie das Fehlen eines spezifischen Fernsehkodex kompensiert wird.
- Ethische Entscheidungsfindung in Fernsehredaktionen
- Rolle von Kodizes (Pressekodex, Medienkodex, interne Regelwerke)
- Interne Kontrollmechanismen und Kommunikation
- Verantwortungsverteilung innerhalb der Redaktion
- Der Einfluss externer Kontrollinstanzen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Die Arbeit untersucht, wie deutsche Fernsehmagazin-Redaktionen ethische Entscheidungen treffen und deren Einhaltung gewährleisten, da es keinen direkten Äquivalent zum Pressekodex für den Fernsehbereich gibt. Die Studie kombiniert Leitfadeninterviews mit Redakteuren und Inhaltsanalysen von redaktionsinternen Kodizes.
II. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Journalismusethik dar. Es behandelt die Bedeutung von Ethik für den Erhalt der Pressefreiheit, die Komplexität journalistischen Handelns, die Problematik des Qualitätsverlusts und den Zusammenhang zwischen Ethik und Qualität. Weiterhin werden Besonderheiten der Journalismusethik, Institutionalisierung von Ethik (Regelwerke, Ombudsleute, Presserat), Regulierung beim Fernsehen (öffentlich-rechtlich, privat-kommerziell) und die besondere Relevanz der Ethik im Fernsehen (Leitmedium, Wirkung, Komplexität) untersucht. Abschließend wird auf den Fernsehjournalistischen Alltag und die Auswirkungen auf die Ethik (Produktionsschritte, aktuelle Entwicklungen) und die Möglichkeiten zur erfolgreichen Etablierung von Fernseh-Journalismusethik (Verantwortungsverteilung, Regelwerke, Kontrolle, Chancen des Internets, Sensibilisierung) eingegangen.
III. Positionierung des Themas in der Forschungslandschaft: Dieses Kapitel ordnet das Thema in die bestehende Forschungslandschaft ein und beschreibt die Forschungslücke, die die Arbeit zu schließen versucht. Es werden relevante Studien zu Arbeitsabläufen in Redaktionen und zur journalistischen Perspektive auf Media Accountability genannt und analysiert.
Schlüsselwörter
Fernsehethik, Journalismusethik, Pressekodex, Medienkodex, Redaktionsstrukturen, Media Accountability, Selbstkontrolle, Verantwortungsverteilung, Qualitätsjournalismus, Leitfadeninterview, Qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Ethische Entscheidungsprozesse in deutschen Fernsehmagazin-Redaktionen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ethischen Entscheidungsprozesse in deutschen Fernsehmagazin-Redaktionen und die Mechanismen zur Sicherstellung ethischer Standards. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kompensation des Fehlens eines spezifischen Fernsehkodex.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Ethische Entscheidungsfindung in Fernsehredaktionen, die Rolle von Kodizes (Pressekodex, Medienkodex, interne Regelwerke), interne Kontrollmechanismen und Kommunikation, Verantwortungsverteilung innerhalb der Redaktion und den Einfluss externer Kontrollinstanzen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie kombiniert qualitative Leitfadeninterviews mit Redakteuren verschiedener Fernsehsendungen und qualitative Inhaltsanalysen von redaktionsinternen Kodizes.
Welche Redaktionen wurden untersucht?
Die Untersuchung umfasst die Redaktionen von „Hallo Niedersachsen“ (NDR), RTL Nord (Niedersachsen und Bremen), „Leute heute“ (ZDF), Sat.1 Frühstücksfernsehen und „Report Mainz“ (SWR).
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit beantwortet unter anderem folgende Forschungsfragen: Welche Rolle spielen der Pressekodex und der Medienkodex in Fernsehredaktionen? Welche Rolle spielen redaktionseigene Kodizes? Wie werden ethische Normen etabliert und kontrolliert? Gibt es Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen und privat-kommerziellen Sendern oder zwischen verschiedenen Sendungstypen (nachrichtenorientiert, Boulevard, investigativ)? Braucht die Fernsehberichterstattung einen eigenen ethischen Kodex?
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die theoretischen Grundlagen der Journalismusethik, einschließlich der Bedeutung von Ethik für den Erhalt der Pressefreiheit, der Komplexität journalistischen Handelns, der Problematik des Qualitätsverlusts und des Zusammenhangs zwischen Ethik und Qualität. Sie beleuchtet Besonderheiten der Journalismusethik, die Institutionalisierung von Ethik (Regelwerke, Ombudsleute, Presserat), die Regulierung im Fernsehen und die besondere Relevanz der Ethik im Fernsehen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einführung, Theoretische Grundlagen, Positionierung des Themas in der Forschungslandschaft, Methode und Forschungsdesign, Ergebnisse und kritische Reflexion der Arbeit und Ausblick. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fernsehethik, Journalismusethik, Pressekodex, Medienkodex, Redaktionsstrukturen, Media Accountability, Selbstkontrolle, Verantwortungsverteilung, Qualitätsjournalismus, Leitfadeninterview, Qualitative Inhaltsanalyse.
Welche Forschungslücke wird geschlossen?
Die Arbeit schließt eine Forschungslücke in der Untersuchung der ethischen Entscheidungsfindung und der Sicherung ethischer Standards in deutschen Fernsehmagazin-Redaktionen, insbesondere im Hinblick auf das Fehlen eines spezifischen Fernsehkodex.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen einen Vergleich der für die untersuchten Redaktionen gültigen Kodizes, die Beantwortung der Forschungsfragen und ein Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
- Quote paper
- Franziska Ehrenfeld (Author), 2018, Kein Kodex – keine Ethik? Wie ethische Werte in journalistischen Fernsehmagazin-Redaktionen etabliert und gesichert werden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449025