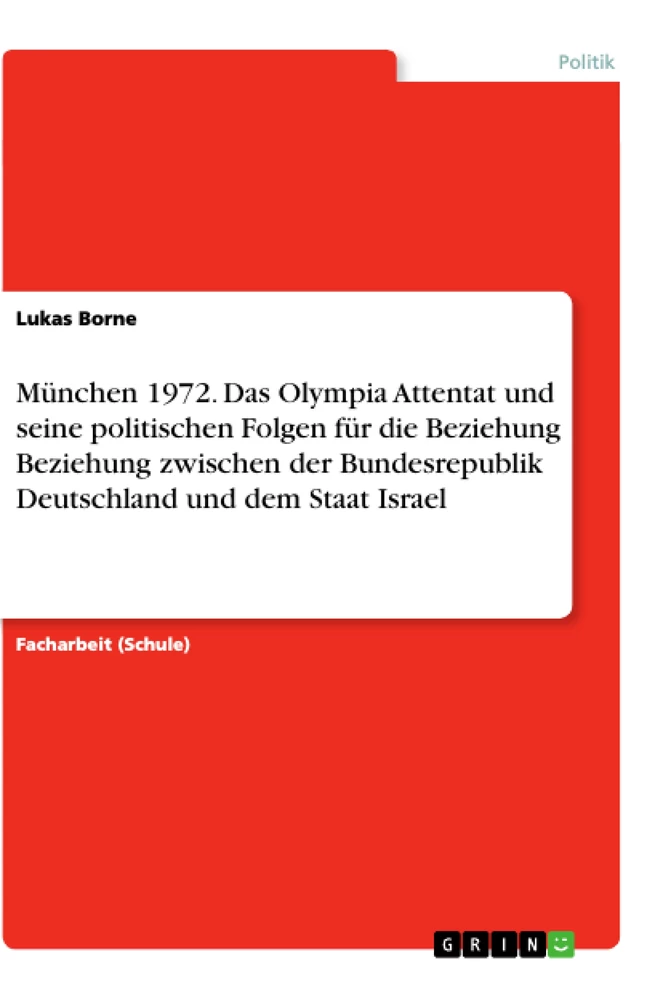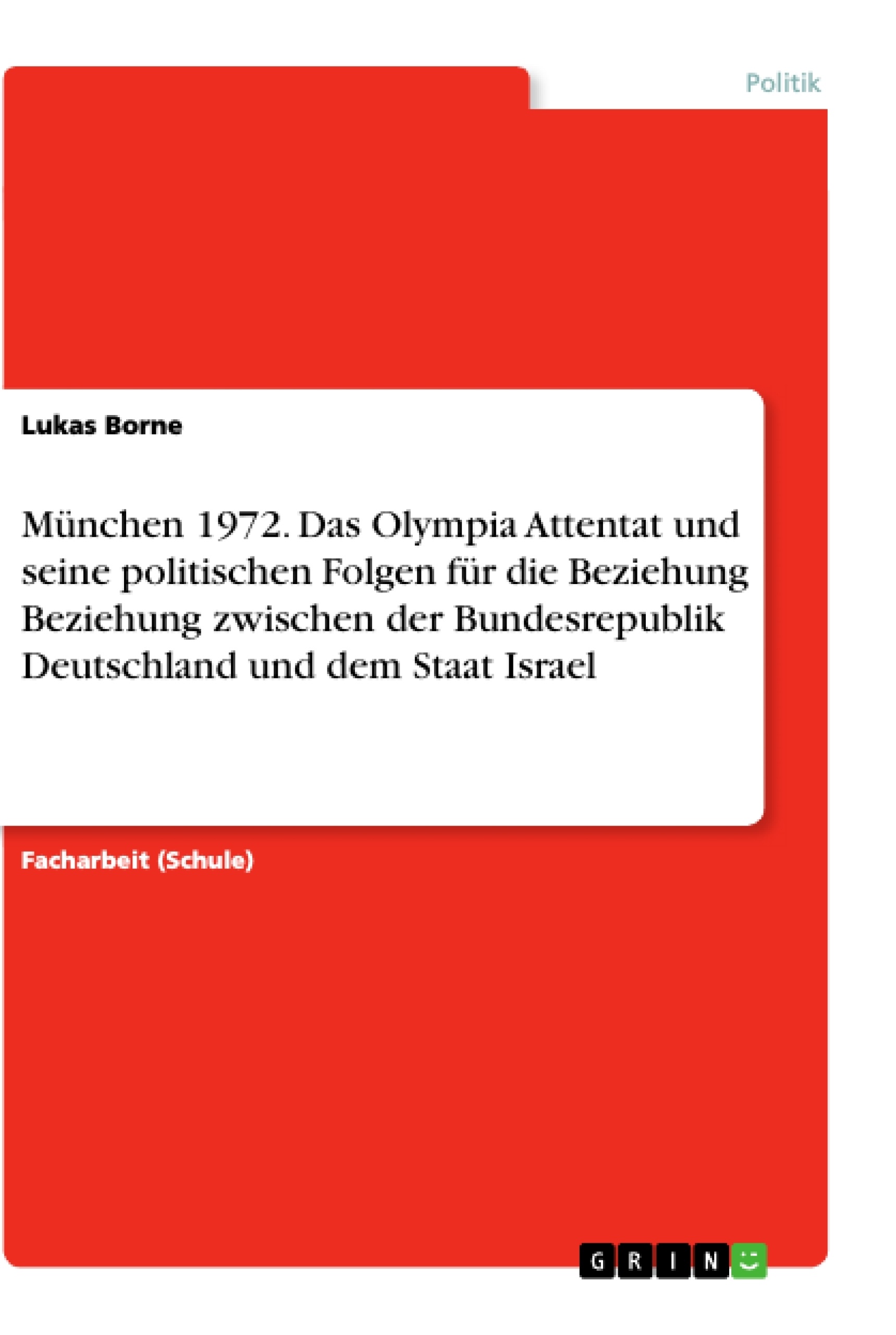Gerade durch Anschläge bekommt Sport politische Bedeutung und wird immer häufiger als politisches Druckmittel benutzt. Im Gegensatz zu seinem Ursprungsgedanken, der Völkerverständigung und dem Zusammenhalt der Gesellschaft, ist der Sport der Neuzeit nunmehr auch als ein Teil der Politik zu sehen.
Insbesondere die Olympischen Spiele wurden schon früh als Plattform für ideologische Angelegenheiten genutzt: Von den Propaganda-Spielen 1936 in Berlin über die „Black Power“ Demonstration 1968 in Mexico City, bis hin zur Geiselnahme israelischer Olympia-Teilnehmer am 5. September 1972. An diesem Tag nutzte die Terrorgruppe „Schwarzer September“ während der „heiteren Spiele“ in München die große Bühne Olympischer Spiele und der Terror hielt Einzug in die Welt des Sports. Dass diese Vorkommnisse die politischen Beziehungen betroffener Staaten strapazieren würden, war garantiert.
Nachdem der Ablauf der Geiselnahme vom 5. September 1972 kurz aufgearbeitet und dabei auch kritisch auf die Rolle der Sicherheitskräfte sowie der Medien eingegangen wird, wird hauptsächlich aufgezeigt, welche Auswirkungen dieses Attentat auf die Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Staat Israel und den arabischen Staaten hatte. Zudem wird auf die, aus dem Ereignis resultierende, Innen- und Sicherheitspolitik Deutschlands eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Der 13. November 2015 in Paris
- München 1972 - Die politischen Folgen des Olympia-Attentats
- Der Ablauf des Attentats
- Die unmittelbare Reaktion des Staates
- Die Rolle der Medien
- Die langfristigen Folgen und Lehren
- Folgen für darauffolgende sportliche Großereignisse
- Politische Beziehungen zwischen BRD, Israel und den arabischen Staaten
- Innen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland
- Künstlerische Rezeption des Attentats
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politischen Folgen von zwei bedeutenden terroristischen Anschlägen: den Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris und dem Olympia-Attentat von München 1972. Ziel ist es, die unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Politik, die internationalen Beziehungen und die Sicherheitsarchitektur zu analysieren.
- Die Instrumentalisierung von Sportveranstaltungen durch Terrorismus
- Die Reaktion von Staaten auf terroristische Anschläge
- Die Rolle der Medien bei der Berichterstattung über Terrorismus
- Die langfristigen Folgen von Terrorismus für die Sicherheitspolitik
- Die Auswirkungen terroristischer Anschläge auf internationale Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Der 13. November 2015 in Paris: Der Text beschreibt den Terroranschlag vom 13. November 2015 in Paris während eines Fußballspiels im Stade de France. Er hebt die politische Dimension des Sports hervor, der nicht nur Völkerverständigung, sondern auch als Ziel für terroristische Akte dienen kann. Der Anschlag wird als Beispiel für die zunehmende Instrumentalisierung von Großveranstaltungen durch Terroristen angeführt, die auf maximale mediale Aufmerksamkeit abzielen. Die Ereignisse dieses Tages werden kurz skizziert, wobei auf die Anschläge im Bataclan-Theater und anderen Cafés verwiesen wird. Der Text betont den Kontrast zwischen dem ursprünglichen friedlichen Charakter des Sports und seiner zunehmenden Nutzung als politisches Druckmittel.
München 1972 - Die politischen Folgen des Olympia-Attentats: Dieses Kapitel analysiert das Olympia-Attentat von München 1972. Es beginnt mit einer detaillierten Beschreibung des Ablaufs der Geiselnahme durch die palästinensische Terrorgruppe „Schwarzer September“. Der Text beleuchtet die unzureichende Reaktion der deutschen Behörden, die mangelnde Vorbereitung der Sicherheitskräfte und die widersprüchlichen Aussagen der Verantwortlichen. Die Folgen des Attentats für die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel sowie die Auswirkungen auf die deutsche Innen- und Sicherheitspolitik werden angedeutet, wobei die ungenügende Koordination und Kommunikation der Sicherheitskräfte sowie die letztendliche Freilassung der Täter kritisch betrachtet werden. Die mangelnde Vorbereitung der Sicherheitskräfte und die fehlende Koordination zwischen den Behörden werden als entscheidende Faktoren für das Scheitern der Befreiungsaktion dargestellt. Die Tragödie wird als Wendepunkt in der Sicherheitspolitik Deutschlands dargestellt.
Schlüsselwörter
Terrorismus, Olympia-Attentat München 1972, Anschläge Paris 2015, Sicherheitspolitik, Internationale Beziehungen, Sport, Medien, Reaktion des Staates, „Schwarzer September“, Palästinensischer Terrorismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Politische Folgen von Terroranschlägen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die politischen Folgen zweier bedeutender terroristischer Anschläge: der Anschläge vom 13. November 2015 in Paris und des Olympia-Attentats von München 1972. Analysiert werden die unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen auf Politik, internationale Beziehungen und Sicherheitsarchitektur.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Instrumentalisierung von Sportveranstaltungen durch Terrorismus, der Reaktion von Staaten auf Anschläge, der Rolle der Medien, den langfristigen Folgen für die Sicherheitspolitik und den Auswirkungen auf internationale Beziehungen. Im Einzelnen werden der Ablauf der Anschläge, die staatliche Reaktion, die Medienberichterstattung und die langfristigen Folgen für die Sicherheitspolitik und die internationalen Beziehungen untersucht.
Wie wird der Anschlag von Paris 2015 dargestellt?
Der Text beschreibt den Anschlag vom 13. November 2015 in Paris, insbesondere im Kontext eines Fußballspiels im Stade de France. Er hebt die politische Dimension des Sports hervor, der sowohl Völkerverständigung als auch Ziel terroristischer Akte sein kann. Der Anschlag wird als Beispiel für die zunehmende Instrumentalisierung von Großveranstaltungen mit dem Ziel maximaler medialer Aufmerksamkeit dargestellt. Die Anschläge im Bataclan und anderen Cafés werden erwähnt.
Wie wird das Olympia-Attentat von München 1972 behandelt?
Das Kapitel analysiert das Olympia-Attentat von 1972 detailliert, beginnend mit dem Ablauf der Geiselnahme durch die palästinensische Terrorgruppe „Schwarzer September“. Die unzureichende Reaktion der deutschen Behörden, die mangelnde Vorbereitung der Sicherheitskräfte und widersprüchliche Aussagen werden kritisiert. Die Folgen für die Beziehungen zwischen der BRD und Israel sowie die Auswirkungen auf die deutsche Innen- und Sicherheitspolitik werden beleuchtet, wobei die ungenügende Koordination und Kommunikation der Sicherheitskräfte und die Freilassung der Täter im Mittelpunkt stehen. Die mangelnde Vorbereitung und Koordination werden als entscheidende Faktoren für das Scheitern der Befreiungsaktion und als Wendepunkt in der deutschen Sicherheitspolitik dargestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Terrorismus, Olympia-Attentat München 1972, Anschläge Paris 2015, Sicherheitspolitik, Internationale Beziehungen, Sport, Medien, Reaktion des Staates, „Schwarzer September“, Palästinensischer Terrorismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu den Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris und den politischen Folgen des Olympia-Attentats von München 1972, einschließlich einer detaillierten Analyse des Ablaufs, der unmittelbaren Reaktionen, der Rolle der Medien und der langfristigen Folgen. Ein weiteres Kapitel widmet sich der künstlerischen Rezeption der Attentate.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist die Analyse der unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen der Anschläge auf Politik, internationale Beziehungen und die Sicherheitsarchitektur. Es soll ein umfassendes Bild der politischen Folgen von Terrorismus anhand dieser beiden Fallstudien vermittelt werden.
- Quote paper
- Lukas Borne (Author), 2016, München 1972. Das Olympia Attentat und seine politischen Folgen für die Beziehung Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448436