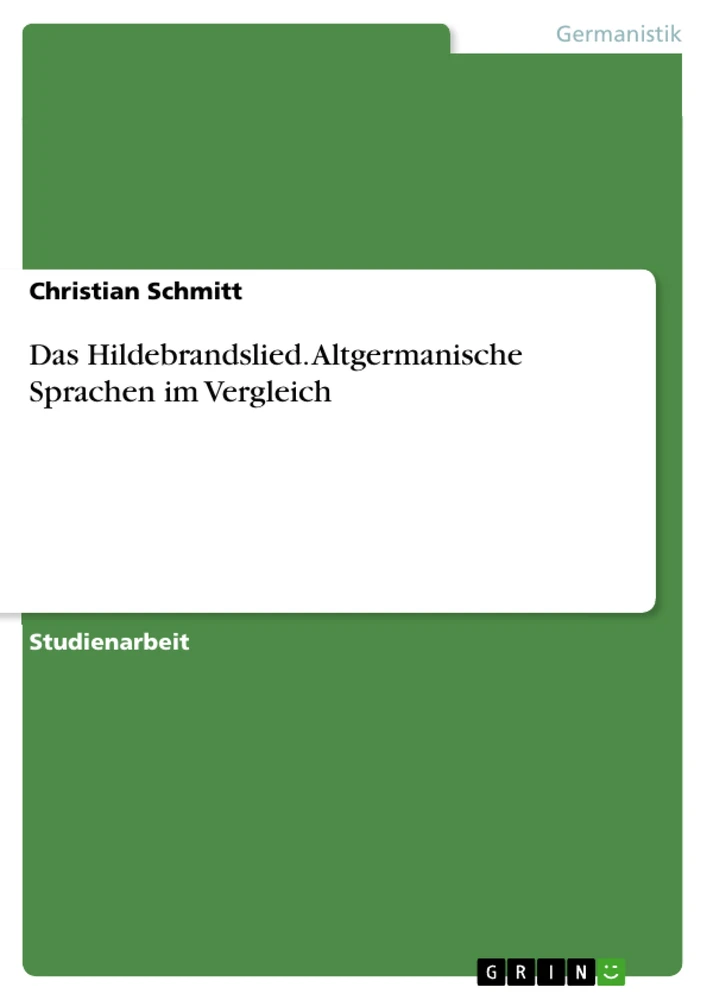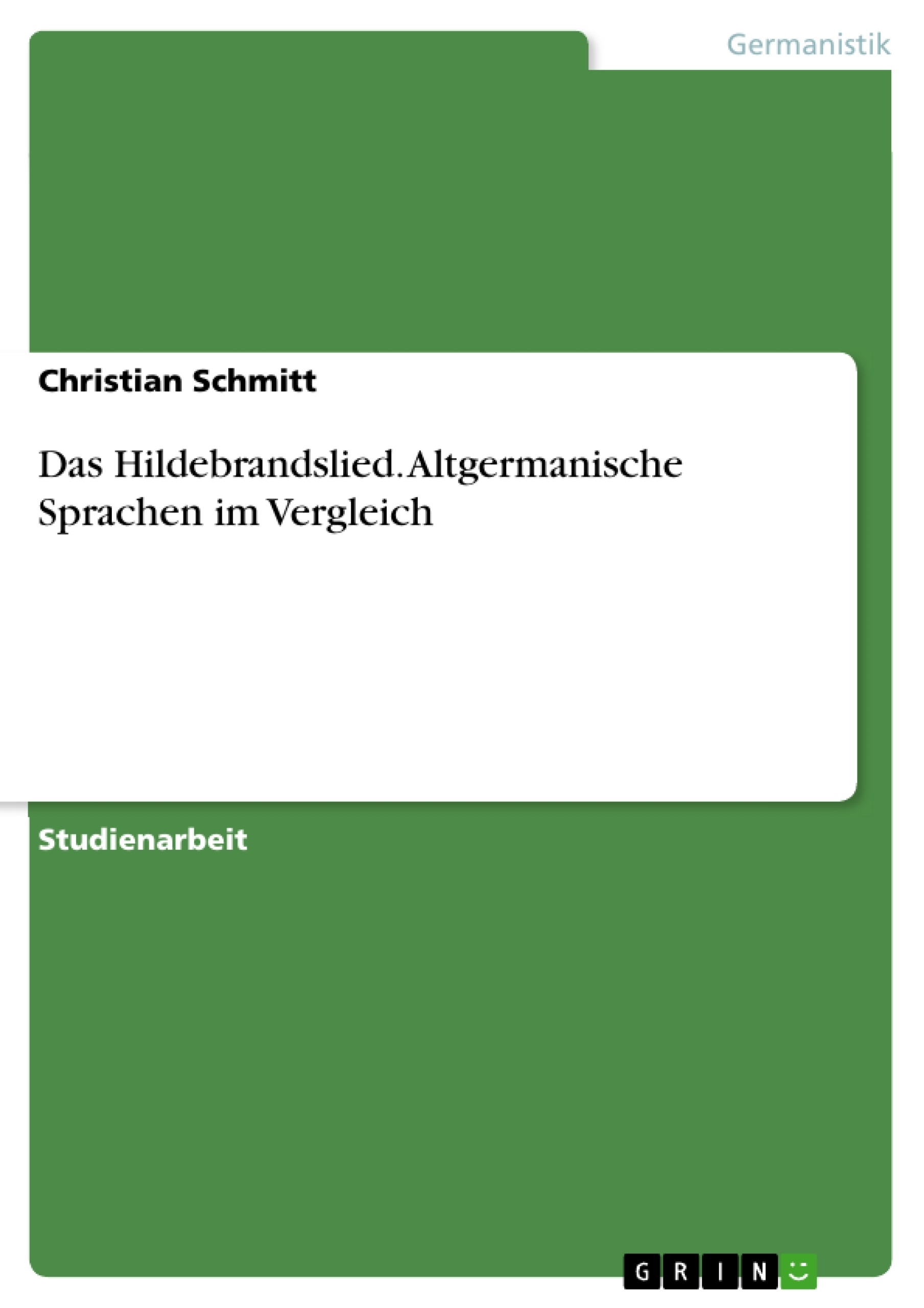Das Hildebrandslied ist die älteste, in althochdeutscher Sprache verfasste, Heldendichtung. Es handelt sich um ein, in kurzer Liedform gestaltetes, Fragment. Ebenso gilt es als das „ältesterhaltene, kennzeichnendste und edelste Stück der völkerwanderungszeitlichen Hochform“, ist in einer Mischung von Hoch- und Niederdeutsch geschrieben und ist das einzige deutsche Heldenlied, da das „Nibelungenlied“, in welchem mehrere ursprünglich getrennte Sagenkreise zu einem großen Werk zusammengeführt wurden, als Epos gilt. Im Rahmen meines Germanistikstudiums habe ich mich bereits umfassend im Bereich der Mediävistik mit der mittelhochdeutschen Sprache und Textpassagen aus dem Nibelungenlied befasst. Anhand dieser Seminararbeit werde ich mich nun erstmals auch der althochdeutschen Sprache zuwenden.
Da der Titel des Seminars „Altgermanische Sprachen im Vergleich“ lautet und der Schwerpunkt des Seminars auf der Betrachtung verschiedener Dialekte und die Entwicklung der deutschen Sprache beruht, werde ich zunächst die Merkmale der „althochdeutschen Sprache“ kurz erläutern und anschließend, die Verortung des Hildebrandliedes sowohl geschichtlich, als auch im Gesamtkontext der Heldensagen, betrachten. Der Hauptteil dieser Arbeit ist eine kommentierte Übersetzung einer Passage des Hildebrandliedes.
Diese Kommentare beziehen sich dabei auf die Wortherkunft, die neuhochdeutschen Entsprechungen der einzelnen Wörter und eventuelle sprachliche und geschichtliche Gegebenheiten, wie Anlehnungen an die englische Sprache, die auch heute noch nachvollziehbar sind. Ein Auszug der Textgrundlage, auf welche ich mich dabei beziehe, ist im Anhang beigefügt. Wichtig festzuhalten ist, dass hierbei keine neuen Erklärungen für unterschiedliche Interpretationsansätze erläutert werden sollen, sondern viel mehr eine Wort-für-Wort-Interpretation der am besten zutreffendsten Wortherkunft kommentiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Althochdeutsche
- Das Hildebrandslied
- Allgemeine Informationen
- Kontext der Heldensagen
- Textpassage und Übersetzung
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Hildebrandslied, der ältesten erhaltenen Heldendichtung in althochdeutscher Sprache. Ziel ist es, die althochdeutsche Sprache anhand des Hildebrandliedes zu untersuchen und dessen Platz im Kontext der Heldensagen zu beleuchten. Darüber hinaus wird eine Passage aus dem Hildebrandslied übersetzt und kommentiert, um die sprachlichen Besonderheiten und historischen Bezüge des Textes zu erläutern.
- Die althochdeutsche Sprache und ihre Merkmale
- Das Hildebrandslied als Beispiel der Heldendichtung
- Die Rolle des Vater-Sohn-Konflikts in der Heldendichtung
- Sprachliche und historische Bezüge des Hildebrandliedes
- Interpretation der ausgewählten Textpassage
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Hildebrandslied als älteste althochdeutsche Heldendichtung vor und erläutert die Motivation der Arbeit. Das zweite Kapitel behandelt die althochdeutsche Sprache, ihre historischen Einordnung und Unterschiede zu anderen westgermanischen Sprachen.
Das dritte Kapitel beleuchtet das Hildebrandslied im Kontext der Heldendichtung. Es werden allgemeine Informationen zum Text und die typischen Merkmale der Heldensagen, wie Konflikte, Heldenmotivation und Handlungsstruktur, vorgestellt.
Das vierte Kapitel widmet sich einer kommentierten Übersetzung einer Textpassage aus dem Hildebrandslied. Die Übersetzung wird durch sprachliche und historische Kommentare bereichert, die die Wortherkunft, neuhochdeutsche Entsprechungen und mögliche Bezüge zu anderen Sprachen beleuchten.
Schlüsselwörter
Althochdeutsch, Hildebrandslied, Heldendichtung, Vater-Sohn-Konflikt, Stabreimdichtung, Sprachentwicklung, Sprachvergleich, Textinterpretation, Übersetzung.
- Quote paper
- Christian Schmitt (Author), 2016, Das Hildebrandslied. Altgermanische Sprachen im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448193