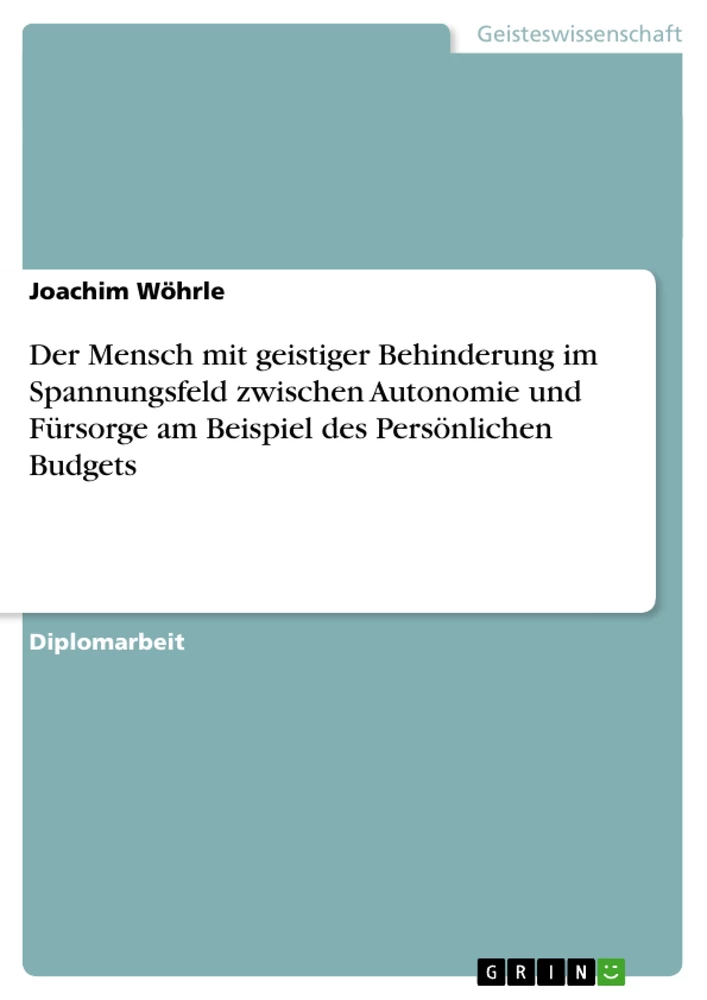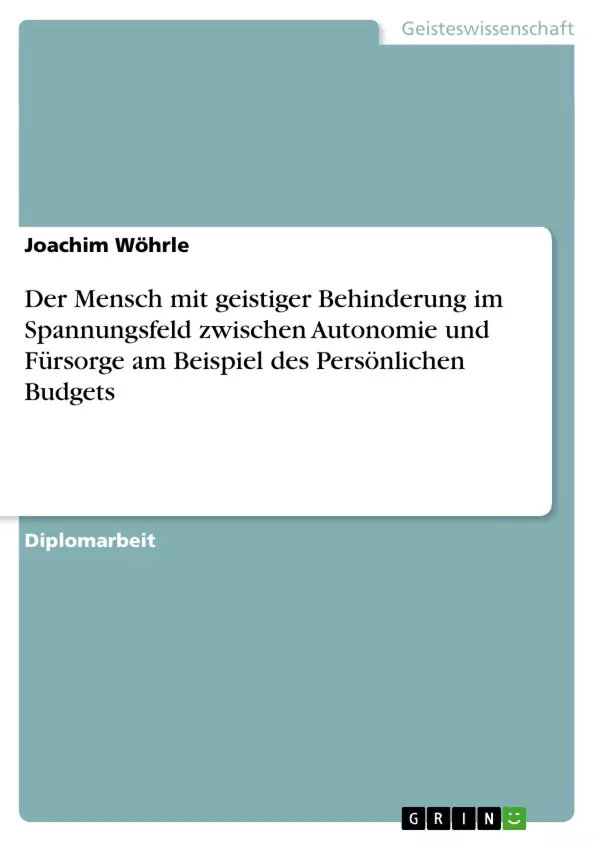In der Umbenennung der „Aktion Sorgenkind“ zur „Aktion Mensch“ spiegelte sich im Jahr 2000 exemplarisch eine sich seit Jahrzehnten vollziehende Veränderung der Sicht auf Menschen mit Behinderung. Das Sorgen um und Versorgen von Personen, die als hilflos und abhängig angesehen wurden, steht nicht mehr allein im Zentrum der Arbeit mit und für behinderte Menschen. Neue Gedanken in der Arbeit professionell Helfender, Engagement der Eltern behinderter Kinder und emanzipatorische Bewegungen der Betroffenen selbst haben spätestens seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts das Bild von Behinderung in der Gesellschaft entscheidend beeinflusst.
Waren behinderte Menschen bis nach dem 2. Weltkrieg durchweg Objekte einer Behandlung durch die Nichtbehinderten, die sie nicht selten zu Opfern der jeweils herrschenden Gesellschaftsordnung gemacht hatte, so scheint sich ihre soziale Stellung inzwischen enorm verbessert zu haben.
Der Begriff der Selbstbestimmung hat sich von der Forderung einer behinderten Minderheit zu einem Hauptanliegen in der Sozialpolitik gewandelt, und das Streben nach Autonomie ersetzt mehr und mehr die Fürsorge als Leitbild in der Behindertenarbeit.
Besonders im Bezug auf Menschen mit einer geistigen Behinderung werden jedoch auch immer wieder (und vielleicht nicht völlig unberechtigt) Zweifel an ihrer Fähigkeit, ein selbständiges Leben zu organisieren, angemeldet.
- Hat das zur Folge, dass geistig behinderte Menschen für immer der Fürsorge bedürfen und deshalb nie die viel beschworene Autonomie erreichen können?
- Sind Autonomie und Fürsorge tatsächlich zwei sich gegenseitig ausschließende Begriffe?
- Ist Autonomie das, was Menschen mit geistiger Behinderung tatsächlich anstreben?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I - Grundlegende Betrachtungen
- 1. Begriff und Ursachen der geistigen Behinderung
- 1.1 Die Definition der WHO
- 1.2 Die Definition im deutschen Gesetz
- 1.3 Die Beschreibung von Interessenvertretern
- 1.4 Herkunft des Begriffes
- 2. Ursachen geistiger Behinderung
- 2.1 Was ist Fürsorge?
- 2.2 Geschichtlicher Hintergrund
- 2.2.1 Antike und Mittelalter
- 2.2.2 Reformation und beginnende Neuzeit
- 2.2.3 Absolutismus und Aufklärung
- 2.2.4 Das 19. Jahrhundert
- 2.2.5 Das 20. Jahrhundert bis Kriegsende
- 2.2.6 Die Zeit nach 1945
- 2.2.7 Der Aufbruch von der Fürsorge in die Selbstbestimmung
- 3. Der Begriff der Autonomie
- 3.1 Definition
- 3.2 Autonomie und Selbstbestimmt Leben
- 3.3 Autonomie und geistige Behinderung
- 4. Wandel der Paradigmen
- 4.1 Was sind Paradigmen
- 4.2 Veränderung der Paradigmen
- 4.3 Paradigmenwandel bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 5. Die Idee des Persönlichen Budgets
- 5.1 Die Ausgangssituation
- 5.2 Von der Persönlichen Assistenz...
- 5.2.1 Was ist Persönliche Assistenz
- 5.2.2 Entscheidungsfelder des Assistenznehmers
- 5.2.3 Persönliche Assistenz nach dem SGB IX
- 5.2.4 Persönliche Assistenz nach dem SGB XI
- 5.2.5 Persönliche Assistenz nach dem SGB XII
- 5.2.6 Bewertung des Modells
- 5.3 ...zum Persönlichen Budget
- 6. Verankerung des Persönlichen Budgets im deutschen Recht
- 6.1 Rechtliche Grundlagen
- 6.2 Wer sind die Leistungsträger?
- 6.3 Das Verfahren der Antragstellung
- 6.4 Wer kann Budgetnehmer sein?
- 6.5 Welche Leistungen gehören zum Persönlichen Budget?
- 7. Das Pflegebudget nach dem SGB XI
- 7.1 Gründe für die Einrichtung des Modells
- 7.2 Ziele des Pflegebudgets
- 7.3 Beschreibung des Modellprojektes
- Teil II - Die Umsetzung des Persönlichen Budgets
- 8. Das Persönliche Budget im europäischen Ausland
- 8.1 Das Personengebundene Budget in den Niederlanden
- 8.2 Direct Payments in Großbritannien
- 8.3 Persönliche Assistenz in Schweden
- 9. Das Persönliche Budget in Deutschland
- 9.1 Verschiedene Modellvorhaben in Deutschland
- 9.1.1 Das Rheinland-Pfälzische Modellprojekt
- a) Vorbemerkungen zum Modellversuch
- b) Zulassungsvoraussetzungen
- c) Gestaltung der Leistungserbringung
- d) Verfahren der Antragstellung
- e) Angaben zum Personenkreis
- f) Ergebnisse der Begleitstudie
- 9.1.2 Das trägerübergreifende Budget in Baden-Württemberg
- a) Vorbemerkungen zum Modellversuch
- b) Zulassungsvoraussetzungen
- c) Gestaltung der Leistungserbringung
- d) Verfahren der Antragstellung
- e) Angaben zum Personenkreis
- f) Ergebnisse der Begleitstudie
- Teil III - Resümee
- 10. Zusammenfassung
- 11. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Situation von Menschen mit geistiger Behinderung im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge. Sie untersucht, wie sich die gesellschaftliche Sichtweise auf Menschen mit Behinderung im Laufe der Zeit gewandelt hat und welche Herausforderungen sich im Kontext der Selbstbestimmung und des Strebens nach Autonomie ergeben.
- Entwicklung des Begriffs der geistigen Behinderung und seiner Ursachen
- Historische Betrachtung der Fürsorge und ihre Auswirkungen auf Menschen mit geistiger Behinderung
- Definition und Bedeutung von Autonomie im Zusammenhang mit geistiger Behinderung
- Paradigmenwechsel in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung
- Das Persönliche Budget als Instrument zur Förderung von Selbstbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Wandel in der Sichtweise auf Menschen mit Behinderung dar und hebt die Bedeutung von Selbstbestimmung und Autonomie hervor.
- Kapitel 1: Begriff und Ursachen der geistigen Behinderung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der geistigen Behinderung anhand verschiedener Perspektiven, darunter die Definition der WHO, das deutsche Gesetz und die Beschreibung von Interessenvertretern. Es beleuchtet außerdem die Herkunft des Begriffs und die verschiedenen Definitionen im Laufe der Geschichte.
- Kapitel 2: Ursachen geistiger Behinderung: Hier wird der Begriff der Fürsorge erläutert und der historische Hintergrund der Behandlung von Menschen mit geistiger Behinderung beleuchtet. Die Kapitel behandelt die Entwicklung der Fürsorge von der Antike bis zur Neuzeit und zeigt die Veränderungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung.
- Kapitel 3: Der Begriff der Autonomie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Autonomie und setzt ihn in Beziehung zum Selbstbestimmten Leben. Der Fokus liegt auf der Anwendung des Autonomiebegriffs im Zusammenhang mit Menschen mit geistiger Behinderung.
- Kapitel 4: Wandel der Paradigmen: Der Wandel der Paradigmen in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung wird analysiert. Das Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Paradigmen und zeigt, wie sich die Herangehensweise an die Behinderung im Laufe der Zeit verändert hat.
- Kapitel 5: Die Idee des Persönlichen Budgets: Dieses Kapitel stellt die Idee des Persönlichen Budgets vor und erklärt die Ausgangssituation, die zu seiner Entstehung führte. Es beleuchtet die Vorteile und Herausforderungen der Persönlichen Assistenz und zeigt, wie das Persönliche Budget als Alternative oder Ergänzung dienen kann.
- Kapitel 6: Verankerung des Persönlichen Budgets im deutschen Recht: Die rechtlichen Grundlagen des Persönlichen Budgets in Deutschland werden beleuchtet. Das Kapitel behandelt die Leistungsträger, das Verfahren der Antragstellung und die Voraussetzungen für die Budgetvergabe.
- Kapitel 7: Das Pflegebudget nach dem SGB XI: Dieses Kapitel behandelt das Pflegebudget, ein ähnliches Modell wie das Persönliche Budget im Bereich der Pflege. Es untersucht die Gründe für die Einrichtung des Modells, seine Ziele und die konkrete Umsetzung.
- Kapitel 8: Das Persönliche Budget im europäischen Ausland: Dieses Kapitel stellt verschiedene Modelle des Persönlichen Budgets im europäischen Ausland vor, wie beispielsweise das Personengebundene Budget in den Niederlanden, Direct Payments in Großbritannien und die Persönliche Assistenz in Schweden.
- Kapitel 9: Das Persönliche Budget in Deutschland: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Modellprojekte des Persönlichen Budgets in Deutschland, darunter das Rheinland-Pfälzische Modellprojekt und das trägerübergreifende Budget in Baden-Württemberg. Es analysiert die jeweiligen Konzepte, die Ergebnisse der Begleitstudien und die Erfahrungen aus der Praxis.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Diplomarbeit sind geistige Behinderung, Autonomie, Fürsorge, Selbstbestimmung, Persönliches Budget, Paradigmenwandel, Modellprojekte, Integration, Inklusion und sozialpädagogische Begleitung.
- Quote paper
- Joachim Wöhrle (Author), 2005, Der Mensch mit geistiger Behinderung im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge am Beispiel des Persönlichen Budgets, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44677