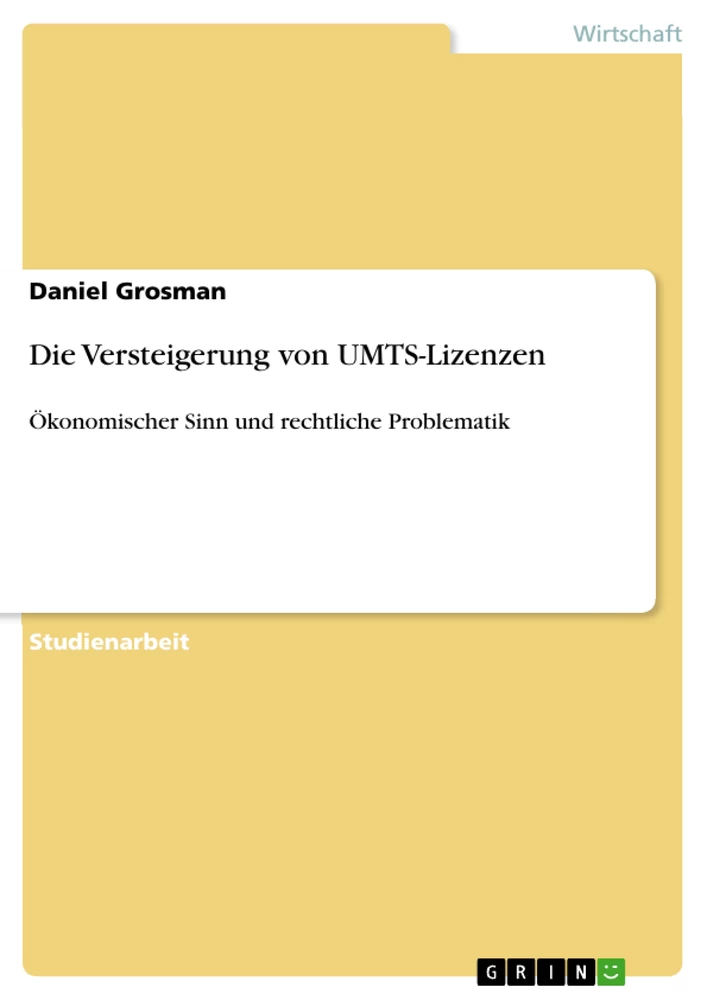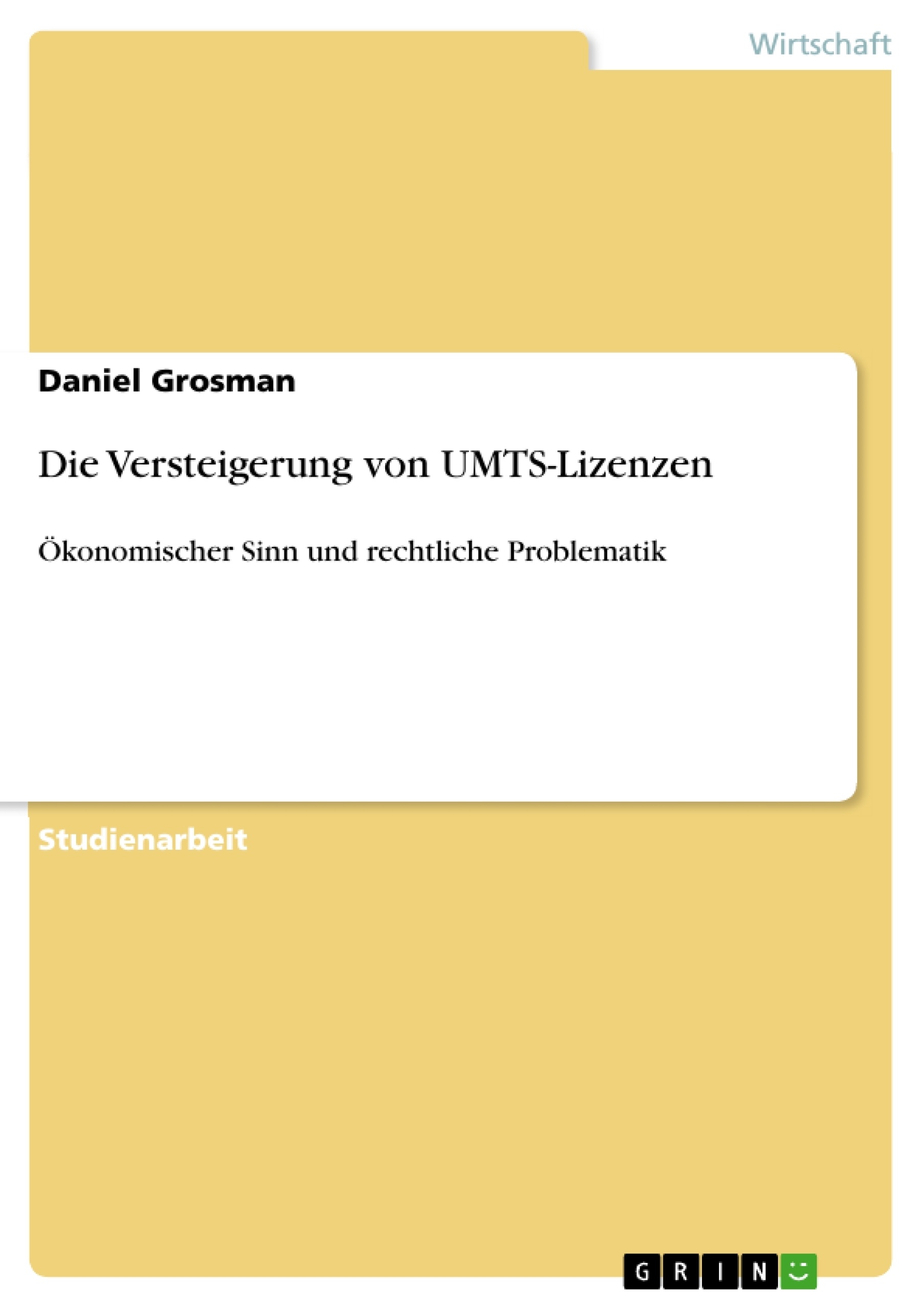„Das Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) wird im nächsten Jahrzehnt die bestehenden digitalen Mobilfunknetze der zweiten Generation zunächst ergänzen und später ablösen.“1 Diese und ähnliche Einschätzungen des Telekommunikationsmarktes vor der – zumindest aus fiskalischer Sicht – wohl erfolgreichsten, durch die Bundesrepublik durchgeführten Frequenzversteigerung führten dazu , dass die Presseagenturen am 17.08.2000, 15.51 Uhr das Ende der wohl teuersten Lizenzversteigerung in der Geschichte der Telekommunikation bekannt geben konnten. Nach 2½ Wochen, 173 Versteigerungsrunden und dem Einsatz von 98.807.200.000 DM ersteigern sechs Bieter jeweils eine „kleine Lizenz“.2,3
Die für den Mobilfunk der dritten Generation zur Übertragung von Informationen nutzbaren Frequenzbereiche sind im Äther jedoch nur begrenzt vorhanden. Daher müssen Systeme gefunden werden, die eine besonders effiziente Nutzung der vorhandenen (Frequenz-) Ressourcen durch die Lizenznehmer garantieren. Die Aufgabe der Allokation entsprechend zur Verfügung stehender Frequenzen bzw. Frequenzbereiche liegt beim Staat, der diese Aufgabe in Deutschland über die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) wahrnimmt. Dabei stehen ihm mehrere, gesetzlich verankerte Verteilungsalternativen zur Verfügung, deren im Bereich von Frequenzversteigerungen wichtigste - die Auktion - Inhalt dieser rechtlichen Betrachtung sein wird. Auktionen4 sind einer von mehreren marktwirtschaftlichen Allokationsmechanismen, die auf der Basis wohldefinierter Regeln eine erfolgreiche und effiziente Verteilung knapper Güter erreichen können. Dabei lassen sich erste Auktionen schon zur Zeit des römischen Reiches finden, das bereits vor über zweitausend Jahren durch die Prätorianergarde ve rsteigert wurde, auch wenn sich der damalige Ersteigerer Didius Julianus nur eine kurze Zeit als Kaiser halten konnte. 5 Im vergangenen Jahrhundert waren Auktionen verstärkt Mittelpunkt rechtlich und ökonomisch wissenschaftlicher Betrachtungen, wobei immer wieder neue Auktionsverfahren entwickelt wurden, um die Effizienz dieser Allokationsform durch geänderte und optimiertere Regeln weiter zu steigern. Diese Arbeit beschäftigt sich am Beispiel der Versteigerung der UMTS-Frequenzen im Jahre 2000 mit den rechtlichen Voraussetzungen von Auktionen und einigen wesentlichen Konflikten, die aus dem Einsatz dieses Allokationsmechanismus entstehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechtliche Grundlagen
- Europarechliche Vorgaben
- Nationale Vorgaben in Deutschland
- Der ökonomische Aspekt von Frequenzversteigerungen
- Sicherstellung der Effizienz
- Versteigerungserlöse
- Zwischenergebnis
- Juristische Betrachtung der Frequenzversteigerungen
- Verfassungsrechtliche Betrachtung der Frequenzversteigerungen
- Lizenzierung contra Art. 12 Abs. I i.V.m. 19 Abs. III GG
- Verfassungskonformität der Versteigerung als Allokationsform
- Versteigerungen im Lichte des europäischen Gemeinschaftsrechts
- Vereinbarkeit mit primärem Gemeinschaftsrecht
- Konformität mit sekundärem Gemeinschaftsrecht
- Zwischenergebnis
- Alternativen zur Versteigerung nach Vorbild der UMTS-Auktion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Versteigerung von Mobilfunklizenzen, insbesondere im Kontext der UMTS-Versteigerung in Deutschland. Ziel ist es, den ökonomischen Sinn und die rechtliche Problematik dieser Form der Frequenzallokation zu beleuchten. Dabei werden sowohl die europarechtlichen als auch die nationalen Vorgaben in Deutschland berücksichtigt.
- Ökonomische Aspekte der Frequenzversteigerung
- Rechtliche Grundlagen der Frequenzversteigerung
- Verfassungskonformität der Versteigerung
- Europäisches Gemeinschaftsrecht und Frequenzversteigerungen
- Alternativen zur Versteigerung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz der Frequenzversteigerung im Kontext der UMTS-Lizenzierung in Deutschland heraus. Es wird die Notwendigkeit eines effizienten Allokationsmechanismus für knappe Frequenzressourcen hervorgehoben.
- Rechtliche Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die europarechtlichen und nationalen Vorgaben, die für die Versteigerung von Mobilfunklizenzen relevant sind. Dabei werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Allokation von Frequenzen im Allgemeinen und die UMTS-Lizenzierung im Besonderen beleuchtet.
- Der ökonomische Aspekt von Frequenzversteigerungen: In diesem Abschnitt werden die ökonomischen Vorteile von Frequenzversteigerungen im Hinblick auf die Effizienzsteigerung und die Generierung von Erlösen für den Staat analysiert. Der Fokus liegt auf der Sicherstellung einer optimalen Nutzung der begrenzten Frequenzressourcen.
- Juristische Betrachtung der Frequenzversteigerungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der rechtlichen Bewertung der Frequenzversteigerung. Es werden die Verfassungsrechtlichen Aspekte der Lizenzierung im Vergleich zum Grundgesetz und die Vereinbarkeit der Versteigerungsform mit dem europäischen Gemeinschaftsrecht beleuchtet.
- Alternativen zur Versteigerung nach Vorbild der UMTS-Auktion: Dieses Kapitel stellt verschiedene Alternativen zur Versteigerung als Allokationsmechanismus für Frequenzen vor und diskutiert deren Vor- und Nachteile im Vergleich zur Versteigerung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Aspekten der Versteigerung von Mobilfunklizenzen, insbesondere im Kontext der UMTS-Lizenzierung in Deutschland. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Frequenzversteigerung, UMTS, Mobilfunk, Allokation, Effizienz, Erlöse, Verfassungsrecht, Gemeinschaftsrecht, Regulierungsbehörde, Telekommunikationsgesetz.
- Quote paper
- Daniel Grosman (Author), 2005, Die Versteigerung von UMTS-Lizenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44640