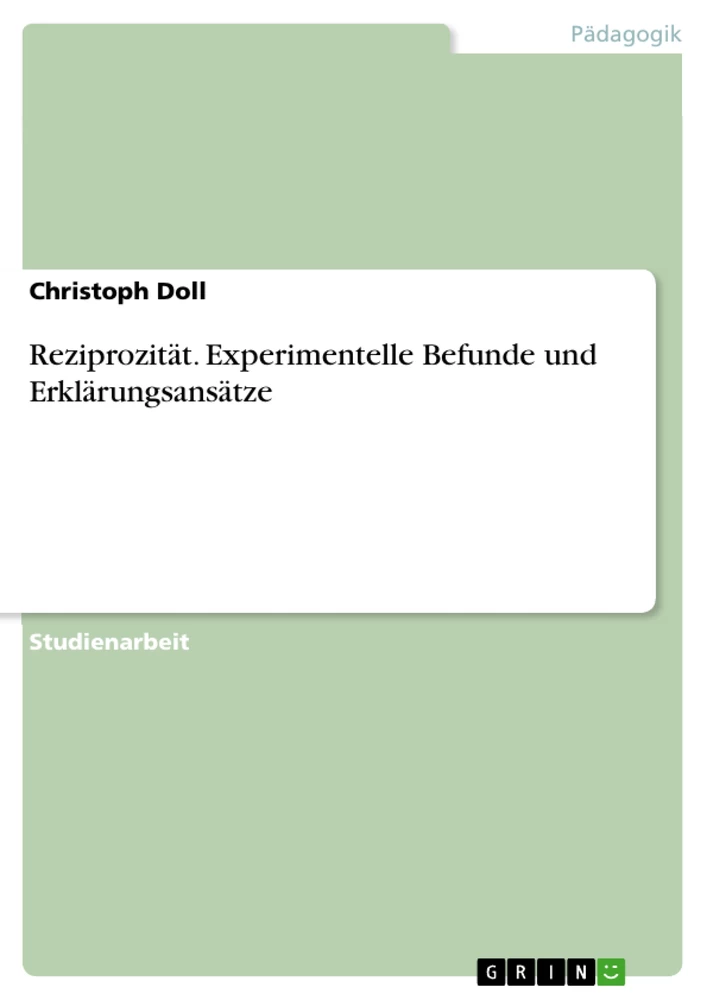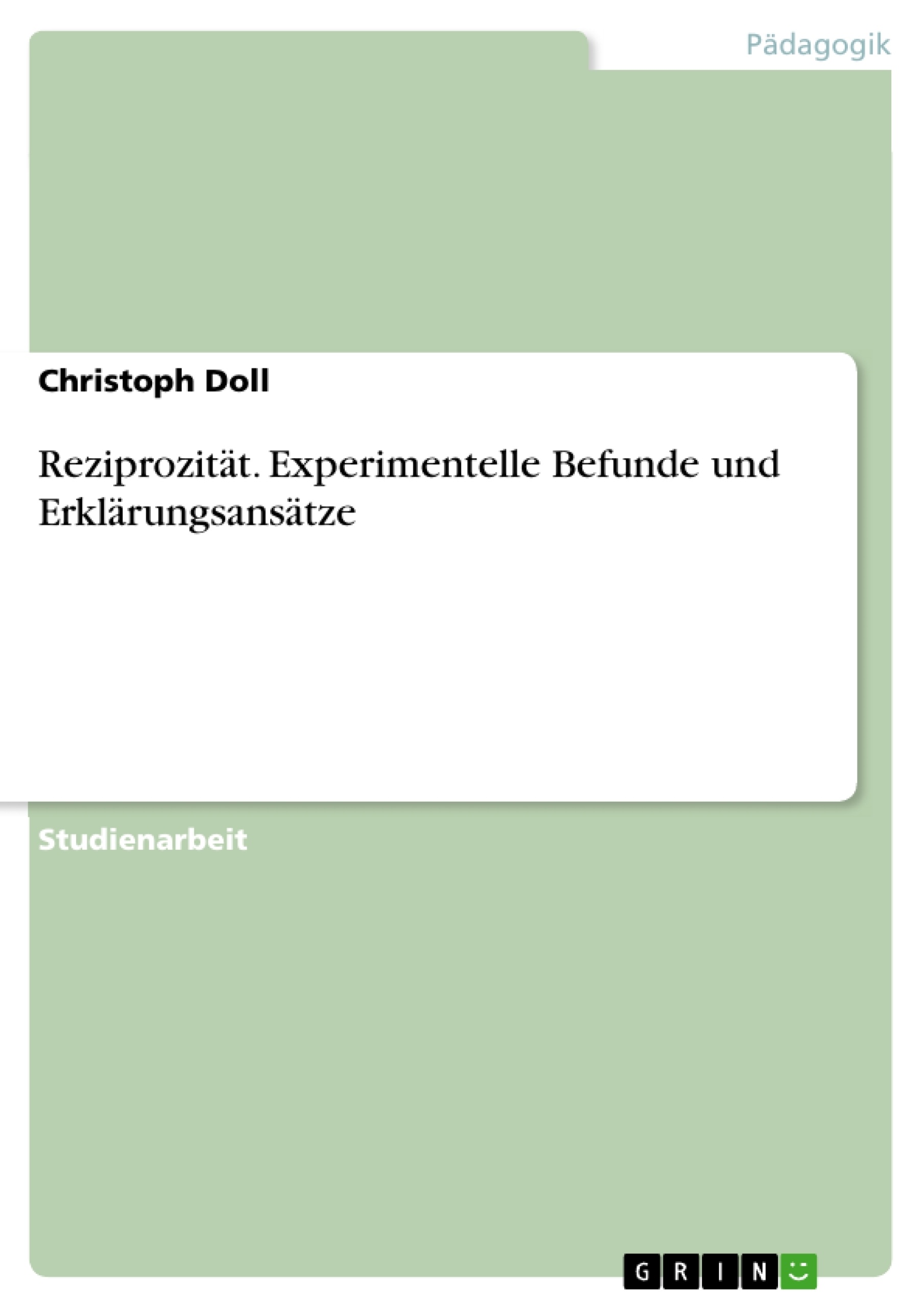Seit den 1980er Jahren nimmt die Bedeutung der Eigennutzenmaximierungshypothese stetig ab. Viele Individuen handeln nicht nur aus Eigennutz, sondern legen ihren Handlungen auch soziale Präferenzen wie z. B. Reziprozität zugrunde.
Reziprozität spielt im Alltag und in vielfältigen Kontexten eine wichtige Rolle. So kaufen reziproke Individuen beispielsweise einen Artikel auch dort, wo sie im Vorfeld eine Beratung erfahren haben, wohingegen sogenannte Homines Oeconomici in diesem Fall auf günstigere Geschäfte ausweichen würden. Auch im Unternehmenskontext ist eine Diskrepanz zwischen Moralität und Rationalität wahrzunehmen, so beispielsweise im Falle der Trittbrettfahrerproblematik.
Ausgehend der Ausführungen wird ersichtlich, dass sogenannte Homines Reciprocans und Homines Oeconomici koexistieren und in vielfältigen Kontexten interagieren. Daraus ableitend resultiert die Fragestellung, wie man eigennützige Individuen zur Reziprozität erziehen kann. Diese Fragestellung wird im Kontext der Arbeit anhand spieltheoretischer Befunde beleuchtet und es werden Ansätze zur Förderung des erwünschten Verhaltens expliziert.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Reziprozität
- Definition Reziprozität
- Grundprinzipien menschlichen Handelns
- Formen der Reziprozität
- Positive Reziprozität
- Negative Reziprozität
- Befunde zu reziprokem Verhalten
- Positive Reziprozität – Das Gift Exchange Spiel
- Negative Reziprozität – Das Ultimatumspiel
- Erziehungs- und Erhaltungsansätze zu Reziprozität
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Reziprozität im menschlichen Handeln, insbesondere im wirtschaftlichen Kontext. Sie analysiert experimentelle Befunde zu positivem und negativem reziprokem Verhalten und diskutiert Erklärungsansätze. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie eigennützige Individuen zur Reziprozität erzogen werden können.
- Definition und Differenzierung von Reziprozität
- Analyse experimenteller Befunde (Gift Exchange Spiel, Ultimatumspiel)
- Erklärungsansätze für reziprokes und eigennütziges Verhalten
- Möglichkeiten der Förderung von Reziprozität
- Zusammenhang zwischen Moralität und Rationalität im wirtschaftlichen Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Die Arbeit untersucht die abnehmende Bedeutung der Eigennutzenmaximierungshypothese und die zunehmende Rolle sozialer Präferenzen wie Reziprozität im menschlichen Handeln. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen moralischem und rationalem Verhalten anhand von Beispielen aus dem Alltag und dem Unternehmenskontext (z.B. Trittbrettfahrerproblem). Die zentrale Frage ist, wie eigennützig handelnde Individuen zur Reziprozität erzogen werden können. Die Arbeit nutzt spieltheoretische Befunde, um diese Frage zu beantworten und Ansätze zur Verhaltensförderung zu entwickeln.
Reziprozität: Dieses Kapitel definiert und differenziert den Begriff der Reziprozität im spieltheoretischen Kontext. Es erläutert Reziprozität als verhaltensbasierte Reaktion auf Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit, wobei Freundlichkeit aus Verteilungsgerechtigkeit und Fairness besteht. Der Text unterscheidet Reziprozität von anderen sozialen Präferenzen wie Ungleichheitsaversion, Kooperation, Vergeltung und Altruismus. Es wird detailliert auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten eingegangen, um ein klares Verständnis für den Begriff zu schaffen und den Leser auf die Analyse der experimentellen Befunde im folgenden Kapitel vorzubereiten.
Befunde zu reziprokem Verhalten: Dieses Kapitel analysiert experimentelle Befunde zu reziprokem Verhalten, fokussiert auf das Gift Exchange Spiel und das Ultimatumspiel. Es rekonstruiert das Verhalten der Individuen in diesen Spielen und leitet daraus Erklärungsansätze ab. Die Analyse zielt darauf ab, aufzuzeigen, dass eine Erziehung zur Reziprozität wünschenswert ist, um die daraus resultierenden Vorteile zu nutzen. Die Kapitel beschreibt die Bedeutung beider Spiele für das Verständnis von positivem und negativem reziproken Verhalten. Es wird untersucht, wie die Ergebnisse der Experimente zu einem besseren Verständnis von Reziprozität beitragen und wie diese Erkenntnisse für die Förderung erwünschten Verhaltens genutzt werden können.
Schlüsselwörter
Reziprozität, Eigennutzenmaximierung, soziale Präferenzen, Fairness, Gerechtigkeit, experimentelle Ökonomik, Gift Exchange Spiel, Ultimatumspiel, Ungleichheitsaversion, Kooperation, Vergeltung, Altruismus, Moralerziehung, Wirtschaftsethik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Reziprozität im menschlichen Handeln
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Reziprozität im menschlichen Handeln, insbesondere im wirtschaftlichen Kontext. Sie analysiert experimentelle Befunde zu positivem und negativem reziprokem Verhalten und diskutiert Erklärungsansätze. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie eigennützige Individuen zur Reziprozität erzogen werden können.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Differenzierung von Reziprozität, die Analyse experimenteller Befunde (Gift Exchange Spiel, Ultimatumspiel), Erklärungsansätze für reziprokes und eigennütziges Verhalten, Möglichkeiten der Förderung von Reziprozität und den Zusammenhang zwischen Moralität und Rationalität im wirtschaftlichen Handeln.
Was ist die Problemstellung?
Die Arbeit untersucht die abnehmende Bedeutung der Eigennutzenmaximierungshypothese und die zunehmende Rolle sozialer Präferenzen wie Reziprozität. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen moralischem und rationalem Verhalten und stellt die zentrale Frage, wie eigennützig handelnde Individuen zur Reziprozität erzogen werden können.
Wie wird Reziprozität definiert?
Das Kapitel "Reziprozität" definiert und differenziert den Begriff im spieltheoretischen Kontext. Reziprozität wird als verhaltensbasierte Reaktion auf Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit beschrieben, wobei Freundlichkeit aus Verteilungsgerechtigkeit und Fairness besteht. Es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu anderen sozialen Präferenzen (Ungleichheitsaversion, Kooperation, Vergeltung, Altruismus) erläutert.
Welche experimentellen Befunde werden analysiert?
Das Kapitel "Befunde zu reziprokem Verhalten" analysiert das Gift Exchange Spiel und das Ultimatumspiel. Es rekonstruiert das Verhalten der Individuen und leitet daraus Erklärungsansätze ab. Die Analyse zeigt auf, dass eine Erziehung zur Reziprozität wünschenswert ist.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Reziprozität, Eigennutzenmaximierung, soziale Präferenzen, Fairness, Gerechtigkeit, experimentelle Ökonomik, Gift Exchange Spiel, Ultimatumspiel, Ungleichheitsaversion, Kooperation, Vergeltung, Altruismus, Moralerziehung, Wirtschaftsethik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst die Kapitel: Problemstellung, Reziprozität (inkl. Definition, Grundprinzipien und Formen), Befunde zu reziprokem Verhalten (inkl. Gift Exchange Spiel und Ultimatumspiel) und Ausblick.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Reziprozität im menschlichen Handeln zu untersuchen, experimentelle Befunde zu analysieren und Erklärungsansätze für reziprokes und eigennütziges Verhalten zu diskutieren. Ein Hauptziel ist die Entwicklung von Ansätzen zur Förderung von Reziprozität.
- Arbeit zitieren
- Christoph Doll (Autor:in), 2015, Reziprozität. Experimentelle Befunde und Erklärungsansätze, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445366