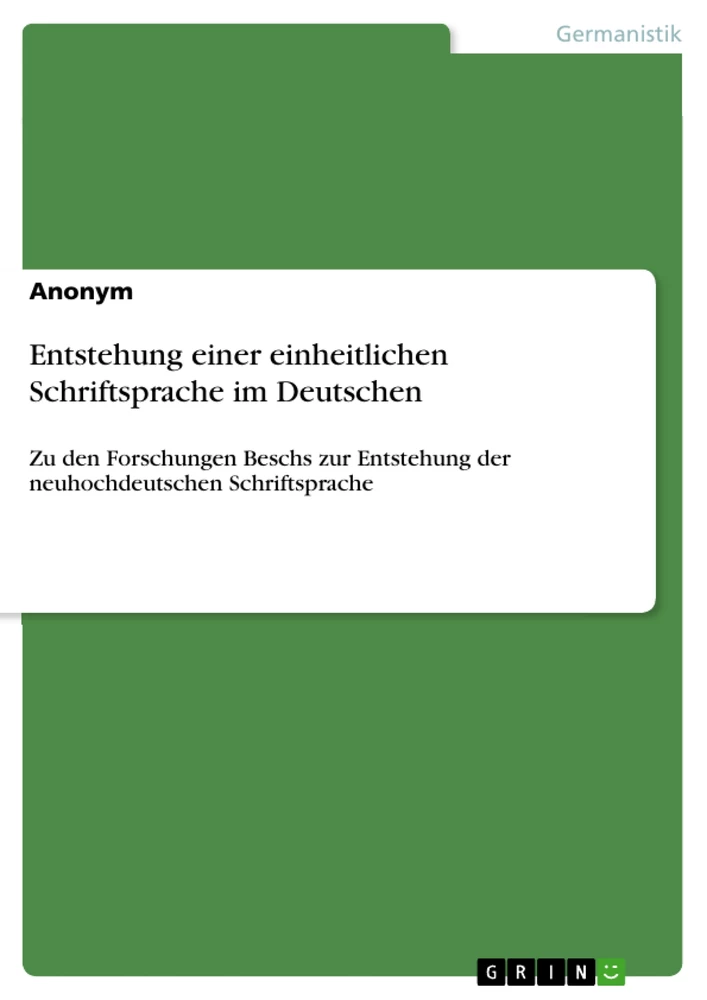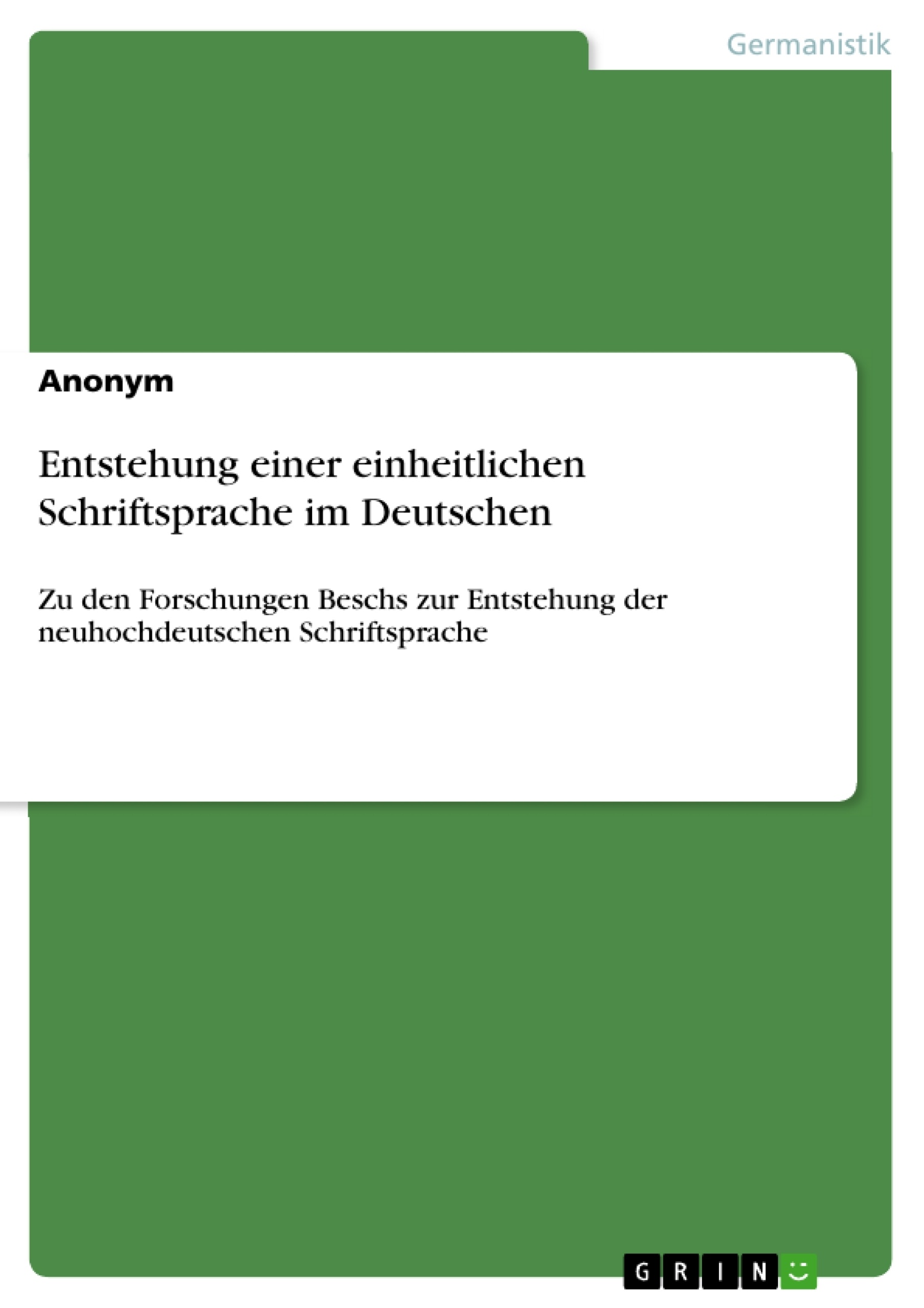Diese Ausarbeitung führt zunächst die Anfänge, Probleme und Faktoren der Vereinheitlichung der Schriftsprache in Deutschland auf. Nach der mündlichen Präsentation wurde der Einwand hereingebracht, dass nicht genauer auf die Forschungen Beschs eingegangen wurde – beispielsweise auf sein Arbeiten mit Landschaftskarten. Dies soll hiermit nachgeholt und insbesondere darauf eingegangen werden, weshalb seine Methodik zu schlüssigeren Ergebnissen kam. Weiterhin soll zum Schluss kurz Bezug auf die Theorie Klaus Jürgen Mattheiers genommen werden, welcher sich als sein Schüler auf die Forschungen Beschs stützt und diese ergänzt.
Die Hypothese zu den Forschungen Beschs ist, dass die Ergebnisse Beschs insbesondere dadurch zu besseren Ergebnissen kam, da er sich nicht nur auf einen Teilbereich wie beispielsweise die Germanisten Theodor Frings und Konrad Burdach beschränkt, sondern die Sprache selbst – bis auf die Syntax – als Ganzes behandelt und insbesondere auch weitläufig geographisch untersucht und dokumentiert hat.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Problem der Entstehungstheorien zur deutschen Standardschriftsprache
- Deutschland als Nachzügler
- Kritik Werner Beschs
- Forschungen Beschs
- Methodischer Optimalkatalog
- Vorgehensweise/Textgrundlage
- Auswertung der Handschriften
- Kartographische Darstellungen
- Ergebnisse Beschs
- Ergänzungen Mattheiers
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache, insbesondere die Methodik und Ergebnisse von Werner Besch im Vergleich zu anderen Theorien. Ziel ist es, die Stärken von Beschs Ansatz herauszuarbeiten und zu zeigen, warum seine Methodik zu schlüssigeren Ergebnissen führte.
- Die verschiedenen, oft widersprüchlichen Entstehungstheorien der deutschen Standardsprache.
- Deutschlands Position als "Nachzügler" im Prozess der Sprachstandardisierung im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
- Kritik an bisherigen Forschungsansätzen und deren methodische Defizite.
- Beschs methodischer Ansatz und seine umfassende geographische und sprachliche Analyse.
- Die Bedeutung Luthers und die unterschiedlichen Interpretationen seines Einflusses.
Zusammenfassung der Kapitel
Zum Problem der Entstehungstheorien zur deutschen Standardschriftsprache: Dieser Abschnitt beleuchtet die Vielzahl widersprüchlicher Theorien zur Entstehung der deutschen Standardsprache. Er betont die Notwendigkeit einer differenzierteren und methodisch fundierteren Herangehensweise, da bestehende Ansätze sich oft gegenseitig ausschließen und zu voreiligen Schlussfolgerungen führen. Der Abschnitt dient als Einleitung und führt in die Problematik ein, die durch Werner Besch kritisch beleuchtet wird.
Deutschland als Nachzügler: Dieses Kapitel beschreibt Deutschland als einen "Nachzügler" in der Entwicklung einer einheitlichen Schriftsprache im Vergleich zu Ländern mit monozentrischen politischen Strukturen. Die plurizentrische Struktur Deutschlands mit regionalen Schreibsprachen und die konfessionelle Spaltung, verstärkt durch die Reformation Luthers, erschwerten den Standardisierungsprozess erheblich und führten zu einer komplexeren sprachlichen Situation als in anderen europäischen Ländern.
Kritik Werner Beschs: Hier wird die Kritik Werner Beschs an bestehenden Forschungstheorien dargelegt. Besch kritisiert die einseitige Fokussierung auf Teilaspekte wie Kanzleisprache oder Mundarten, sowie die Beschränkung auf Buchstaben und Laute ohne Berücksichtigung der Gesamtstruktur der Sprache. Er betont die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise, die geographische und sprachliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Die unterschiedlichen Wertungen des Einflusses Luthers auf die Sprachentwicklung werden als weiterer Kritikpunkt genannt.
Schlüsselwörter
Neuhochdeutsche Schriftsprache, Sprachstandardisierung, Werner Besch, Methodik, Entstehungstheorien, Deutschland, Plurizentrismus, Kanzleisprache, Mundarten, Luther, Sprachgeographie.
FAQ: Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache nach Werner Besch
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache, insbesondere die Methodik und Ergebnisse von Werner Besch im Vergleich zu anderen Theorien. Sie untersucht die Stärken von Beschs Ansatz und zeigt, warum seine Methodik zu schlüssigeren Ergebnissen führte als frühere Ansätze.
Welche Entstehungstheorien der deutschen Standardsprache werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Vielzahl widersprüchlicher Theorien zur Entstehung der deutschen Standardsprache und kritisiert deren oft einseitige Fokussierung und methodische Defizite. Sie zeigt auf, wie diese Theorien zu voreiligen Schlussfolgerungen führen und betont die Notwendigkeit einer differenzierteren und methodisch fundierteren Herangehensweise.
Warum wird Deutschland als "Nachzügler" bezeichnet?
Deutschland wird als "Nachzügler" in der Entwicklung einer einheitlichen Schriftsprache im Vergleich zu anderen europäischen Ländern beschrieben. Die plurizentrische Struktur Deutschlands mit regionalen Schreibsprachen und die konfessionelle Spaltung erschwerten den Standardisierungsprozess erheblich.
Wie kritisiert Werner Besch bestehende Forschungsansätze?
Besch kritisiert die einseitige Fokussierung bestehender Ansätze auf Teilaspekte wie Kanzleisprache oder Mundarten und die Beschränkung auf Buchstaben und Laute ohne Berücksichtigung der Gesamtstruktur der Sprache. Er plädiert für eine ganzheitliche Betrachtungsweise, die geographische und sprachliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigt und kritisiert die unterschiedlichen Wertungen des Einflusses Luthers auf die Sprachentwicklung.
Welche Methodik verwendet Werner Besch?
Beschs methodischer Ansatz beinhaltet eine umfassende geographische und sprachliche Analyse. Die Arbeit beschreibt seine Vorgehensweise, die Auswertung von Handschriften, die Erstellung kartographischer Darstellungen und die daraus resultierenden Ergebnisse. Diese werden im Vergleich zu den Ergänzungen Mattheiers betrachtet.
Welche Ergebnisse erzielte Besch?
Die Arbeit hebt die schlüssigeren Ergebnisse von Beschs Methodik hervor im Vergleich zu früheren Ansätzen. Die konkreten Ergebnisse seiner Forschung werden detailliert dargestellt und analysiert.
Welche Rolle spielt Martin Luther in der Entstehung der deutschen Standardsprache?
Die Arbeit diskutiert die Bedeutung Luthers und die unterschiedlichen Interpretationen seines Einflusses auf die Sprachentwicklung. Diese unterschiedlichen Interpretationen werden als ein Kritikpunkt an früheren Forschungsansätzen genannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neuhochdeutsche Schriftsprache, Sprachstandardisierung, Werner Besch, Methodik, Entstehungstheorien, Deutschland, Plurizentrismus, Kanzleisprache, Mundarten, Luther, Sprachgeographie.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Entstehung einer einheitlichen Schriftsprache im Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445022