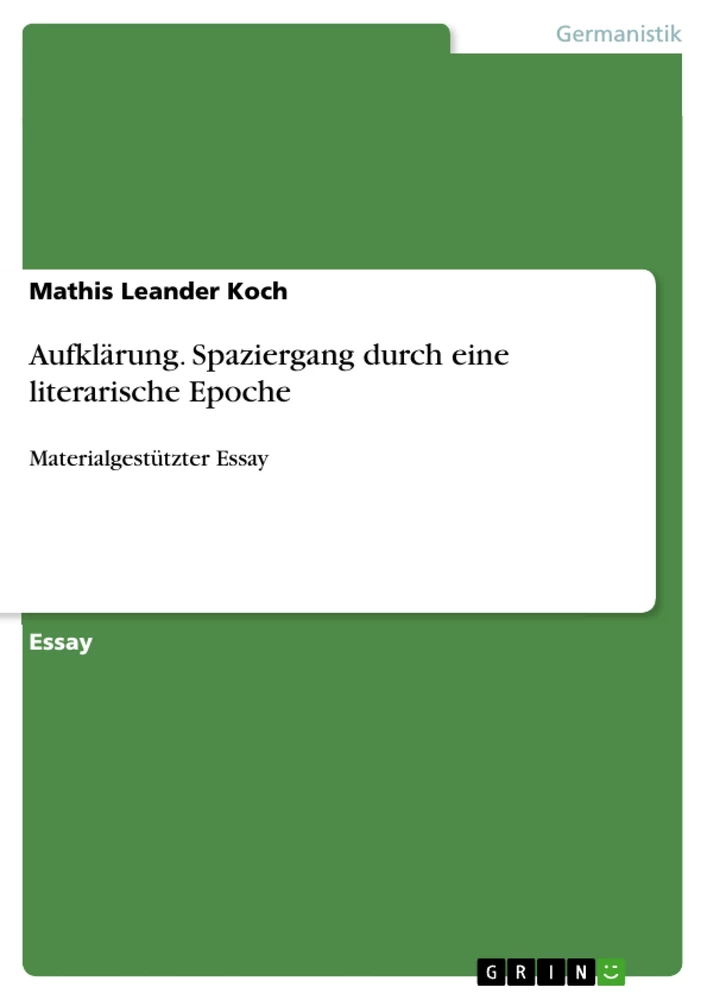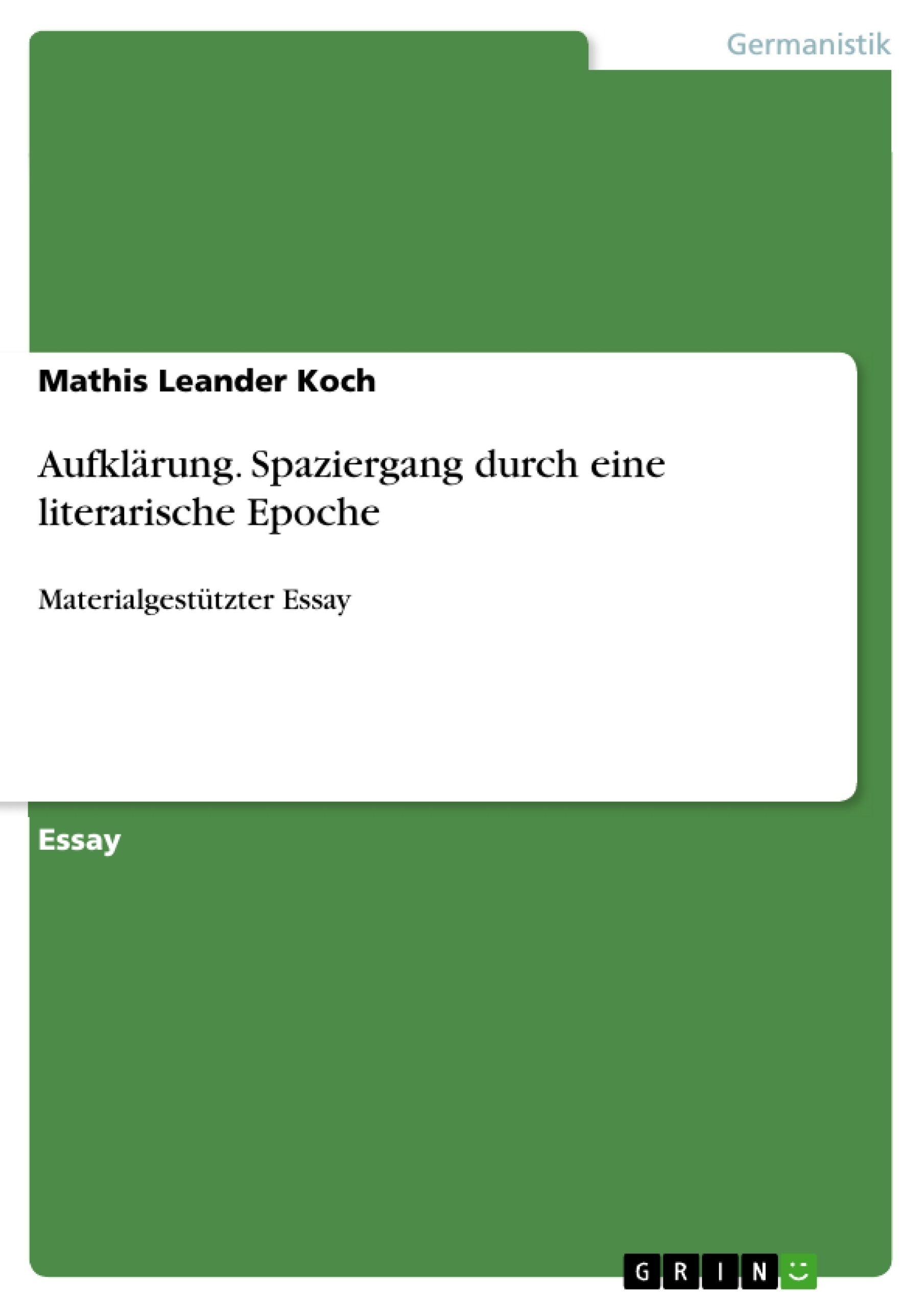Ein ganzes Jahrhundert wird unter dem Etikett der literarischen Aufklärung zusammengefasst; oft werden die großen Namen der Zeit in einem Atemzug genannt: Aber wieviel haben Gottsched, Gellert, Lessing, Schiller, Goethe, Lenz u.v.a.m. tatsächlich gemein?
Inhaltsverzeichnis
- Johann Christoph Gottsched
- „Versuch einer kritischen Dichtkunst“ (1730)
- Gotthold Ephraim Lessing
- Briefwechsel mit Friedrich Nicolai (1756)
- „Der Tanzbär“ (1750er)
- Christian Fürchtegott Gellert
- „Der Tanzbär“ (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts)
- Gottlieb Konrad Pfeffel
- „Der Tanzbär“ (letztes Viertel des 18. Jahrhunderts)
- Johann Wolfgang von Goethe
- Rede zum Shakespeare-Tag (1771)
- „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774)
- Reinhold Jakob Michael Lenz
- „Handeln ist die Seele der Welt“ (1777)
- Gotthold Ephraim Lessing
- „Nathan der Weise“ (1779)
- Friedrich Schiller
- „Die Räuber“ (1781)
- „Die Schaubühne“ (1784)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die literarische Epoche der Aufklärung anhand verschiedener Autoren und ihrer Werke, wobei die wichtigsten Aspekte der Epoche beleuchtet werden sollen. Dabei liegt der Fokus auf der Entwicklung der literarischen Formen und deren Spiegelung der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen.
- Entwicklung der literarischen Formen und Gattungen in der Aufklärung
- Die Bedeutung der Vernunft und Moral in der Literatur
- Der Wandel des Theaterverständnisses und dessen Bedeutung für die Gesellschaft
- Die Rolle der Literatur in der gesellschaftlichen und politischen Veränderung
- Die Konfrontation zwischen Tradition und Moderne in der Aufklärungsliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung in die Epoche der Aufklärung, die durch das Jahr 1700 markiert wird und mit dem 100. Jahr, dem Jahr 1800 endet. Der Autor stellt die Bedeutung von „Aufklärung“ als literarisches Konzept dar und setzt dies in Relation mit der historischen Entwicklung. Johann Christoph Gottsched wird als ein Vordenker der literarischen Aufklärung vorgestellt, dessen „Versuch einer kritischen Dichtkunst“ (1730) einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Literatur im 18. Jahrhundert hatte. Der Text verdeutlicht Gottscheds Vorstellung von einer rationalen Literatur, die einen klaren moralischen Lehrsatz vermitteln soll.
Im Anschluss daran werden die Werke von Gotthold Ephraim Lessing beleuchtet, der sich mit seinem Briefwechsel mit Friedrich Nicolai (1756) und seinen Fabeln, wie dem „Tanzbär“, kritisch mit Gottscheds Thesen auseinandersetzt. Lessings Werk repräsentiert eine neue Sichtweise auf die Literatur, die Emotionen und Leidenschaften in den Vordergrund stellt und die moralische Lehre in das Zentrum der Gesellschaftlichkeit stellt.
Der Text stellt dann die Werke von Christian Fürchtegott Gellert und Gottlieb Konrad Pfeffel vor, deren unterschiedliche Interpretationen der Fabel „Der Tanzbär“ die Vielfalt der moralischen Botschaften der Aufklärungsliteratur verdeutlichen.
Der Autor widmet sich dann Johann Wolfgang von Goethe, der mit seiner Rede zum Shakespeare-Tag (1771) und seinem Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774) die Strömung des Sturm und Drang repräsentiert. Goethes Werk zeichnet sich durch eine stärkere Betonung von Gefühlen und Individualität aus und steht damit im Gegensatz zu der rationalen und moralischen Literatur Gottscheds.
Der Text befasst sich anschließend mit Reinhold Jakob Michael Lenz, dessen Theaterkritik „Handeln ist die Seele der Welt“ (1777) eine radikale Abkehr vom traditionellen Theaterverständnis darstellt. Lenz plädiert für eine Literatur, die die Handlung als zentrale Komponente betont und die passive Rolle des Zuschauers ablehnt.
Schließlich wird Friedrich Schiller vorgestellt, der mit seinen Werken „Die Räuber“ (1781) und „Die Schaubühne“ (1784) ebenfalls dem Sturm und Drang zugeordnet wird und sich mit seinem Theaterverständnis gegen die Traditionellen der Aufklärung auflehnt.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit der literarischen Epoche der Aufklärung und untersucht den Wandel der literarischen Formen und Gattungen im 18. Jahrhundert. Zentrale Begriffe und Themen sind: Aufklärung, Literatur, Theater, Moral, Vernunft, Individualität, Gesellschaft, Geschichte, Tradition, Moderne, Sturm und Drang, Fabel, Gedicht, Theaterstück, Briefwechsel, Moral, Lehrsatz, Gefühl, Leidenschaft, Kritik, Handlung, Zuschauer, Literaturgeschichte, Weimarer Klassik.
- Quote paper
- Mathis Leander Koch (Author), 2017, Aufklärung. Spaziergang durch eine literarische Epoche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444524