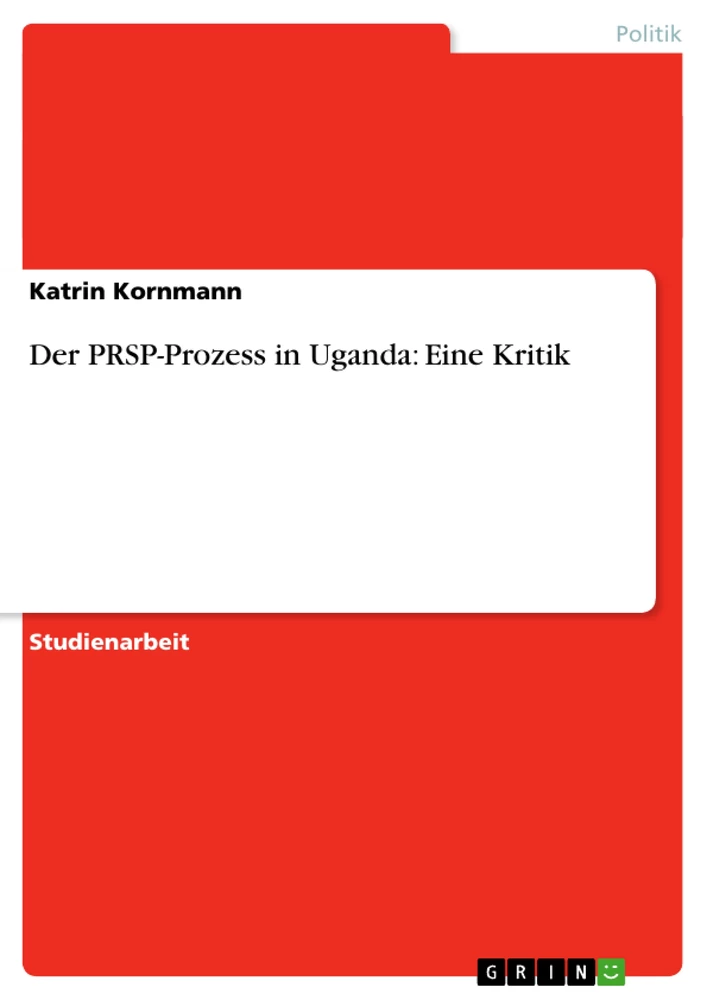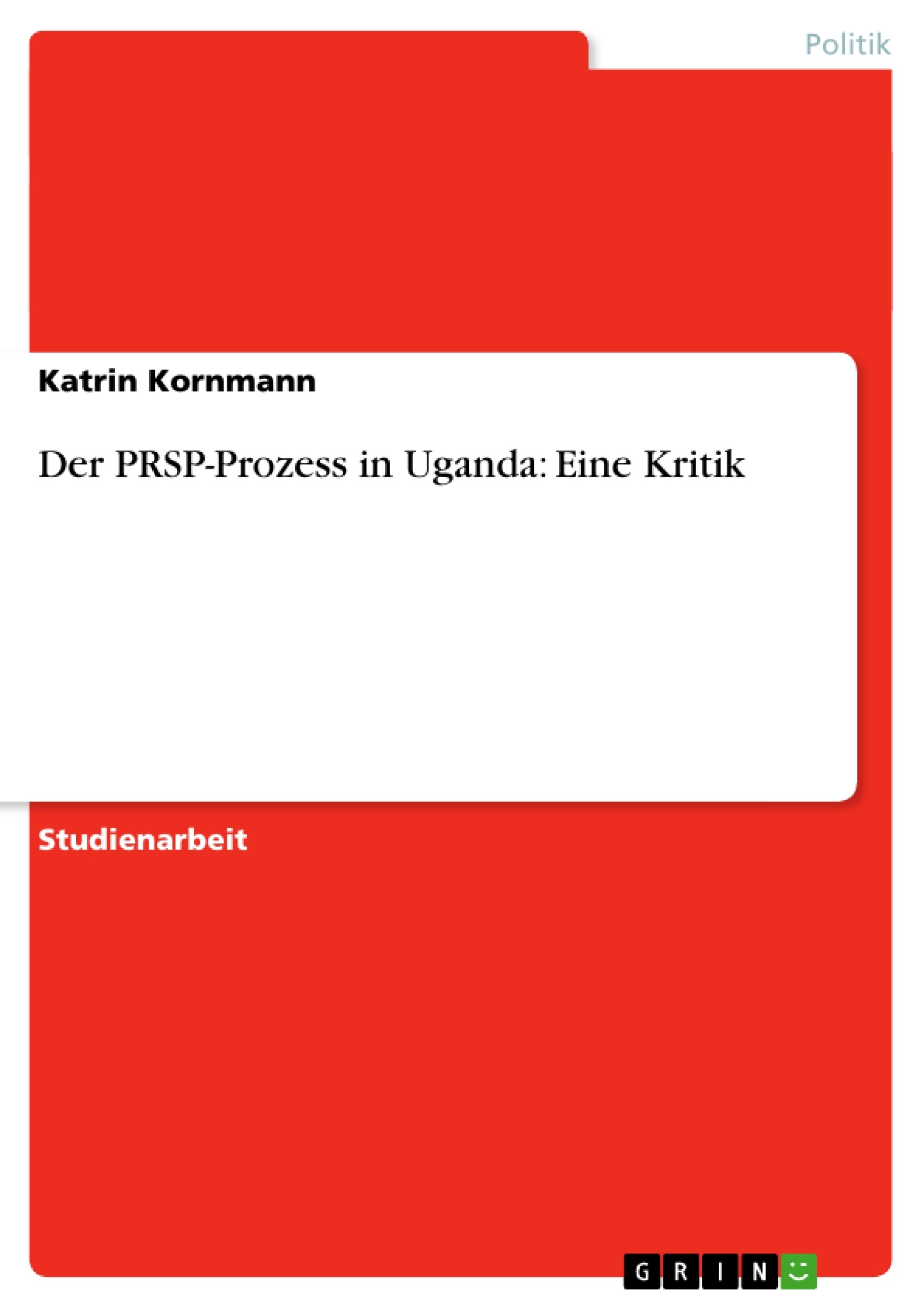„G8-Finanzminister feiern historischen Schuldenerlass“ (SPIEGEL online am 11.06.05, http://www.spiegel.de) - so oder so ähnlich lauteten die Schlagzeilen seit Sonntag, dem 11. Juni 2005, an dem die Finanzminister der sieben führenden Industrienationen und Russlands sich auf einen Schuldenerlass für die ärmsten Länder der Welt geeinigt haben. Seitdem sind Begriffe wie „Good Governance“, „Millenniumsziele“ und „Poverty Reduction Strategy Papers“ in aller Munde. Die Öffentlichkeit fragt sich schließlich, ob sich im Bürgerkrieg befindliche Staaten jetzt mehr Waffen kaufen können, autokratische Systeme in Entwicklungsländern so indirekt unterstützt werden oder das frei werdende Kapital nun in korrupten Verwaltungen versickert. Um derartige Szenarien weitgehend zu vermeiden, wurde das Vorhandensein eines Poverty Reduction Strategy Papers (im folgenden PRSP) zur Bedingung bei Schuldenerlassinitiativen. Eine regelmäßige Kontrolle, partizipative Prozesse bei der Entstehung und der selbstverantwortliche Ownership-Ansatz des Konzeptes sollen in den Entwicklungsländern zu einer nachhaltigen, an Armutsminderung orientierten Entwicklung führen und quasi nebenbei die Zivilgesellschaft stärken.
Die ersten Progress Reports der PRSPs waren aber trotz des innovativen Potentials eher ernüchternd. Vielfach hatten sich Umsetzungsprobleme gezeigt, die teilweise schon auf die Entstehungsphase des PRSPs zurückzuführen waren. Viele Ziele, die in den PRSPs enthusiastisch formuliert wurden, mussten revidiert und die Erwartungen heruntergeschraubt werden. In dieser Hausarbeit möchte ich mich vor allem mit diesen zahlreichen Kritikpunkten beschäftigen. Im Mittelpunkt meiner Arbeit soll konkret die Kritik an dem PRSP-Prozess in Uganda stehen. Ich habe Uganda ausgewählt, weil es den Geberländern, dem Internationalen Währungsfonds (im folgenden IWF) und der Weltbank als entwicklungspolitisches „Vorzeigeland“ galt und noch gilt. Die marktwirtschaftliche Entwicklung Ugandas in den 90er Jahren war vorbildlich (so die Weltbank). Auch im PRSP-Prozess ist Uganda das Beispiel für Subsahara-Afrika: Es reichte als eines der ersten Länder das PRSP ein, das PRSP basiert auf einem zuvor bereits ausgearbeiteten Armutsprogramm und die Entwicklung der Zivilgesellschaft ist durchaus bemerkenswert. Ein ganz persönlicher Grund für die Wahl ist die, im Vergleich zu anderen Ländern, deutliche Verbesserung der Armutssituation in Uganda.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Poverty Reduction Strategy Papers
- Grundlagen PRSPS
- Der PRSP-Prozess in Uganda
- Entstehung
- Akteure/Ownership
- Partizipationsprozess
- Monitoringstrategien
- Ergebnisse
- Kritik an den PRSP-Prozessen
- Allgemeine Kritik an den PRSP-Prozessen
- Partizipation
- Ownership
- Kritik des ugandischen PRSP-Prozesses
- Partizipation & Ownership
- Ergebnisorientierte Armutsbekämpfung
- Multidimensionalität
- Zusammenarbeit
- Nachhaltigkeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Kritik am PRSP-Prozess in Uganda, einem Land, das in der Entwicklungszusammenarbeit als Vorzeigeland gilt. Der Fokus liegt auf der Analyse von Umsetzungsproblemen und der kritischen Evaluierung des Partizipations- und Ownership-Konzepts im PRSP-Prozess.
- Analyse der Kritikpunkte am PRSP-Prozess
- Bewertung der Partizipation und Ownership im ugandischen Kontext
- Untersuchung der Ergebnisse des PRSP-Prozesses in Uganda
- Diskussion der Herausforderungen und Chancen der Armutsbekämpfung durch PRSPs
- Bedeutung des PRSP-Prozesses für die Entwicklungszusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des PRSP-Prozesses ein und stellt die Bedeutung von Poverty Reduction Strategy Papers im Kontext von Schuldenerlassinitiativen und der Erreichung der Millenniumsziele dar. Zudem wird die Auswahl Ugandas als Fallbeispiel begründet.
- Poverty Reduction Strategy Papers: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen des PRSP-Konzepts, die fünf Grundprinzipien und die Funktionsweise des Policy-Zyklus.
- Der PRSP-Prozess in Uganda: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des PRSP in Uganda, die beteiligten Akteure, den Partizipationsprozess und die Ergebnisse des PRSP-Prozesses.
- Kritik an den PRSP-Prozessen: Dieses Kapitel beleuchtet die allgemeine Kritik an den PRSP-Prozessen, insbesondere in Bezug auf Partizipation und Ownership, und analysiert die Kritikpunkte am ugandischen PRSP-Prozess, unter anderem in Bezug auf Ergebnisorientierung, Multidimensionalität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP, Uganda, Partizipation, Ownership, Armutsbekämpfung, Entwicklungszusammenarbeit, Millenniumsziele, Kritik, Umsetzungsprobleme, Zivilgesellschaft, Politikgestaltung. Diese Begriffe umfassen die wichtigsten Themen und Konzepte, die im Rahmen der Arbeit behandelt werden.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs)?
PRSPs sind Strategiepapiere zur Armutsbekämpfung, die von Entwicklungsländern in einem partizipativen Prozess erstellt werden müssen, um für Schuldenerlasse durch IWF und Weltbank infrage zu kommen.
Warum galt Uganda als „Vorzeigeland“ im PRSP-Prozess?
Uganda reichte als eines der ersten Länder ein PRSP ein, hatte bereits zuvor eigene Armutsprogramme entwickelt und zeigte eine bemerkenswerte Einbindung der Zivilgesellschaft.
Was wird am Partizipationsprozess in Uganda kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass die Beteiligung oft oberflächlich war, die wirkliche Macht bei den Geberländern blieb und die Zivilgesellschaft nicht immer echten Einfluss auf die Kernentscheidungen hatte.
Was bedeutet der „Ownership-Ansatz“?
Der Ownership-Ansatz besagt, dass das Entwicklungsland selbst die Verantwortung für die Strategie übernehmen soll, statt sie von externen Organisationen aufgezwungen zu bekommen.
Haben PRSPs die Armut in Uganda nachhaltig verringert?
Obwohl es deutliche Verbesserungen der Armutssituation gab, zeigen Analysen auch Probleme bei der Nachhaltigkeit und der Zusammenarbeit, die die langfristigen Ziele gefährden könnten.
- Citar trabajo
- Katrin Kornmann (Autor), 2005, Der PRSP-Prozess in Uganda: Eine Kritik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44445