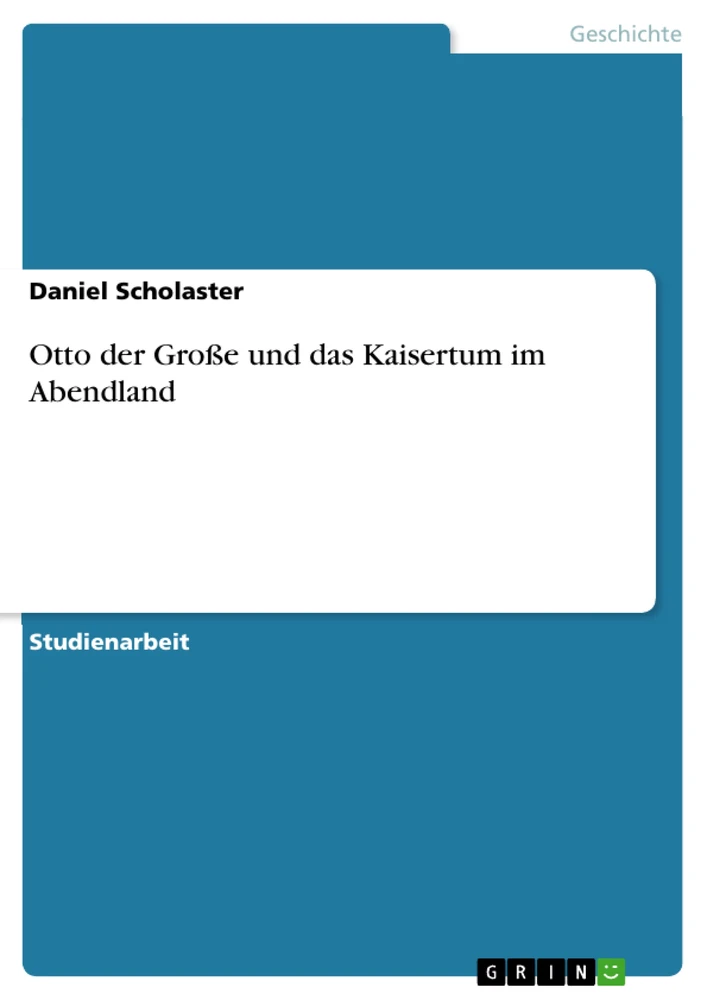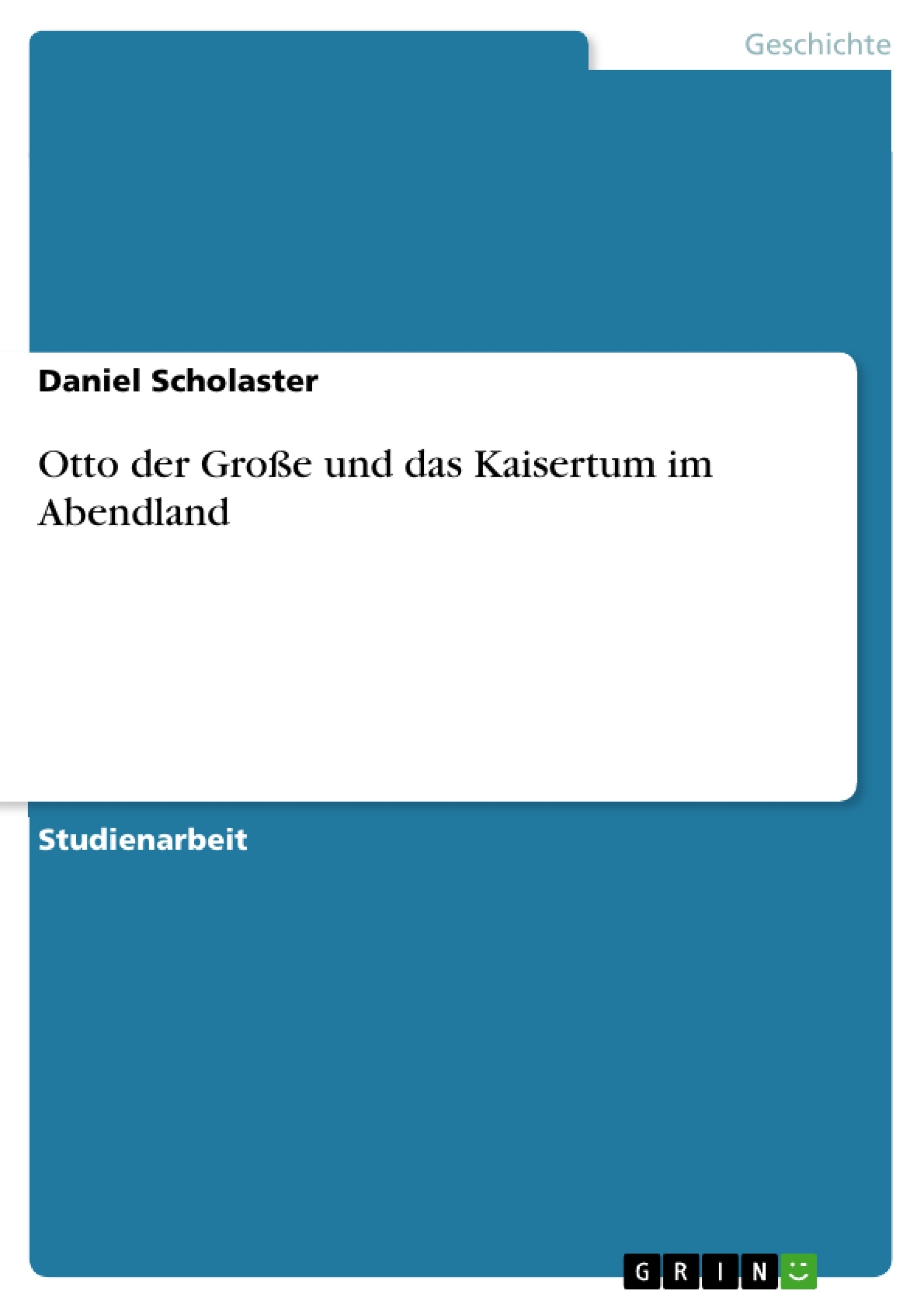Im Jahr 2012 konnten zwei Jubiläen der ottonischen Dynastie begangen werden: der 1100. Geburtstag Ottos des Großen und der 1050. Jahrestag seiner Kaiserkrönung in Rom. Die Historiker weisen inzwischen vermehrt darauf hin, dass diese Persönlichkeit nicht nur für uns Deutsche eine besondere Rolle spielen sollte, sondern auch für die Geschichte vieler anderer Länder. Obwohl er aus Sachsen kam, herrschte Otto doch über ein Reich, in dem mehrere Sprachen gesprochen wurden. Auch hatte er sich durch seine Stellung als mächtigster Herrscher im Abendland mehrere Länder und Völker tributpflichtig oder ihre Fürsten zu Vasallen gemacht. Das gilt z. B. für Böhmen, Polen und Dänemark. Auch in die Geschicke des Westfrankenreiches, aus dem später Frankreich hervorgehen sollte, griff er mehrfach ein. Schließlich gelang es ihm, sich zum König Italiens zu erheben und in Rom die Kaiserkrone aus den Händen des Papstes zu empfangen.
Genau mit dieser Geschichte will ich mich im Folgenden befassen und herausarbeiten, inwiefern unter der Herrschaft Ottos des Großen noch karolingische Traditionen und Handlungsmuster fortwirkten und inwieweit sich Otto selbst in der Nachfolge Karls des Großen sah. Denn die Forschung weist seit einigen Jahrzehnten vermehrt darauf hin, dass bei der Beschäftigung mit den Ottonen nicht nur auf das Trennende zwischen den sich allmählich auseinanderentwickelnden Teilen des ehemaligen Karolingerreiches zu achten ist. Ebenso sollten die Kontinuitäten karolingischer Prägung Europas in dieser Epoche betrachtet werden. Schließlich war Otto König der Ostfranken und Kaiser eines übernationalen Herrschaftskomplexes. Ziel dieser Seminararbeit ist es, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Otto dem Großen zu vermitteln. Intensive Quellenanalysen dienen der Unterstützung der Betrachtungen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Otto I. als König des Ostfrankenreiches
- 1. Krönung in Aachen
- 2. Die Italienpolitik
- III. Die Schlacht auf dem Lechfeld und ihre Folgen
- IV. Die Kaiserkrönung in Rom
- V. Otto und die Mächte seiner Zeit
- 1. Die westfränkischen Karolinger
- 2. Byzanz
- 3. Stellung zum Papst
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Herrschaft Ottos des Großen und beleuchtet die Frage, inwieweit karolingische Traditionen und Handlungsmuster fortwirkten. Es wird analysiert, wie Otto seine Vorherrschaft in Europa sicherte und ausbaute, seine Kaiserkrönung und das Verhältnis zu anderen europäischen Mächten (westfränkische Karolinger, Byzanz und Papsttum) betrachtet. Der aktuelle Forschungsstand wird zusammengefasst.
- Ottos Königserhebung und seine Sicherung der Macht im Ostfrankenreich
- Die Bedeutung der Italienpolitik Ottos des Großen
- Die Kaiserkrönung Ottos und ihre Folgen für das europäische Machtgefüge
- Das Verhältnis Ottos des Großen zu den westfränkischen Karolingern, Byzanz und dem Papsttum
- Kontinuitäten und Brüche zwischen karolingischer und ottonischer Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die Bedeutung der Jubiläen zum 1100. Geburtstag Ottos des Großen und zum 1050. Jahrestag seiner Kaiserkrönung. Sie unterstreicht Ottos übernationale Herrschaft und die Notwendigkeit, neben den Unterschieden zwischen den Teilen des ehemaligen Karolingerreiches auch die Kontinuitäten zu betrachten. Die verwendeten Quellen, darunter die Chroniken von Widukind von Corvey, Liudprand von Cremona und Thietmar von Merseburg, sowie aktuelle Biographien werden vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Fortwirkens karolingischer Traditionen und Ottos Selbstverständnis in der Nachfolge Karls des Großen.
II. Otto I. als König des Ostfrankenreiches: Dieses Kapitel behandelt Ottos Aufstieg zur Macht im Ostfrankenreich. Die Krönung in Aachen 936 wird als Ausdruck sowohl der karolingischen Tradition als auch der Untermauerung seines Anspruchs auf Lothringen interpretiert. Der Vergleich mit der Krönung seines Vaters Heinrichs wird gezogen, um die Unterschiede in der Legitimation und dem Selbstverständnis der Herrschaft hervorzuheben. Widukinds Darstellung der Krönung und die Frage der fränkischen und sächsischen Elemente in Ottos Herrschaft werden analysiert. Die Rolle Byzanz' als Vorbild wird diskutiert. Die Italienpolitik wird als wichtiger Bestandteil seiner Machtsicherung im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Otto der Große, Kaisertum, Karolinger, Ostfrankenreich, Italienpolitik, Lechfeldschlacht, Byzanz, Papst, Widukind von Corvey, Liudprand von Cremona, Thietmar von Merseburg, karolingische Kontinuitäten, Reichsgewalt, Machtsicherung, europäische Geschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Otto der Große
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Herrschaft Ottos des Großen und analysiert, inwieweit karolingische Traditionen und Handlungsmuster in seiner Regierungszeit fortwirkten. Im Mittelpunkt stehen Ottos Machtsicherung und -ausbau in Europa, seine Kaiserkrönung und sein Verhältnis zu anderen europäischen Mächten (westfränkische Karolinger, Byzanz und Papsttum).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Ottos Königserhebung und Machtsicherung im Ostfrankenreich, die Bedeutung seiner Italienpolitik, seine Kaiserkrönung und deren Folgen für das europäische Machtgefüge, sowie sein Verhältnis zu den westfränkischen Karolingern, Byzanz und dem Papsttum. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Kontinuitäten und Brüchen zwischen karolingischer und ottonischer Herrschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Otto I. als König des Ostfrankenreiches (inkl. Krönung in Aachen und Italienpolitik), Die Schlacht auf dem Lechfeld und ihre Folgen, Die Kaiserkrönung in Rom, Otto und die Mächte seiner Zeit (westfränkische Karolinger, Byzanz, Papst), Fazit.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Chroniken von Widukind von Corvey, Liudprand von Cremona und Thietmar von Merseburg sowie aktuelle Biographien zu Otto dem Großen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Fortwirkens karolingischer Traditionen und Ottos Selbstverständnis in der Nachfolge Karls des Großen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Otto der Große, Kaisertum, Karolinger, Ostfrankenreich, Italienpolitik, Lechfeldschlacht, Byzanz, Papst, Widukind von Corvey, Liudprand von Cremona, Thietmar von Merseburg, karolingische Kontinuitäten, Reichsgewalt, Machtsicherung, europäische Geschichte.
Wie wird die Krönung Ottos I. in Aachen dargestellt?
Die Krönung Ottos I. in Aachen 936 wird als Ausdruck sowohl der karolingischen Tradition als auch der Untermauerung seines Anspruchs auf Lothringen interpretiert. Die Arbeit vergleicht sie mit der Krönung seines Vaters Heinrichs, um Unterschiede in der Legitimation und dem Selbstverständnis der Herrschaft hervorzuheben. Widukinds Darstellung der Krönung und die Frage der fränkischen und sächsischen Elemente in Ottos Herrschaft werden analysiert.
Welche Rolle spielt die Italienpolitik Ottos des Großen?
Die Italienpolitik wird als wichtiger Bestandteil der Machtsicherung Ottos des Großen betrachtet und ausführlich behandelt.
Wie wird das Verhältnis Ottos des Großen zu anderen Mächten beschrieben?
Die Arbeit untersucht detailliert das Verhältnis Ottos des Großen zu den westfränkischen Karolingern, Byzanz und dem Papsttum.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im Kapitel VI zusammengefasst und beleuchtet die Ergebnisse der Analyse von Ottos Herrschaft im Kontext der karolingischen Traditionen und des europäischen Machtgefüges seiner Zeit.
- Quote paper
- Daniel Scholaster (Author), 2013, Otto der Große und das Kaisertum im Abendland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444413