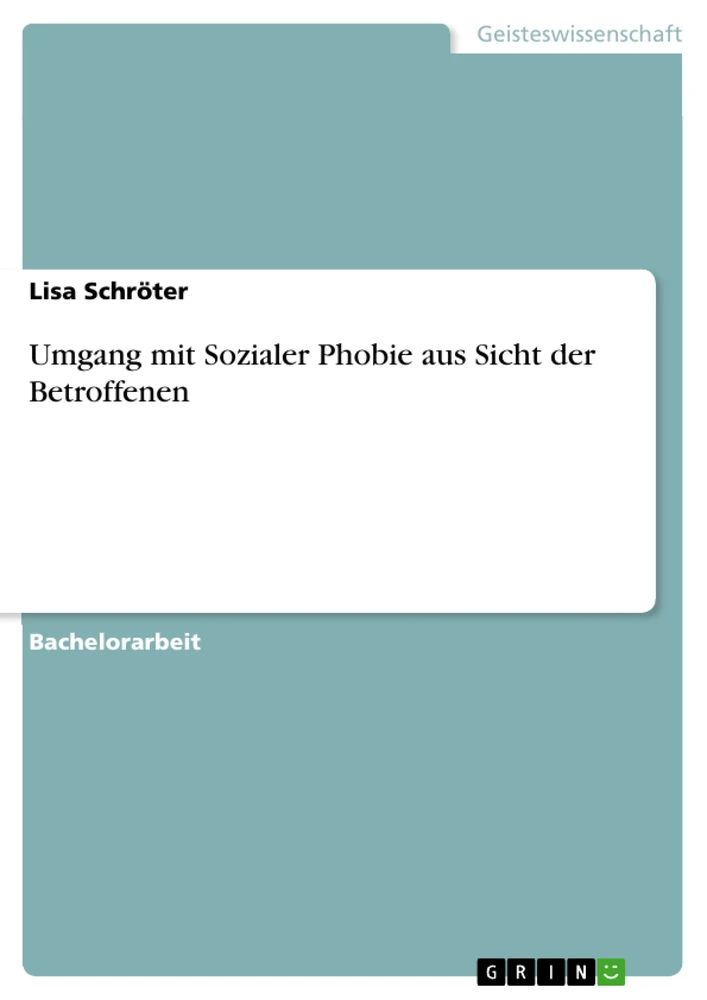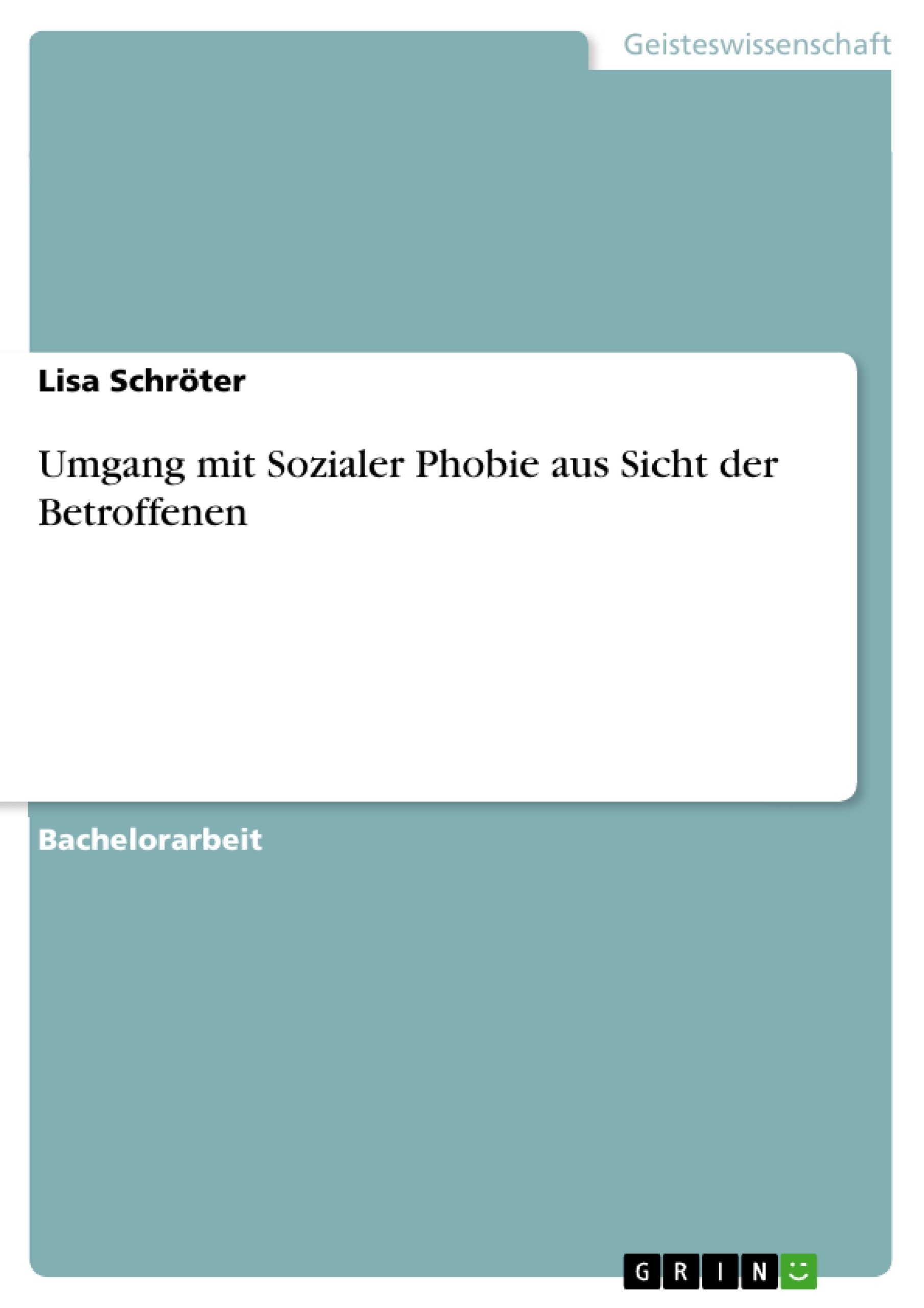Ziel dieser Arbeit ist es darzulegen, wie mit der „Ambivalenz zwischen Isolation und dem Wunsch nach sozialer Interaktion“ umgegangen wird. Damit ist gemeint, wie Betroffene den Zwiespalt, zwischen der Angst vor Menschen und dem Bedürfnis in Austausch zu treten, empfinden und bewältigen können. In Bezug dazu wird aufgefasst, welche Methoden dem Leidtragenden helfen, sich im Alltag zurechtzufinden und potentiell dazu beitragen können, die soziale Phobie zu überwinden. Zusätzlich geht es darum das Verständnis der Problematik zu vermitteln. Weiterhin gibt es das Bestreben eine tolerantere Haltung gegenüber Menschen zu entwickeln, die aufgrund von bestehenden Ängsten, entgegen den gesellschaftlichen Erwartungen handeln.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem der übermäßigen Angst, mit Menschen in Kontakt zu treten oder von ihnen beobachtet zu werden. Für Betroffene der sozialen Phobie erweisen sich einfache Alltagssituationen, wie Einkaufen oder das Essen in der Öffentlichkeit, als nicht zu bestehende Herausforderungen. Durch konstantes Vermeidungsverhalten von angstbesetzten Situationen geraten Sozialphobiker in einenKreislauf, der die Phobie verstärkt.
Das Ausmaß der sozialen Phobie kann dazu führen, dass Betroffene ihr ganzes Leben mit einem andauernden Gefühl der Einsamkeit verbringen. Der dauerhafte Angstzustand vor sozialen Situationen beeinträchtigt den Leidenden nicht nur in seinem Verhalten, sondern auch in Denkprozessen. Zusätzlich zeigt sich die Phobie anhand von starken körperlichen Reaktionen die ein Unwohlsein hervorrufen. Das pausenlose Gefühl von Minderwertigkeit, welches sich beispielsweise durch Gedanken wie: „Ich bin nicht gut genug.“ oder „Was ist, wenn ich es nicht schaffe und ich mich blamiere?“ zeigen, tragen dazu bei, das angstbesetzte Verhalten aufrecht zu halten.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung/Abstract
- Einleitung
- Stand der Forschung
- Fragestellung
- Phobische Störung
- Soziale Phobie
- Diagnostik und Klassifizierung
- Symptomatik
- Subtypen
- Epidemiologie und Verlauf
- Soziodemographische Daten
- Störungsbeginn und Verlauf
- Komorbidität
- Erklärungsmodelle und Aufrechterhaltung
- Entstehung
- Aufrechterhaltung
- Intervention
- Methode
- Datenerhebung
- Qualitative methodische Vorgehensweise
- Gütekriterien
- Problemzentriertes Interview
- Konstruktion des Interviewleitfadens
- Datenauswertungsmethode
- Zusammenfassende Inhaltsanalyse
- Kategoriensystem
- K1 aktiver Umgang mit der Erkrankung
- K2 unterstützender Faktor
- K3 schützender Faktor
- Auswahl der Interviewpartner und Ablauf des Interviews
- Ergebnisse
- Darstellung der Kategorien
- Interpretation
- Fazit
- Ausblick
- Limitation
- Literaturverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den effektiven Umgang mit sozialer Phobie aus der Perspektive der Betroffenen. Sie konzentriert sich auf die individuellen Bewältigungsstrategien im Alltag und deren Zusammenhang mit bestehenden Therapiemethoden. Die Arbeit zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Problematik zu schaffen und eine tolerantere Haltung gegenüber Menschen mit sozialen Ängsten zu fördern.
- Individuelle Umgangsformen mit sozialer Phobie im Alltag
- Der Zusammenhang zwischen Bewältigungsstrategien und Therapiemethoden
- Die Rolle von Konfrontation und sozialer Unterstützung bei der Bewältigung
- Die Bedeutung von Selbstbestätigung und Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen
- Das Spannungsfeld zwischen Isolation und dem Wunsch nach sozialer Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung beschreibt das Problem der sozialen Phobie und die Schwierigkeiten, die Betroffene im Alltag erleben. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, den persönlichen Umgang mit der Erkrankung zu untersuchen, da aktuelle Forschungen diesen Aspekt unzureichend beleuchten. Das Ziel der Arbeit wird klar definiert: die Erforschung von Bewältigungsstrategien und deren Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen, sowie die Förderung eines verständnisvolleren Umgangs mit der Störung.
Soziale Phobie: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die soziale Phobie, einschließlich ihrer Diagnostik, Klassifizierung, Epidemiologie, Komorbidität und Erklärungsmodelle. Es beschreibt die Symptomatik, verschiedene Subtypen der Störung, den Verlauf der Erkrankung und mögliche Begleiterkrankungen. Die Erläuterung der Erklärungsmodelle und Aufrechterhaltungsmechanismen liefert eine wichtige Grundlage für das Verständnis der individuellen Bewältigungsstrategien, die in den folgenden Kapiteln untersucht werden. Die Erwähnung von Interventionsmöglichkeiten unterstreicht den praktischen Bezug der Forschung.
Methode: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die angewandte Methodik der qualitativen Forschung. Es erläutert die qualitative methodische Vorgehensweise, die Gütekriterien, die Wahl des problemzentrierten Interviews und die Konstruktion des Interviewleitfadens. Die Zusammenfassende Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren wird genauestens dargestellt, und das Kategoriensystem mit den drei Hauptkategorien (aktiver Umgang, unterstützende und schützende Faktoren) wird vorgestellt. Die Beschreibung der Auswahl der Interviewpartner und des Interviewablaufs sorgt für die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Studie.
Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse. Es werden die Ergebnisse der drei Kategorien (aktiver Umgang, unterstützende und schützende Faktoren) detailliert vorgestellt. Die Interpretation der Ergebnisse fokussiert sich auf die Schlüsselfaktoren, die den Umgang mit der sozialen Phobie erleichtern oder erschweren. Die Darstellung der Ergebnisse zeigt, wie die Interviewdaten die anfänglichen Hypothesen der Studie bestätigen oder widerlegen.
Schlüsselwörter
Soziale Phobie, Angststörung, Bewältigungsstrategien, Qualitative Forschung, Problemzentriertes Interview, Inhaltsanalyse, Konfrontation, Soziale Unterstützung, Selbstwirksamkeit, Isolation, Soziale Interaktion, Therapiemethoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Umgang mit sozialer Phobie
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Umgang mit sozialer Phobie aus der Perspektive der Betroffenen. Der Fokus liegt auf den individuellen Bewältigungsstrategien im Alltag und deren Zusammenhang mit bestehenden Therapiemethoden. Ziel ist ein besseres Verständnis der Problematik und die Förderung einer toleranteren Haltung gegenüber Menschen mit sozialen Ängsten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Themenschwerpunkte: individuelle Umgangsformen mit sozialer Phobie im Alltag, den Zusammenhang zwischen Bewältigungsstrategien und Therapiemethoden, die Rolle von Konfrontation und sozialer Unterstützung, die Bedeutung von Selbstbestätigung und Vertrauen, sowie das Spannungsfeld zwischen Isolation und dem Wunsch nach sozialer Interaktion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Zusammenfassung/Abstract, Einleitung (mit Stand der Forschung und Fragestellung), Soziale Phobie (Diagnostik, Epidemiologie, Komorbidität, Erklärungsmodelle und Intervention), Methode (Datenerhebung, -auswertung und Kategoriensystem), Ergebnisse (Darstellung und Interpretation der Kategorien) und Fazit (Ausblick und Limitationen). Zusätzlich enthält sie ein Literaturverzeichnis, ein Tabellenverzeichnis und ein Abbildungsverzeichnis.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode. Die Datenerhebung erfolgte mittels problemzentrierter Interviews. Die Daten wurden mit einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ausgewertet, wobei ein Kategoriensystem mit den Kategorien "aktiver Umgang mit der Erkrankung", "unterstützender Faktor" und "schützender Faktor" verwendet wurde.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden im entsprechenden Kapitel detailliert dargestellt und interpretiert. Der Fokus liegt auf den Schlüsselfaktoren, die den Umgang mit sozialer Phobie erleichtern oder erschweren. Die Interpretation zeigt, wie die Interviewdaten die anfänglichen Hypothesen der Studie bestätigen oder widerlegen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Phobie, Angststörung, Bewältigungsstrategien, Qualitative Forschung, Problemzentriertes Interview, Inhaltsanalyse, Konfrontation, Soziale Unterstützung, Selbstwirksamkeit, Isolation, Soziale Interaktion, Therapiemethoden.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen, gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und benennt Limitationen der Studie.
- Quote paper
- Lisa Schröter (Author), 2018, Umgang mit Sozialer Phobie aus Sicht der Betroffenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444049