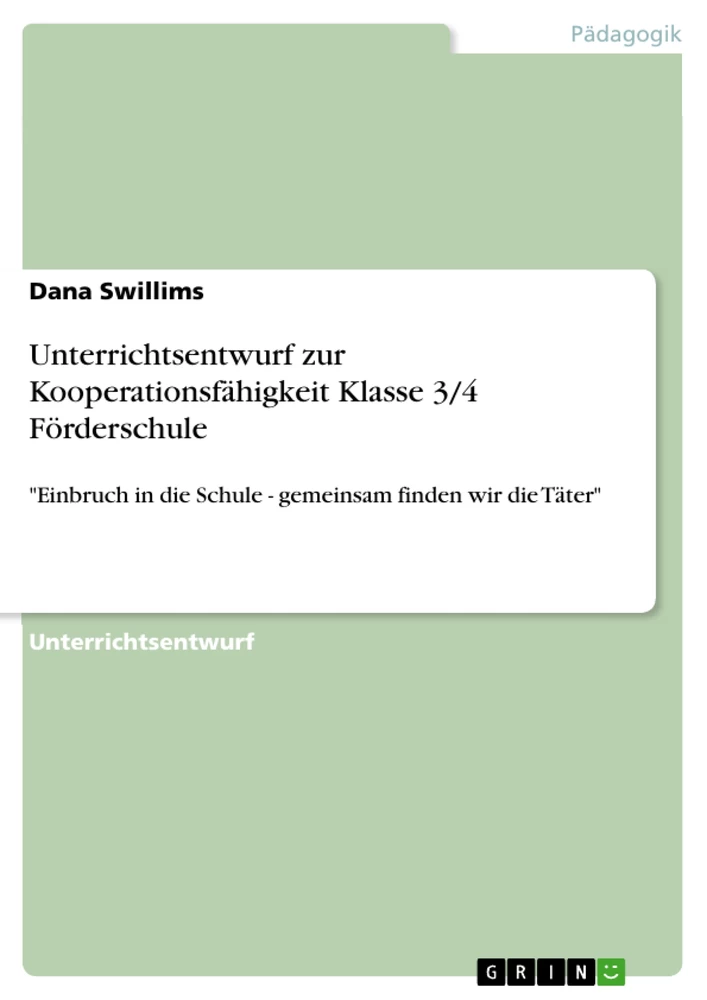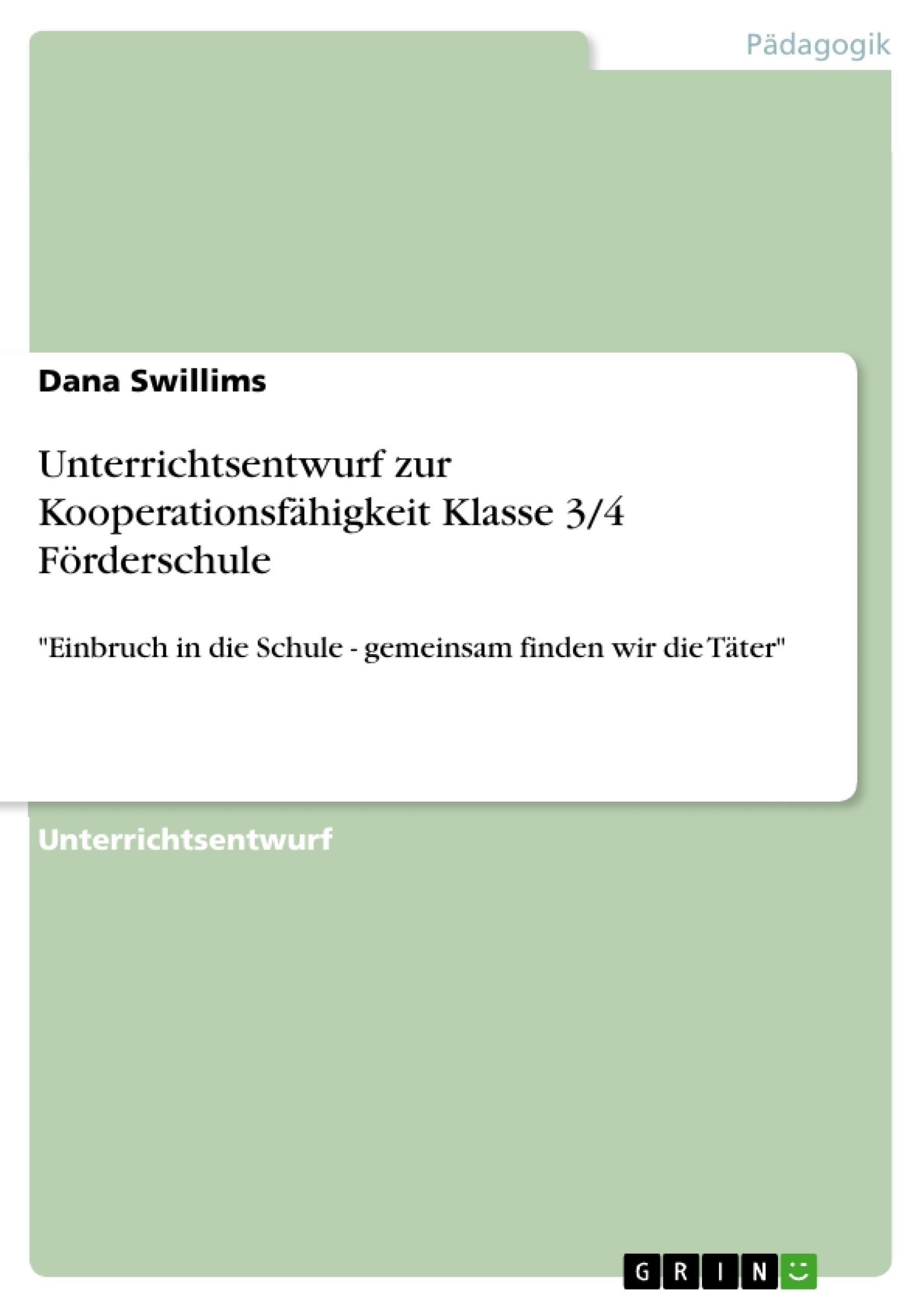Im Unterricht mit Schülern mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE) und Lernen (LE) erweisen sich klar strukturierte, offene Unterrichtsformen als geeignet, um sowohl sozial-emotionale als auch fachliche Kompetenzen aufzubauen und zu erweitern. Nach Heck kommt das kooperative Lernen eben dieser Förderung der Strukturiertheit nach, welche besonders im Unterricht einer heterogenen Lerngruppe sowie zur Förderung von Schülern mit einem Förderbedarf eine Grundvoraussetzung darstellt.
In der Fachliteratur existieren unterschiedliche Definitionen zum kooperativen Lernen. Übereinstimmung zeigen diese darin, dass nicht jede Form von Gruppen- oder Partnerarbeit mit kooperativem Lernen gleichgesetzt werden kann. „Gruppenarbeit bezeichnet lediglich die Tatsache, dass Schüler zu einer bestimmten Zeit etwas zusammen erledigen, sie können dabei kooperieren, müssen es aber nicht“. Kooperatives Lernen hingegen wird definiert als „eine Interaktionsform, bei der die beteiligten Personen gemeinsam und in wechselseitigem Austausch Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. Im Idealfall sind alle Gruppenmitglieder gleichberechtigt am Lerngeschehen beteiligt und tragen gemeinsam Verantwortung“ (Konrad/Traub 2010), um den maximalen Lernerfolg für alle zu erzielen.
Die Lernaufgabe sollte es dabei notwendig machen, dass die Schüler zusammenarbeiten müssen, um ein vorgegebenes Lernziel zu erreichen. Kooperatives Lernen wird dabei nicht als Unterrichtsmethode, sondern als Unterrichtsstruktur verstanden, innerhalb derer heterogene Lerngruppen individuelle und gemeinsame Lernziele in einem Wechsel von kooperativen individuellen Lernphasen erreichen.
Die vorliegende Unterrichtsreihe ist entsprechend des Dreischritts „Denken – Austauschen – Vorstellen“ als Grundlage der kooperativen Arbeit nach Brüning/Saum konzipiert. Das bedeutet, dass die Schüler sich zunächst Inhalte in Einzelarbeit erschließen, sich darüber in Kleingruppen austauschen, um abschließend die Ergebnisse im Klassenverband vorzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- A Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- A 1 Aufbau der Unterrichtsreihe
- A 1.1 Theoretische Darstellung zum Entwicklungs- bzw. Förderbereich
- A 1.2 Theoretische Darstellung zum unterrichtsfachlichen Bereich
- A 1.3 Rahmenbedingungen für das (gemeinsame) Lernen
- A 1.4 Analyse des Zielschwerpunktes (Förderziel, Fachziel)
- B Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde
- B 1 Zielsetzung der Unterrichtsstunde
- B 1.1 Zentrale Zielsetzung der Unterrichtsstunde (förderzielorientiertes Ziel)
- B 1.2 Weitere Zielsetzung der Unterrichtsstunde (fachliches Ziel)
- B 1.3 Zielorientierte Handlungsschritte
- B 2 Begründungszusammenhang
- B 2.1 Begründung von Zielsetzung und Thema
- B 2.2 Lernausgangslage der Schüler
- B 2.3 Maßnahmen zur Differenzierung
- B 3 Verlaufsplanung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese schriftliche Arbeit beschreibt eine Unterrichtsreihe zum Thema "Einbruch in der Schule - gemeinsam finden wir die Täter!" für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung. Die zentrale Zielsetzung liegt in der Förderung der Kooperationsfähigkeit durch die Entwicklung und Anwendung von Regeln für gemeinsames Arbeiten. Die Arbeit analysiert den theoretischen Hintergrund kooperativen Lernens und präsentiert eine detaillierte Unterrichtsplanung mit Fokus auf verstehendes Zuhören und soziales Handeln.
- Förderung der Kooperationsfähigkeit
- Entwicklung und Anwendung von Regeln für gemeinsames Arbeiten
- Förderung des verstehenden Zuhörens
- Soziales Handeln und Kommunikation in Gruppen
- Differenzierung im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
A Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge: Dieser Abschnitt legt den Grundstein für die gesamte Unterrichtsreihe. Er beschreibt den Aufbau der Reihe "Einbruch in der Schule", die darauf abzielt, die Kooperationsfähigkeit der Schüler zu fördern, indem sie Kriterien für gemeinsames Arbeiten entwickeln und anwenden. Es werden die einzelnen Unterrichtseinheiten skizziert, welche die Schüler schrittweise an die Anwendung der Regeln heranführen, von der Entwicklung von Detektivnamen bis hin zur Identifizierung der Täter. Der Abschnitt beleuchtet die theoretischen Grundlagen kooperativen Lernens und die Bedeutung von strukturierten Unterrichtsformen für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung.
A 1 Aufbau der Unterrichtsreihe: Hier wird die Unterrichtsreihe detailliert vorgestellt. Das Thema "Einbruch in der Schule" dient als Rahmenhandlung, um die Schüler bei der Erarbeitung und Anwendung von Regeln für kooperatives Lernen zu motivieren. Jede Einheit fokussiert auf einen Aspekt der Kooperation, wie z.B. freundliches Miteinander, aktives Zuhören und die Übernahme von Verantwortung. Die einzelnen Einheiten bauen aufeinander auf und ermöglichen eine schrittweise Entwicklung der Kooperationsfähigkeit. Der Abschnitt beschreibt die fachlichen und förderorientierten Zielsetzungen jeder Einheit.
A 1.1 Theoretische Darstellung zum Entwicklungs- bzw. Förderbereich: Dieser Teil befasst sich mit der theoretischen Fundierung der Unterrichtsreihe. Es wird erläutert, warum strukturierte und offene Unterrichtsformen besonders für Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung geeignet sind. Der Abschnitt definiert kooperatives Lernen, differenziert es von Gruppenarbeit und beschreibt die fünf Qualitätsmerkmale gelingenden kooperativen Lernens nach Johnson et al. (1993). Die Bedeutung der positiven Abhängigkeit, der persönlichen Verantwortungsübernahme und der sozialen Fähigkeiten wird hervorgehoben. Der Dreischritt „Denken - Austauschen – Vorstellen“ nach Brüning/Saum wird als Grundlage der kooperativen Arbeit vorgestellt.
B Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde: Dieser Kapitelteil konzentriert sich auf die detaillierte Planung einer einzelnen Unterrichtsstunde innerhalb der Reihe. Die Zielsetzung wird präzise formuliert, sowohl im Hinblick auf das Förderziel als auch das fachliche Ziel. Der Abschnitt beschreibt die Lernausgangslage der Schüler, die Maßnahmen zur Differenzierung und den geplanten Stundenverlauf. Der Begründungszusammenhang verdeutlicht die didaktischen Entscheidungen, die der Planung zugrunde liegen.
Schlüsselwörter
Kooperationsfähigkeit, kooperatives Lernen, verstehendes Zuhören, emotionale und soziale Entwicklung, Regeln, gemeinsames Arbeiten, Differenzierung, Unterrichtsplanung, Förderziel, Fachziel, heterogene Lerngruppe, Detektivgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtsreihe "Einbruch in der Schule"
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Diese schriftliche Arbeit beschreibt eine detaillierte Unterrichtsreihe zum Thema "Einbruch in der Schule - gemeinsam finden wir die Täter!" für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung. Der Fokus liegt auf der Förderung der Kooperationsfähigkeit durch die Entwicklung und Anwendung von Regeln für gemeinsames Arbeiten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Förderung der Kooperationsfähigkeit, die Entwicklung und Anwendung von Regeln für gemeinsames Arbeiten, die Förderung des verstehenden Zuhörens, soziales Handeln und Kommunikation in Gruppen sowie die Differenzierung im Unterricht. Die Unterrichtsreihe nutzt eine Detektivgeschichte als Rahmenhandlung, um die Schüler zu motivieren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile: Teil A beschreibt die längerfristigen Unterrichtszusammenhänge, einschließlich des Aufbaus der gesamten Unterrichtsreihe, der theoretischen Grundlagen kooperativen Lernens und der Rahmenbedingungen. Teil B konzentriert sich auf die detaillierte Planung einer einzelnen Unterrichtsstunde innerhalb der Reihe, inklusive Zielsetzung, Begründungszusammenhang und Verlaufsplanung.
Welche theoretischen Grundlagen werden berücksichtigt?
Die Arbeit stützt sich auf theoretische Grundlagen kooperativen Lernens, insbesondere die fünf Qualitätsmerkmale gelingenden kooperativen Lernens nach Johnson et al. (1993) und den Dreischritt „Denken - Austauschen – Vorstellen“ nach Brüning/Saum. Es wird erläutert, warum strukturierte und offene Unterrichtsformen besonders für Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung geeignet sind.
Wie ist die Unterrichtsstunde geplant?
Die Planung der Unterrichtsstunde umfasst die präzise Formulierung von Förder- und Fachzielen, die Beschreibung der Lernausgangslage der Schüler, Maßnahmen zur Differenzierung und den detaillierten Stundenverlauf. Der Begründungszusammenhang erläutert die didaktischen Entscheidungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kooperationsfähigkeit, kooperatives Lernen, verstehendes Zuhören, emotionale und soziale Entwicklung, Regeln, gemeinsames Arbeiten, Differenzierung, Unterrichtsplanung, Förderziel, Fachziel, heterogene Lerngruppe, Detektivgeschichte.
Für welche Schülergruppe ist die Unterrichtsreihe konzipiert?
Die Unterrichtsreihe ist speziell für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung konzipiert.
Welche Ziele werden in der Unterrichtsreihe verfolgt?
Die zentrale Zielsetzung ist die Förderung der Kooperationsfähigkeit der Schüler. Zusätzliche Ziele umfassen die Entwicklung und Anwendung von Regeln für gemeinsames Arbeiten, die Förderung des verstehenden Zuhörens und das soziale Handeln in Gruppen.
Wie wird die Differenzierung im Unterricht berücksichtigt?
Die Arbeit beschreibt Maßnahmen zur Differenzierung im Unterricht, um den individuellen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden. Konkrete Maßnahmen werden im Kapitel zur Unterrichtsplanung detailliert dargestellt.
Wie wird das Thema "Einbruch in der Schule" im Unterricht eingesetzt?
Das Thema "Einbruch in der Schule" dient als motivierende Rahmenhandlung, um die Schüler bei der Erarbeitung und Anwendung von Regeln für kooperatives Lernen zu unterstützen. Die einzelnen Unterrichtseinheiten bauen aufeinander auf und führen die Schüler schrittweise an die Anwendung der Regeln heran.
- Citar trabajo
- Dana Swillims (Autor), 2017, Unterrichtsentwurf zur Kooperationsfähigkeit Klasse 3/4 Förderschule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443734