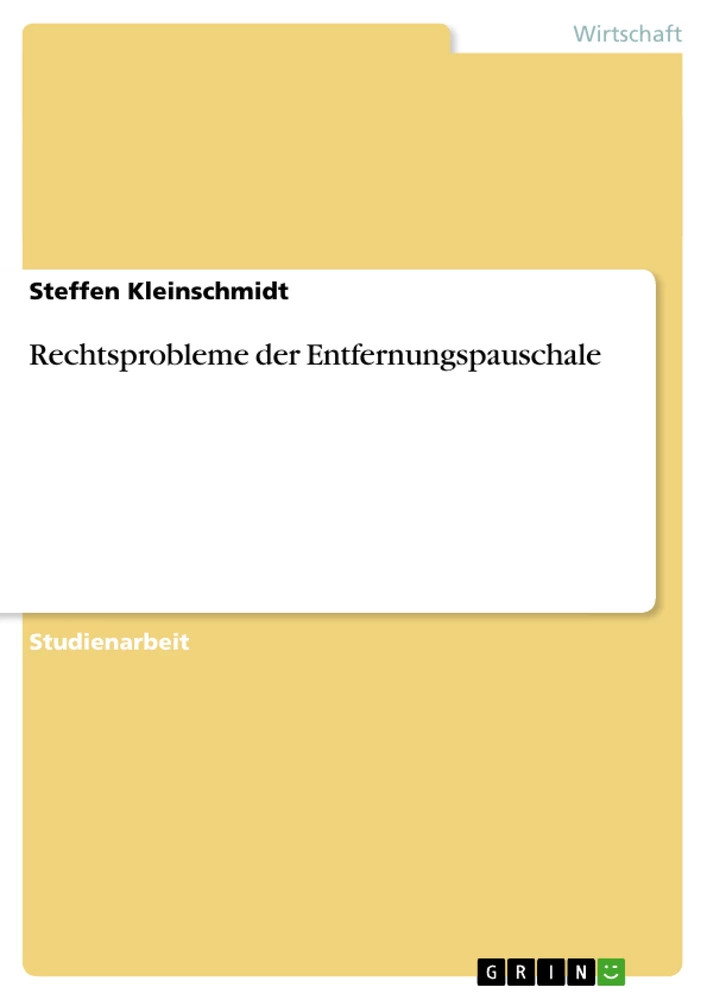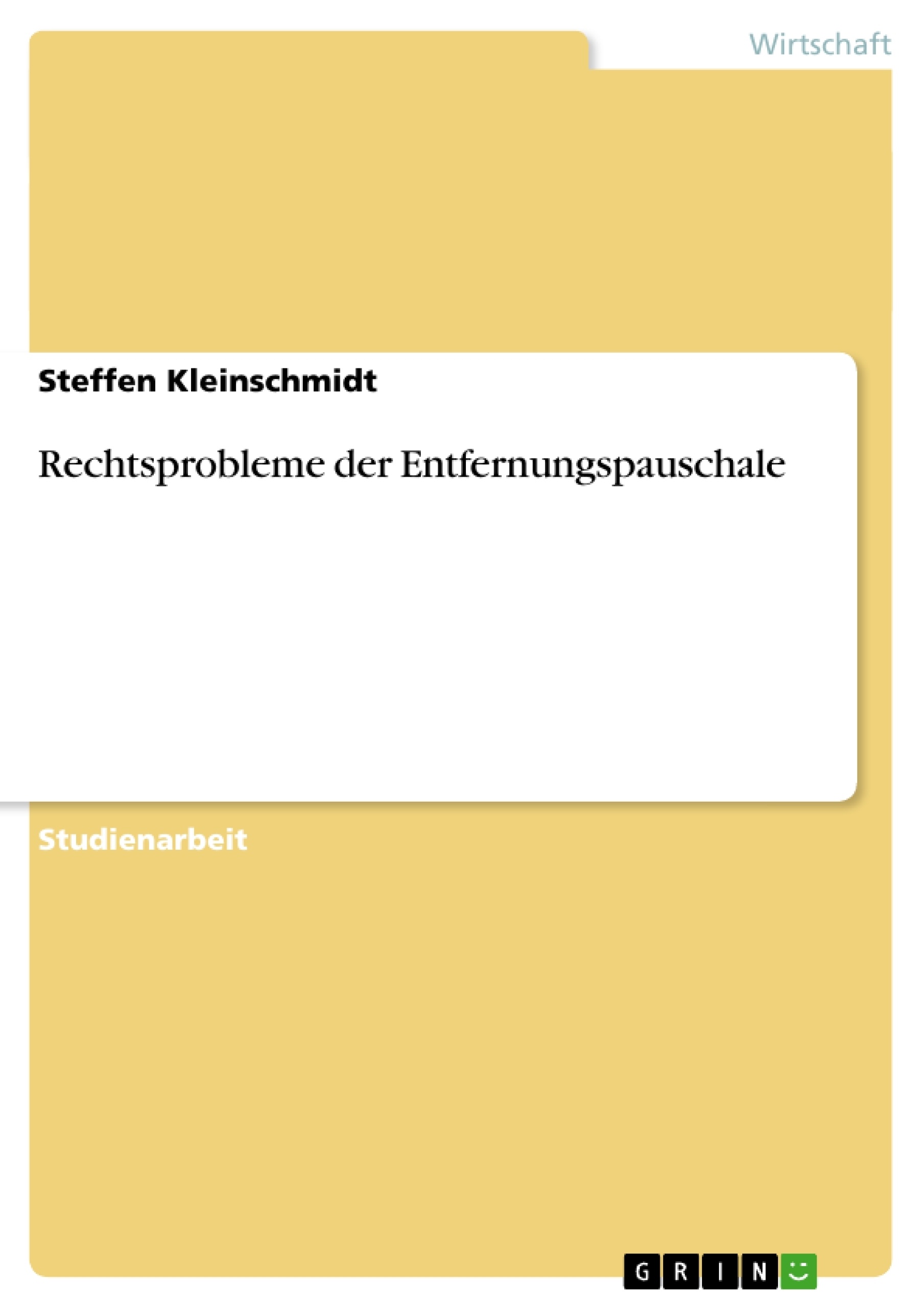Im folgenden Text soll erörtert werden, ob es sich bei der Entfernungspauschale um eine Subvention oder um Werbungskosten handelt. Wenn eine eindeutige Abgrenzung dahingehend getroffen werden könnte, wäre somit eine Antwort auf die Frage gefunden, ob die Abschaffung der Entfernungspauschale sinnvoll und juristisch zu vertreten ist.
Einige führende Politiker und Steuerexperten sind der Ansicht, dass nur ein einfaches Steuersystem auch ein gerechtes sein kann. Um diese Vereinfachung zu erreichen, müssten sämtliche Steuervergünstigungen wegfallen.
Stellt die Entfernungspauschale überhaupt eine solche Vergünstigung dar? Dies wäre der Fall, wenn die Kosten für Wege zwischen Wohn- und Arbeitsstätte nicht rein beruflich veranlasst wären, sondern teilweise oder sogar ganz der privaten Lebensführung zuzuordnen wären. Die hierzu notwendige Abgrenzung von Privat- und Berufsphäre ist allerdings als schwierig zu betrachten, da sie weder gesetzlich geregelt ist, noch allgemein betrachtet werden kann.
Ob diese gesetzliche Regelung überhaupt sozial und juristisch gerecht ist, wird anhand eines Beschlusses des Bundesfinanzhofes2 im Verlauf dieser Arbeit noch zu erörtert sein. Grundsätzlich widerspricht eine Pauschalierung einer solchen Gerechtigkeit. Es werden diejenigen begünstigt, die entweder keine Pendlerkosten haben, weil sie zum Beispiel zu Fuß oder in einer unentgeltlichen Fahrgemeinschaft zur Arbeit kommen, oder geringere Pendlerkosten haben, als sie pauschal absetzen können.
Auf der anderen Seite werden diejenigen benachteiligt, die doppelte Aufwendungen haben. Laut BFH-Rechtsprechung kann zum Beispiel ein Opernsänger, auch wenn er mehrere Fahrten täglich zu ein und derselben Arbeitsstätte hat, diese ihm dadurch entstandenen Kosten nur einmal ansetzen.
Der Gesetzgeber hat somit über die Entfernungspauschale den einfachen Weg arbeitstäglich einmal abgegolten. Warum nur der einfache Weg als erwerbswirtschaftlicher Aufwand angesehen wird ist allerdings fraglich. Es wird zum Teil die Auffassung vertreten, dass der Weg von der Wohnung zum Arbeitsplatz beruflich bedingt und folglich steuerlich absetzbar ist. Ein Weg von der Arbeitsstätte zurück zur Wohnung entspricht hingegen privater Natur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung – Vom Kilometerpauschbetrag zur Entfernungspauschale
- Die Entfernungspauschale – Subvention oder Werbungskosten ?
- Der Subventionsbegriff
- Werbungskosten
- Das Nettoprinzip
- Problematik der Abgrenzung von beruflich und privat veranlassten Aufwendungen
- Gesetzliche Bestimmungen der §§ 4, 9 und 12 EStG
- Wahl des Wohnortes
- Sonderfall: eindeutige Subvention
- Folgeprobleme der derzeitigen Rechtssprechung
- Ökologische Probleme
- Juristische Probleme
- Fallbeispiel: Opernsänger
- Sachverhalt
- Entscheidungsgründe des BFH
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beleuchtet die Rechtsprobleme der Entfernungspauschale und untersucht, ob es sich bei dieser um eine Subvention oder Werbungskosten handelt. Sie befasst sich mit der Abgrenzung zwischen beruflich und privat veranlassten Aufwendungen, den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Folgeproblemen der aktuellen Rechtsprechung.
- Abgrenzung der Entfernungspauschale zwischen Subvention und Werbungskosten
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Entfernungspauschale
- Problematik der Abgrenzung von beruflich und privat veranlassten Aufwendungen
- Folgeprobleme der aktuellen Rechtsprechung, insbesondere ökologische und juristische Aspekte
- Analyse eines Fallbeispiels zum Thema Entfernungspauschale
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Fragestellung dar, ob die Entfernungspauschale eine Subvention oder Werbungskosten darstellt und die Relevanz der eindeutigen Abgrenzung für die Sinnhaftigkeit einer möglichen Abschaffung. Die Einleitung betont zudem die Problematik der Abgrenzung zwischen Privat- und Berufsphäre.
- Historische Entwicklung: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Entfernungspauschale vom Kilometerpauschbetrag.
- Die Entfernungspauschale – Subvention oder Werbungskosten?: Dieses Kapitel behandelt die Definition des Subventionsbegriffs, Werbungskosten sowie das Nettoprinzip. Es analysiert die Problematik der Abgrenzung von beruflich und privat veranlassten Aufwendungen anhand der gesetzlichen Bestimmungen der §§ 4, 9 und 12 EStG sowie die Bedeutung der Wahl des Wohnorts. Darüber hinaus wird der Sonderfall einer eindeutigen Subvention erläutert.
- Folgeprobleme der derzeitigen Rechtssprechung: Der Abschnitt beleuchtet ökologische und juristische Folgeprobleme, die sich aus der derzeitigen Rechtsprechung ergeben. Ein Fallbeispiel eines Opernsängers verdeutlicht die Problematik und die Entscheidungsgründe des Bundesfinanzhofs.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den Rechtsproblemen der Entfernungspauschale. Schwerpunkte bilden die Abgrenzung zwischen Subvention und Werbungskosten, die rechtlichen Rahmenbedingungen der Entfernungspauschale, die Problematik der Abgrenzung von beruflich und privat veranlassten Aufwendungen sowie die ökologischen und juristischen Folgeprobleme der aktuellen Rechtsprechung. Wichtige Begriffe sind Entfernungspauschale, Subvention, Werbungskosten, Nettoprinzip, §§ 4, 9 und 12 EStG, Wohnortwahl, Fallbeispiel, BFH-Rechtsprechung.
- Quote paper
- Steffen Kleinschmidt (Author), 2004, Rechtsprobleme der Entfernungspauschale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44312