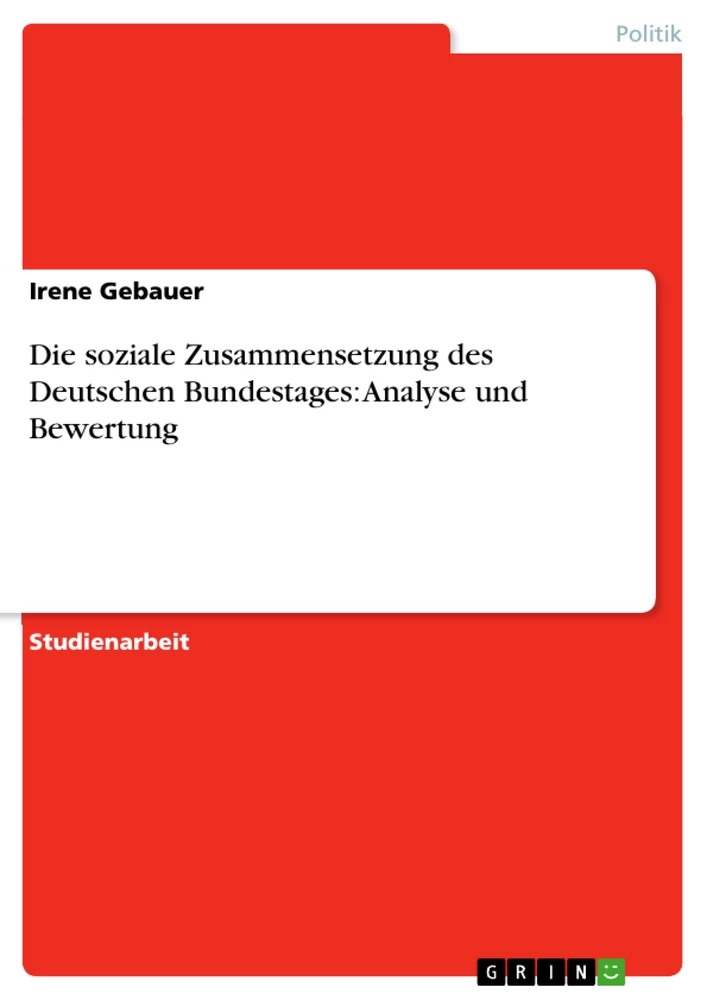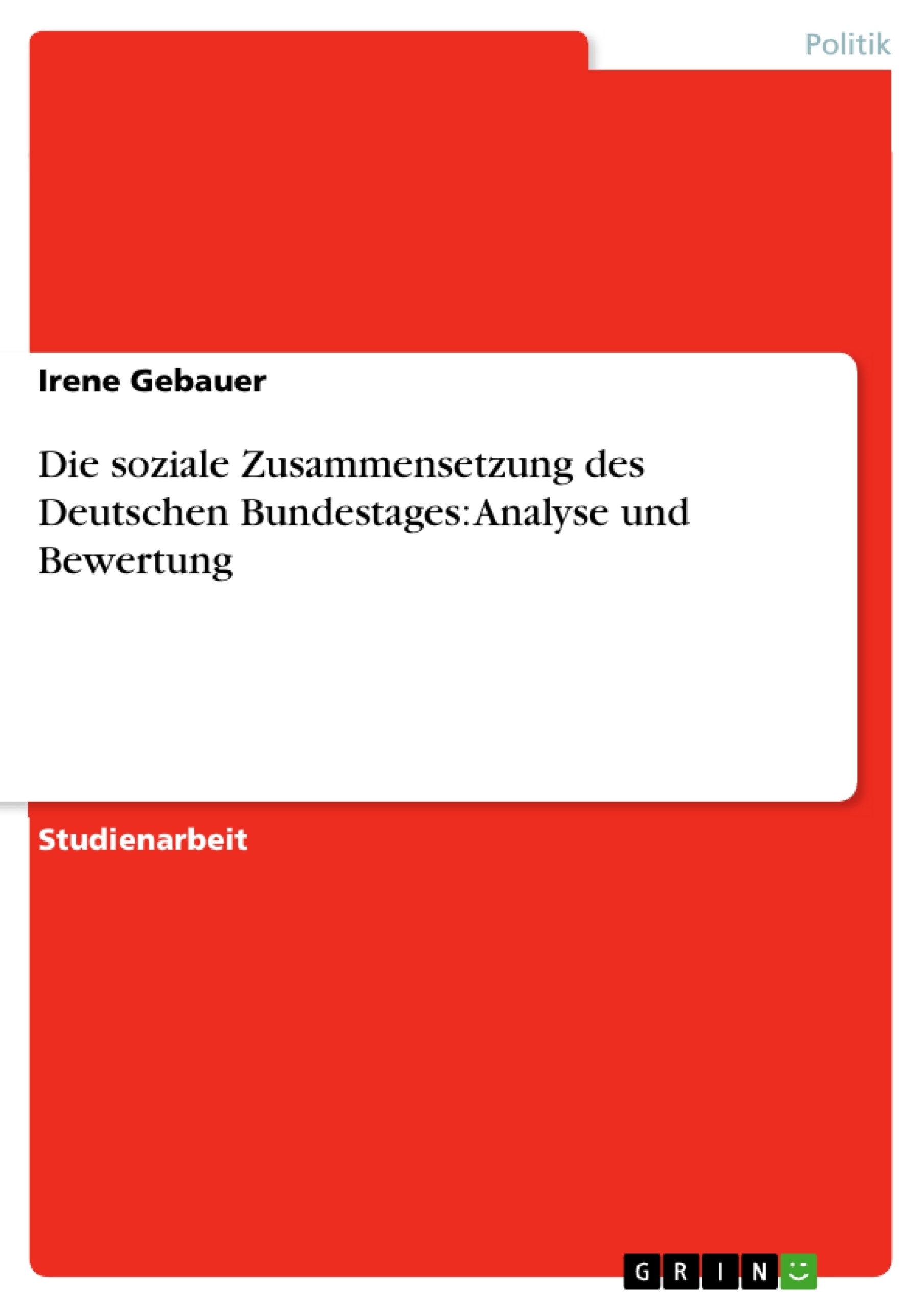„Ein Parlament wird vom Volk (...) erst dann als repräsentativ empfunden, wenn in ihm alle Schichten und Berufe der Gesellschaft vertreten sind. Der Deutsche Bundestag leidet nicht so sehr an Fleiß, gutem Willen und Charakter, es fehlen ihm aber Repräsentanten der Eliten, und es fehlen Frauen und Arbeiter.“
Dieser Ausspruch eines ehemaligen Mitgliedes des Deutschen Bundestages spricht vielen Bürgern der Bundesrepublik förmlich aus dem Herzen. Denn in Bezug auf die Repräsentativität entspricht die Zusammensetzung der Bundestagsabgeordneten weder nach Beruf, Alter oder Geschlecht der Verteilung in der Bevölkerung, die „soziale Struktur der Bevölkerung wird nicht einmal annähernd wiedergespiegelt“. Aber trifft diese Sicht auf die soziale Zusammensetzung des Bundestages wirklich den Kern des Problems? Ob und inwieweit muss denn das Parlament in seiner Zusammensetzung wirklich die Bevölkerung wiederspiegeln?
Wie das erste Kapitel zeigen wird, ist diese oft beschworene rigorose Spiegelbildlichkeit weder herstellbar noch sinnvoll. Es muss in einer abschließenden Bewertung vielmehr geklärt werden, ob die Zusammensetzung des Parlaments ein ausreichendes Maß an personeller Mobilität gewährleistet oder ob sie der „Bildung geschlossener Eliten Vorschub leistet“.
Um sich schrittweise an die Beantwortung dieser Fragen annähern zu können, besteht der nächste Teil diese Arbeit in einer Art historischen Rückblende. Der Fokus richtet sich dabei vor allem auf die Frankfurter Nationalversammlung als erster „politischer Gesamtvertretung“ des deutschen Volkes und auf die politische Ausgangssituation nach Ende des Dritten Reiches, auf deren Boden sich die soziale Zusammensetzung des Deutschen Bundestages entwickeln wird. Wichtigste Frage ist dabei, ob es schon zu Zeiten der Paulskirche Entwicklungen oder Probleme gab, die sich bis in die Gegenwart fortgesetzt haben.
Diesem Teil wird sich eine ausführliche Analyse der Berufs- und Alterstruktur anschließen, gefolgt von einer kritischen Prüfung des Geschlechterverhältnisses. Der zu untersuchende Zeitraum reicht dabei von der 1. Wahlperiode [im folgenden: WP] (1949-53) bis zur 13. WP (1994-98), da ab da eine einheitliche Zusammenstellung der Daten durch Peter Schindler im „Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages 1949-1999“ nicht mehr vorliegt.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Deutsche Bundestag – Spiegelbild der Bevölkerung?
- 2. Historische Heranführung: Die soziale Zusammensetzung deutscher Parlamente ab 1848
- 2.1 Von der Paulskirche bis zum Beginn des Dritten Reiches
- 2.2 Die Ausgangslage 1945
- 3. Die Berufsstruktur
- 3.1 Theoretische Grundannahmen zur Erfassung der Berufsstruktur
- 3.2 Überrepräsentierte Berufsgruppen im Deutschen Bundestag
- 3.2.1 Beamte und Angestellte des Öffentlichen Dienstes
- 3.2.2 Angestellte politischer und gesellschaftlicher Organisationen
- 3.2.3 Selbständige und Angehörige freier Berufe
- 3.3 Unterrepräsentierte Berufsgruppen im Deutschen Bundestag
- 4. Die Altersstruktur
- 4.1 Altersgliederung und Durchschnittalter
- 4.2 Anteil der Parlamentsneulinge, Dauer der Zugehörigkeit zum Parlament und Wiederwahlquote
- 5. Frauen im Bundestag
- 6. Abschließende Wertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziale Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und bewertet deren Repräsentativität. Sie analysiert die Berufsstruktur, Altersstruktur und das Geschlechterverhältnis der Abgeordneten im Kontext der deutschen Parlamentsgeschichte, insbesondere im Vergleich zur Bevölkerung. Die Studie hinterfragt das Ideal einer vollständigen Spiegelung der Bevölkerung im Parlament und untersucht die möglichen Auswirkungen der sozialen Zusammensetzung auf die Interessenvertretung im Bundestag.
- Repräsentativität des Deutschen Bundestages im Spiegel seiner sozialen Zusammensetzung
- Historische Entwicklung der sozialen Zusammensetzung deutscher Parlamente
- Analyse der Berufsstruktur der Bundestagsabgeordneten
- Untersuchung der Altersstruktur und der Fluktuation im Bundestag
- Die Rolle von Frauen im Deutschen Bundestag
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Zusammensetzung des Deutschen Bundestages ein und stellt die zentralen Forschungsfragen. Sie thematisiert die kontroverse Debatte um die Repräsentativität des Parlaments und die Frage, inwieweit die soziale Zusammensetzung das politische System beeinflusst. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die methodischen Vorgehensweisen, die zur Beantwortung der Forschungsfragen verwendet werden.
1. Der Deutsche Bundestag - Spiegelbild der Bevölkerung?: Dieses Kapitel befasst sich mit der grundlegenden Frage nach der Repräsentativität des Bundestages. Es hinterfragt das Ideal einer vollständigen Spiegelung der Bevölkerung im Parlament und diskutiert die theoretischen und praktischen Aspekte der Repräsentation. Es wird argumentiert, dass eine vollkommene Spiegelung weder herstellbar noch sinnvoll ist, und beleuchtet die Rolle der Parteien bei der Rekrutierung von Abgeordneten.
2. Historische Heranführung: Die soziale Zusammensetzung deutscher Parlamente ab 1848: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die soziale Zusammensetzung deutscher Parlamente, beginnend mit der Frankfurter Nationalversammlung. Es analysiert die Entwicklungen und Probleme, die sich von der Paulskirche bis zur Nachkriegszeit erstrecken, und legt die Grundlage für das Verständnis der heutigen Zusammensetzung des Bundestages. Der Fokus liegt auf Kontinuitäten und Brüchen in der Repräsentation verschiedener sozialer Gruppen.
3. Die Berufsstruktur: Dieses Kapitel analysiert die Berufsstruktur der Bundestagsabgeordneten über einen längeren Zeitraum. Es untersucht sowohl über- als auch unterrepräsentierte Berufsgruppen und beleuchtet die Gründe für diese Ungleichgewichte. Die Analyse berücksichtigt die Auswirkungen der Berufswelt auf die Kandidaturchancen und die Rolle der Parteien bei der Auswahl der Abgeordneten. Es werden detailliert verschiedene Berufsgruppen untersucht, um ihre jeweilige Repräsentation zu verstehen.
4. Die Altersstruktur: Das Kapitel widmet sich der Altersstruktur der Bundestagsabgeordneten. Es untersucht die Altersverteilung, das Durchschnittsalter, den Anteil von Parlamentsneulingen und die Wiederwahlquoten. Die Analyse beleuchtet die Auswirkungen der Altersstruktur auf die politische Dynamik und die Kontinuität im Parlament. Hier werden die Zusammenhänge zwischen Alter, Erfahrung und politischer Karriere beleuchtet.
5. Frauen im Bundestag: Dieses Kapitel untersucht die Repräsentation von Frauen im Deutschen Bundestag. Es analysiert den Frauenanteil über die Jahre und setzt sich mit den Ursachen für die Unterrepräsentation von Frauen in der Politik auseinander. Es beleuchtet mögliche strukturelle und kulturelle Faktoren und diskutiert mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichstellung.
Schlüsselwörter
Deutscher Bundestag, soziale Zusammensetzung, Repräsentativität, Berufsstruktur, Altersstruktur, Geschlechterverhältnis, Parlamentsgeschichte, Parteien, Interessenvertretung, politische Repräsentation, soziale Schichtung.
FAQ: Soziale Zusammensetzung des Deutschen Bundestages
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die soziale Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und bewertet deren Repräsentativität. Sie untersucht die Berufsstruktur, Altersstruktur und das Geschlechterverhältnis der Abgeordneten im historischen Kontext und im Vergleich zur Bevölkerung. Die Studie hinterfragt, inwieweit der Bundestag ein Spiegelbild der Bevölkerung ist und welche Auswirkungen die soziale Zusammensetzung auf die Interessenvertretung hat.
Welche Aspekte der sozialen Zusammensetzung werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei zentrale Aspekte: die Berufsstruktur der Abgeordneten (einschließlich über- und unterrepräsentierter Berufsgruppen), die Altersstruktur (Altersverteilung, Durchschnittsalter, Fluktuation) und das Geschlechterverhältnis (Frauenanteil und dessen Entwicklung).
Wie wird die Repräsentativität des Bundestages bewertet?
Die Arbeit hinterfragt das Ideal einer vollständigen Spiegelung der Bevölkerung im Parlament. Sie diskutiert theoretische und praktische Aspekte der Repräsentation und untersucht, ob und inwieweit die soziale Zusammensetzung die Interessenvertretung im Bundestag beeinflusst. Eine vollkommene Spiegelung wird dabei als weder herstellbar noch sinnvoll betrachtet.
Welche historische Perspektive wird eingenommen?
Die Arbeit bietet einen historischen Überblick über die soziale Zusammensetzung deutscher Parlamente seit 1848, beginnend mit der Frankfurter Nationalversammlung. Sie analysiert die Entwicklungen bis zur Gegenwart und beleuchtet Kontinuitäten und Brüche in der Repräsentation verschiedener sozialer Gruppen. Dies dient dem Verständnis der heutigen Zusammensetzung des Bundestages.
Welche Berufsgruppen sind im Bundestag über- bzw. unterrepräsentiert?
Die Arbeit untersucht detailliert über- und unterrepräsentierte Berufsgruppen. Zu den überrepräsentierten Gruppen zählen beispielsweise Beamte, Angestellte des öffentlichen Dienstes, Angestellte politischer und gesellschaftlicher Organisationen sowie Selbständige und Angehörige freier Berufe. Die Arbeit benennt konkrete Beispiele und analysiert die Ursachen dieser Ungleichgewichte.
Wie wird die Altersstruktur des Bundestages analysiert?
Die Analyse der Altersstruktur umfasst die Altersverteilung, das Durchschnittsalter, den Anteil von Parlamentsneulingen und die Wiederwahlquoten. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Altersstruktur auf die politische Dynamik und die Kontinuität im Parlament.
Wie wird die Rolle von Frauen im Bundestag behandelt?
Die Arbeit analysiert den Frauenanteil im Bundestag über die Jahre und untersucht die Ursachen für die Unterrepräsentation von Frauen in der Politik. Sie beleuchtet mögliche strukturelle und kulturelle Faktoren und diskutiert Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichstellung.
Welche methodischen Vorgehensweisen werden angewendet?
Die Arbeit benennt die methodischen Vorgehensweisen in der Einleitung. Die genaue Methodik wird im Detail im Haupttext erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutscher Bundestag, soziale Zusammensetzung, Repräsentativität, Berufsstruktur, Altersstruktur, Geschlechterverhältnis, Parlamentsgeschichte, Parteien, Interessenvertretung, politische Repräsentation, soziale Schichtung.
- Quote paper
- Irene Gebauer (Author), 2002, Die soziale Zusammensetzung des Deutschen Bundestages: Analyse und Bewertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44301