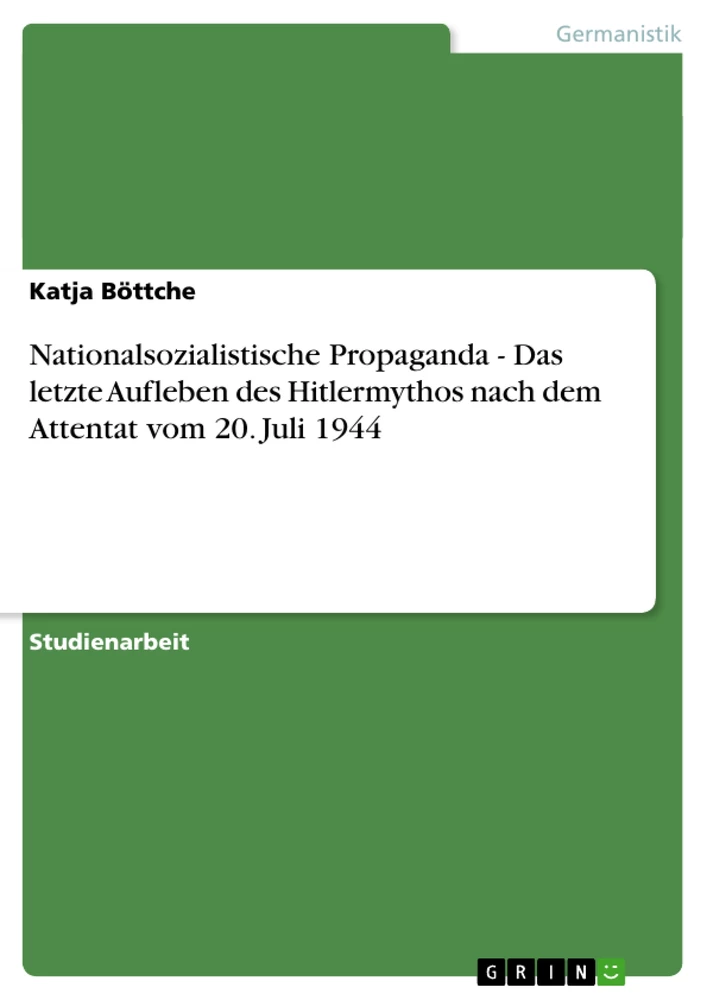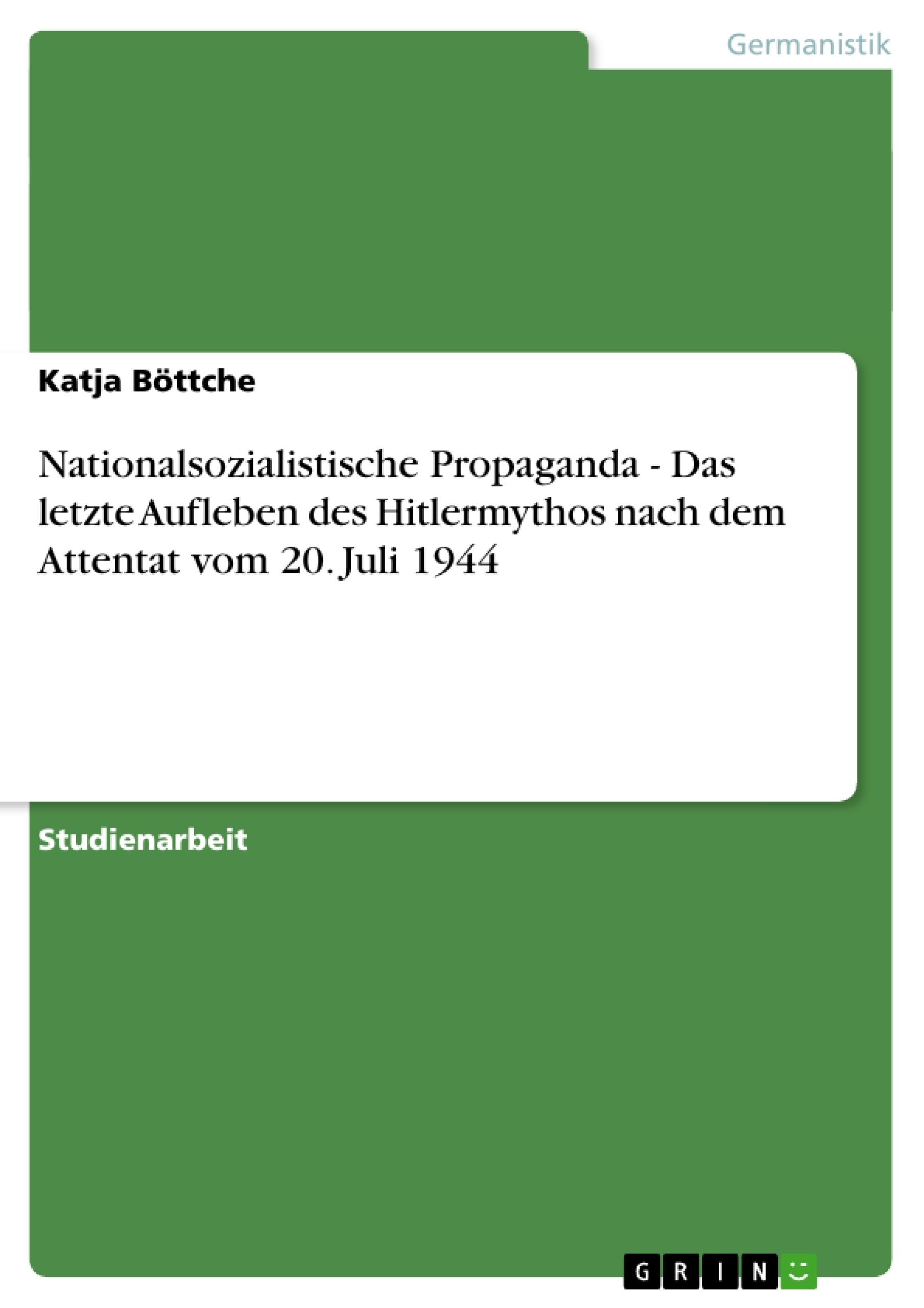„Das ist das Geheimnis der Propaganda: den, den die Propaganda fassen will, ganz mit den Ideen der Propaganda zu durchtränken, ohne daß er überhaupt merkt, daß er durchtränkt wird.“
Im Juli 2004 jährte sich zum sechzigsten Mal der Tag des Attentatsversuches auf Adolf Hitler. Mittlerweile findet die Tat der Verschwörer von damals allgemeine Anerkennung und wird als das geschätzt, was sie auch für diese verkörpert hatte: die Auflehnung des anderen Deutschlands gegen die Terrorherrschaft und das menschenunwürdige Vorgehen im Krieg.
Der Umgang mit dem Widerstand im Dritten Reich war von Anfang an schwierig, mit verschuldet auch durch die deutsche Teilung und die verschiedenen ideologischen Interessen auf beiden Seiten. Fest steht, dass vor allem die Tat vom 20. Juli, die in ihrer Vorbereitung über weite Kreise verschiedener Widerstandsgruppen gespannt war, bis in die fünfziger Jahre hinein von weiten Teilen der Bevölkerung als Vaterlandsverrat angesehen wurde. Erst mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht 1955 fand ein Umdenken statt und man instrumentalisierte die Tat der Militärs für seine Zwecke, um die positiven Tugenden des deutschen Militärs zu zeigen und zu betonen, dass sie es ja waren, die sich einst gegen Hitler auflehnten.
Wie kam es aber dazu, dass die deutsche Öffentlichkeit noch in den fünfziger Jahren im deutschen Widerstand nur den Hochverrat, nicht aber die heldenhaften Taten im Kampf gegen ein Unrechtsregime sah? Zum einen taten sich die Siegermächte schwer das andere Deutschland anzuerkennen und auch innerhalb der Nachkriegsgesellschaft bestand der Wunsch die Vergangenheit so schnell wie möglich zu vergessen. Einen großen Beitrag dazu hat wahrscheinlich auch die nationalsozialistische Propaganda geleistet, die besonders nach dem Attentatsversuch noch einmal in vollem Maße eingesetzt wurde, um die nationalsozialistische Sicht auf die Ereignisse zu verbreiten. Die vorliegende Arbeit will deshalb untersuchen, wie die Nationalsozialisten die Propaganda für ihre Zwecke eingesetzt und welche spezifischen Merkmale und Strategien sie dabei angewendet haben. Als konkretes Beispiel wird dabei die Rundfunkansprache Adolf Hitlers benutzt, die er noch am Abend des 20. Juli hielt, um sein Volk zu beruhigen. An dieser Rede soll untersucht werden, wie die Nationalsozialisten bis zum Schluss das gesprochene Wort für sich gebrauchten um die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen und zu beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung der Propaganda für die nationalsozialistische Herrschaft
- Definition des Begriffes
- Organisation
- Grundsätze und Formen
- Führermythos
- Das gesprochene Wort als bevorzugtes Propagandamittel
- Sprache
- Einsatz der Propaganda am Ende der Herrschaft – Hitlers Rundfunkansprache zum missglückten Attentat vom 20. Juli 1944
- Die Rede - Rundfunkansprache Adolf Hitlers zum 20. Juli 1944
- Textexterne Faktoren
- Der historische Hintergrund – Der Attentatsversuch vom 20. Juli 1944
- Der Produzent: Adolf Hitler
- Der Adressat: Das deutsche Volk
- Textfunktion und Textsorte
- Binnenstruktur
- Textthema
- Textinterne Faktoren
- Lexikalische Ebene
- Freund-Feind-Bild
- Pfeilerwörter
- Akkumulative Bezeichnungen
- „Volkstümliche“ Redewendungen
- Bildhafte Sprache
- Syntaktische Ebene
- Lexikalische Ebene
- Die propagandistischen Absichten des Textes und seine Wirkung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz von nationalsozialistischer Propaganda, insbesondere am Beispiel der Rundfunkansprache Adolf Hitlers vom 20. Juli 1944 nach dem gescheiterten Attentat. Ziel ist es, die Strategien und Merkmale dieser Propaganda zu analysieren und deren Wirkung auf die Bevölkerung zu beleuchten.
- Die Bedeutung der Propaganda für die nationalsozialistische Herrschaft
- Die Organisation und Strategien der nationalsozialistischen Propaganda
- Die sprachlichen Mittel und rhetorischen Techniken in Hitlers Rede
- Die Wirkung der Propaganda auf die deutsche Bevölkerung
- Der historische Kontext des Attentats vom 20. Juli 1944 und dessen Bedeutung für die Propaganda
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den historischen Kontext des Attentats vom 20. Juli 1944 und die schwierige Auseinandersetzung mit dem deutschen Widerstand in der Nachkriegszeit. Sie begründet die Notwendigkeit, die nationalsozialistische Propaganda, speziell im Umfeld dieses Ereignisses, zu untersuchen und nennt die Rundfunkansprache Hitlers als primäres Analyseobjekt. Die langsame Akzeptanz des Widerstands in der deutschen Bevölkerung wird thematisiert, wobei die Rolle der nationalsozialistischen Propaganda im Umgang mit den Ereignissen hervorgehoben wird. Die Arbeit will erforschen, wie die Nationalsozialisten Propaganda für ihre Zwecke einsetzten und welche Strategien sie anwendeten.
Bedeutung der Propaganda für die nationalsozialistische Herrschaft: Dieses Kapitel definiert den Begriff Propaganda im nationalsozialistischen Kontext und beschreibt die Organisation und die Grundsätze der NS-Propaganda. Es beleuchtet den "Führermythos" und die Bedeutung des gesprochenen Wortes als bevorzugtes Propagandamittel. Der Einfluss von Persönlichkeiten wie Hitler und Goebbels auf die Propaganda wird betont. Es wird diskutiert, wie die NSDAP die Propaganda als zentrales Herrschaftsinstrument nutzte, um die Bevölkerung zu manipulieren und zu indoktrinieren und wie dieses Werkzeug sowohl den Aufstieg der Partei als auch die Aufrechterhaltung ihrer Macht sicherte. Das Kapitel betont den wissenschaftlichen Ansatz der Propaganda, die gezielt Massenmedien nutzte, um kommerzielle und politische Effekte zu erzielen.
Einsatz der Propaganda am Ende der Herrschaft – Hitlers Rundfunkansprache zum missglückten Attentat vom 20. Juli 1944: Dieses Kapitel analysiert Hitlers Rundfunkansprache vom 20. Juli 1944. Es untersucht den historischen Hintergrund des Attentatsversuchs, die Rolle Hitlers als Produzent und das deutsche Volk als Adressat der Rede. Die Textfunktion und Textsorte werden ebenso betrachtet wie die Binnenstruktur, das Textthema und die textinternen Faktoren (lexikalische und syntaktische Ebene). Die Analyse konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel, die zur Verbreitung der nationalsozialistischen Sichtweise auf das Attentat genutzt wurden, und zielt darauf ab, die propagandistischen Absichten der Rede und ihre Wirkung auf die Zuhörer zu ergründen. Hierbei werden detailliert lexikalische Mittel wie das Freund-Feind-Bild, Pfeilerwörter, Akkumulationen und volkstümliche Redewendungen untersucht und ihre Rolle in der Manipulation der Hörerschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Nationalsozialistische Propaganda, Adolf Hitler, 20. Juli 1944, Attentat, Rundfunkansprache, Propaganda-Strategien, Sprachliche Mittel, Freund-Feind-Bild, Manipulation, Massenmedien, Widerstand, Deutsches Volk, Ideologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der nationalsozialistischen Propaganda in Hitlers Rundfunkansprache vom 20. Juli 1944
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Einsatz nationalsozialistischer Propaganda, insbesondere Hitlers Rundfunkansprache vom 20. Juli 1944 nach dem gescheiterten Attentat auf ihn. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Strategien, Merkmale und Wirkung dieser Propaganda auf die deutsche Bevölkerung.
Welche Aspekte der Propaganda werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Bedeutung der Propaganda für die nationalsozialistische Herrschaft, die Organisation und Strategien der NS-Propaganda, die sprachlichen Mittel und rhetorischen Techniken in Hitlers Rede, die Wirkung der Propaganda auf die Bevölkerung und den historischen Kontext des Attentats vom 20. Juli 1944.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Bedeutung der Propaganda für die NS-Herrschaft, ein Hauptkapitel zur Analyse von Hitlers Rede vom 20. Juli 1944 und ein Resümee. Die Analyse der Rede umfasst textexterne Faktoren (historischer Hintergrund, Produzent, Adressat), Textfunktion und Textsorte, Binnenstruktur, Textthema und textinterne Faktoren (lexikalische und syntaktische Ebene).
Welche sprachlichen Mittel werden in Hitlers Rede analysiert?
Die Analyse der lexikalischen Ebene umfasst das Freund-Feind-Bild, Pfeilerwörter, akkumulative Bezeichnungen, „volkstümliche“ Redewendungen und bildhafte Sprache. Die syntaktische Ebene wird ebenfalls betrachtet, jedoch weniger detailliert.
Was ist das Ziel der Analyse von Hitlers Rede?
Ziel ist es, die propagandistischen Absichten der Rede und ihre Wirkung auf die Zuhörer zu ergründen. Es soll untersucht werden, wie sprachliche Mittel eingesetzt wurden, um die nationalsozialistische Sichtweise auf das Attentat zu verbreiten und die Bevölkerung zu manipulieren.
Welche Rolle spielt der historische Kontext?
Der historische Kontext, insbesondere der Attentatsversuch vom 20. Juli 1944, ist zentral für das Verständnis der Rede und ihrer Wirkung. Die Arbeit beleuchtet den historischen Hintergrund und die Bedeutung des Ereignisses für die nationalsozialistische Propaganda.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nationalsozialistische Propaganda, Adolf Hitler, 20. Juli 1944, Attentat, Rundfunkansprache, Propagandastrategien, Sprachliche Mittel, Freund-Feind-Bild, Manipulation, Massenmedien, Widerstand, Deutsches Volk, Ideologie.
Welche Definition von Propaganda wird verwendet?
Die Arbeit definiert den Begriff Propaganda im nationalsozialistischen Kontext und beschreibt die Organisation und die Grundsätze der NS-Propaganda. Es wird der "Führermythos" und die Bedeutung des gesprochenen Wortes als bevorzugtes Propagandamittel beleuchtet.
Wie wird die Wirkung der Propaganda bewertet?
Die Arbeit untersucht die Wirkung der Propaganda auf die deutsche Bevölkerung, indem sie die sprachlichen Mittel und Strategien analysiert und deren potenzielle Einflüsse auf die Hörer beleuchtet. Die langsame Akzeptanz des Widerstands in der deutschen Bevölkerung und die Rolle der Propaganda im Umgang mit den Ereignissen werden thematisiert.
- Quote paper
- Katja Böttche (Author), 2005, Nationalsozialistische Propaganda - Das letzte Aufleben des Hitlermythos nach dem Attentat vom 20. Juli 1944, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44286