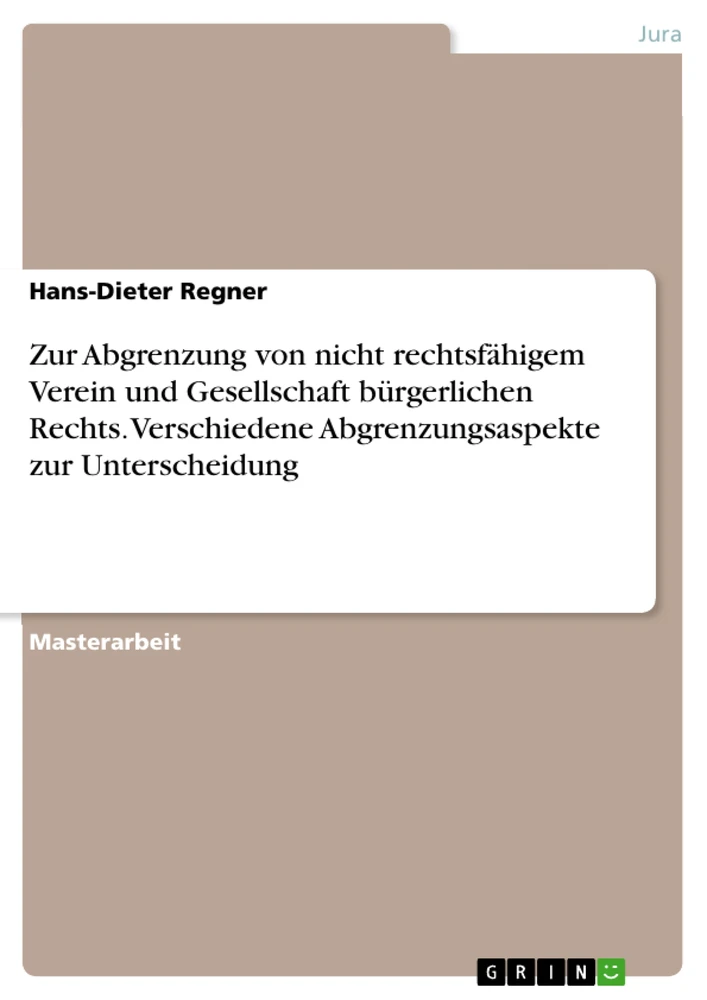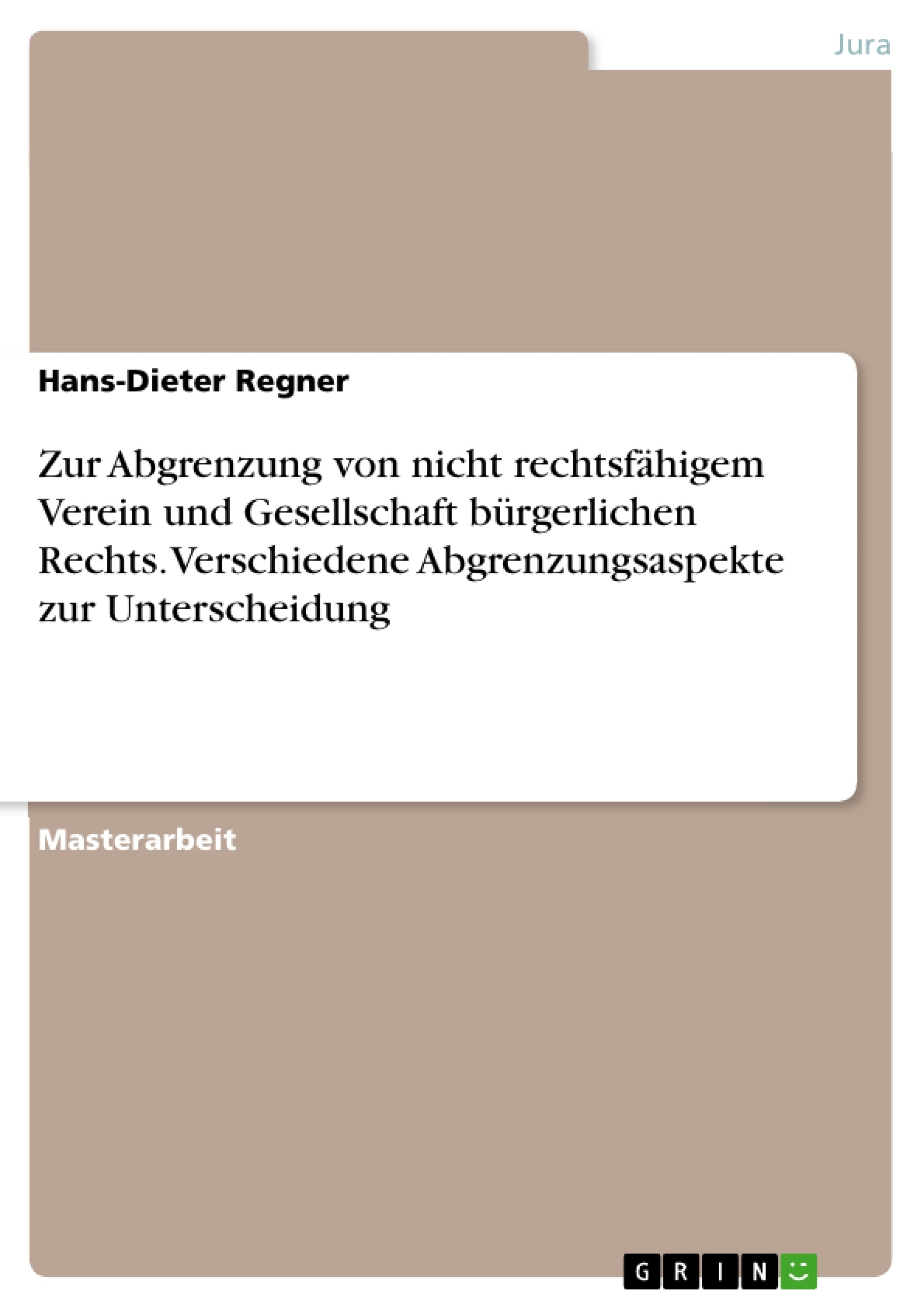Nach dem Grundsatz der Privatautonomie, entstehen Personenverbände durch privatrechtliche Verträge, sodass regelmäßig keine der gesetzlichen Rechtsformen vollständig vorliegt. Die Verträge sind als typische oder atypische Verträge zu unterscheiden. Ein besonderes Problem sind die gemischten Verträge, denn das Gesetz regelt nur die typischen Rechtsformen. Die Rechtsprechung bemüht sich das Problem durch interessengerechte Rechtsanwendung in den Griff zu bekommen. Damit würde nach Schöpflin, aber der Rechtsicherheit widersprochen. Rechtssicherheit wäre aber erforderlich, für die Vertrauen des Rechtsuchenden in die Handhabung des Rechts. Die Rechtsprechung versucht durch ein mehr kasuistisches Verfahren, anstelle von generellen, abstrakten Abgrenzungskriterien der gestellten Problematik beizukommen. Deshalb ist das Ziel dieser Arbeit zunächst, die bis heute nicht eindeutige rechtliche Zuordnung des nrV, als Grundlage einer Abgrenzung von nrV und GbR. Dann wird versucht mit verschiedenen Abgrenzungsaspekten, zur Unterscheidung von nrV und GbR beizutragen.
Organisiert eingesetzte Ressourcen wirken verstärkt. Die Kraft von Verbänden ist so beschaffen, dass sie sich aus einer Summierung der Einzelkräfte nicht erklären lässt. Regelungsleistungen zur Bildung des Verbandes, führen zu vervielfältigten Leistungen des Verbandes. Unbestrittene Erkenntnis ist, dass eine Organisationsleistung der Beteiligten zu einer verstärkten Leistung des Personenverbandes gewandelt wird. Auf der anderen Seite sind Reduktionen des Aufwandes zu erreichen. Die Haftung abzuwälzen, ist ein weiterer Grund zur Bildung von Personenvereinigungen. Ein Personenverband ist damit ein wichtiges „... Instrument zur Zielerreichung...“. Der konfigurative Organisationsbergriff beschäftigt sich mit der Strukturierung. Die Vereinigung wird dann durch Regelungen beschrieben, innerhalb derer Aktivitäten der Mitglieder möglich sind.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG
- I. Problemdarstellung und Eingrenzungen.
- II. Zielsetzung
- III. Aufbau und Vorgehensweise
- B. GRUNDLEGENDES ZU PERSONENVERBÄNDEN
- I. Entstehung und Rechtsnatur der Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- II. Begriff und Wesen des nicht rechtsfähigen Vereins.
- 1. Maßgeblichkeit des Gesellschaftsrechts
- 2. Auslegung des § 54 Satz 1 BGB
- 3. Wesen des nicht rechtsfähigen Vereins.
- C. DER TYPENZWANG
- D. AUSGEWÄHLTE ABGRENZUNGSMETHODEN
- I. Typologische Abgrenzung nach Reuter/Schöpflin
- II. Abgrenzungssystem nach Schmidt
- 1. Abgrenzung durch Tätigkeitsgrundsätze.
- 2. Abgrenzung durch Strukturmerkmale
- 3. Abgrenzung bei Mischverträgen
- III. Abgrenzung nach der Rechtsprechung des BGH.
- E. ENTSTEHUNGSBEZOGENE ABGRENZUNG
- F. BEGRIFFLICHE ABGRENZUNG
- G. TYPOLOGISCHE ABGRENZUNG
- I. Rechtsformtypische Abgrenzung
- 1. Organisation
- 2. Verfolgter Zweck
- 3. Gelegenheitsorientierte Abgrenzung
- II. Strukturelle typologische Abgrenzung
- 1. Gründungsvoraussetzungen
- 2. Mitgliedschaftsaspekte.
- 3. Geschäftsführung und Vertretung
- 4. Einlage- und Beitragspflicht
- 5. Vermögenszurechnung
- 6. Namensrecht
- 7. Beendigung von Gesellschaft und Verein
- H. ABGRENZUNG BEI VERBANDSVERTRÄGEN
- I. Bezeichnung des Vertrages
- II. Abgrenzung nach Fallgruppen und Vertragstypen.
- III. Zusammengesetzte oder gemischte Verträge.
- 1. Kombinationslösung
- 2. Absorptionsmethode
- 3. Rechtsfolgenbezogene Betrachtung
- I. Willensorientierte Abgrenzung
- J. VERHALTEN UND ABGRENZUNG
- K. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Abgrenzung des nicht rechtsfähigen Vereins von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Sie analysiert die unterschiedlichen Merkmale und Rechtsfolgen beider Personenverbände und beleuchtet die relevanten Abgrenzungskriterien.
- Rechtsnatur und Wesen von Verein und GbR
- Unterscheidung anhand von Tätigkeitsgrundsätzen, Strukturmerkmalen und Rechtsprechung
- Analyse der verschiedenen Abgrenzungsmethoden (typologische, entstehungsbezogene, begriffliche, verhaltensbezogene)
- Bedeutung der Abgrenzung bei Vertragsbeziehungen
- Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich der Problemdarstellung und den Eingrenzungen. Es wird die Relevanz der Abgrenzung zwischen Verein und GbR für die Praxis hervorgehoben und der methodische Ansatz der Arbeit erläutert. Kapitel B liefert die grundlegenden Definitionen und Rechtsbegriffe von Verein und GbR. Es werden die Entstehungsgeschichte, Rechtsnatur und wesentliche Merkmale beider Personenverbände analysiert.
In Kapitel C wird der Typenzwang im Gesellschaftsrecht beleuchtet und seine Bedeutung für die Abgrenzung von Verein und GbR diskutiert. Kapitel D beschäftigt sich mit ausgewählten Abgrenzungsmethoden, wie z.B. der typologischen Abgrenzung nach Reuter/Schöpflin und dem Abgrenzungssystem nach Schmidt. Es werden die jeweiligen Kriterien und ihre Anwendung in der Praxis analysiert.
Kapitel E behandelt die entstehungsbezogene Abgrenzung von Verein und GbR. Es wird untersucht, wie die unterschiedlichen Gründungsprozesse und -voraussetzungen zur Abgrenzung beitragen. Kapitel F befasst sich mit der begrifflichen Abgrenzung und betrachtet die verschiedenen Begriffsdefinitionen und -merkmale von Verein und GbR.
Kapitel G widmet sich der typologischen Abgrenzung. Es werden die rechtstypischen Merkmale und Strukturen von Verein und GbR im Vergleich betrachtet, um die Abgrenzung zu verdeutlichen. Kapitel H behandelt die Abgrenzung im Kontext von Verbandsverträgen und analysiert die verschiedenen Fallgruppen und Vertragstypen.
Kapitel I untersucht die willensorientierte Abgrenzung von Verein und GbR. Es wird die Bedeutung des Willens der Vertragsparteien und ihre Bedeutung für die Abgrenzung betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen und Konzepten im Gesellschaftsrecht, insbesondere mit den Personenverbänden Verein und Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Die Analyse fokussiert auf die Abgrenzungskriterien und -methoden sowie die unterschiedlichen Rechtsfolgen. Wesentliche Schlüsselwörter sind: Vereinsrecht, Gesellschaftsrecht, Personenverbände, nicht rechtsfähiger Verein, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Abgrenzungskriterien, Rechtsfolgen, Typen-zwang, Mischverträge, Verbandsverträge.
- Quote paper
- Hans-Dieter Regner (Author), 2008, Zur Abgrenzung von nicht rechtsfähigem Verein und Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Verschiedene Abgrenzungsaspekte zur Unterscheidung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442419