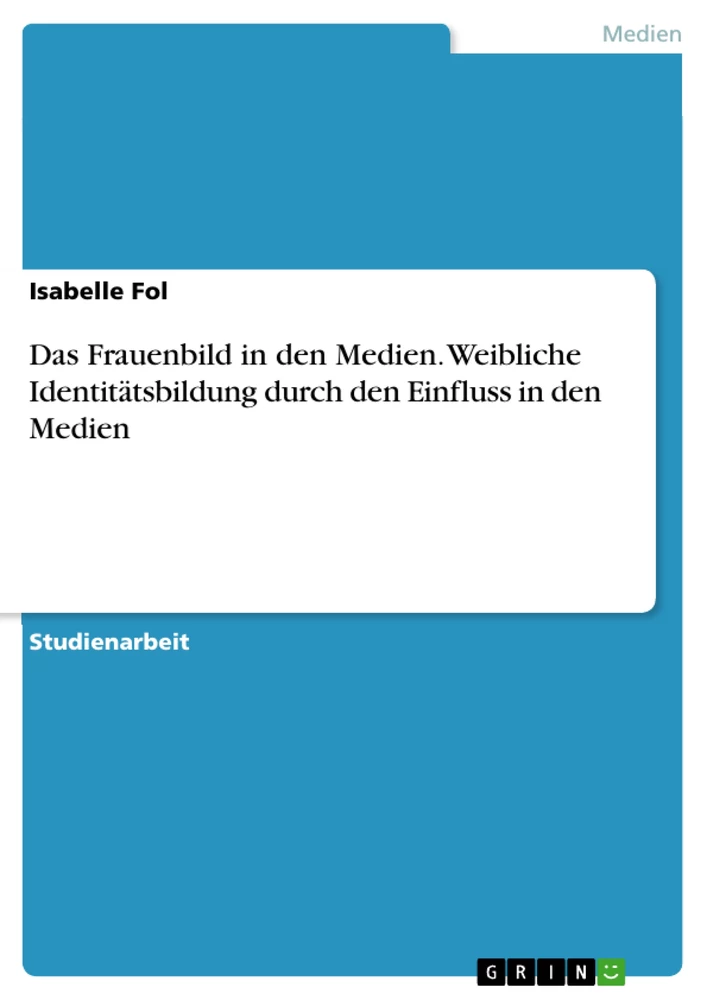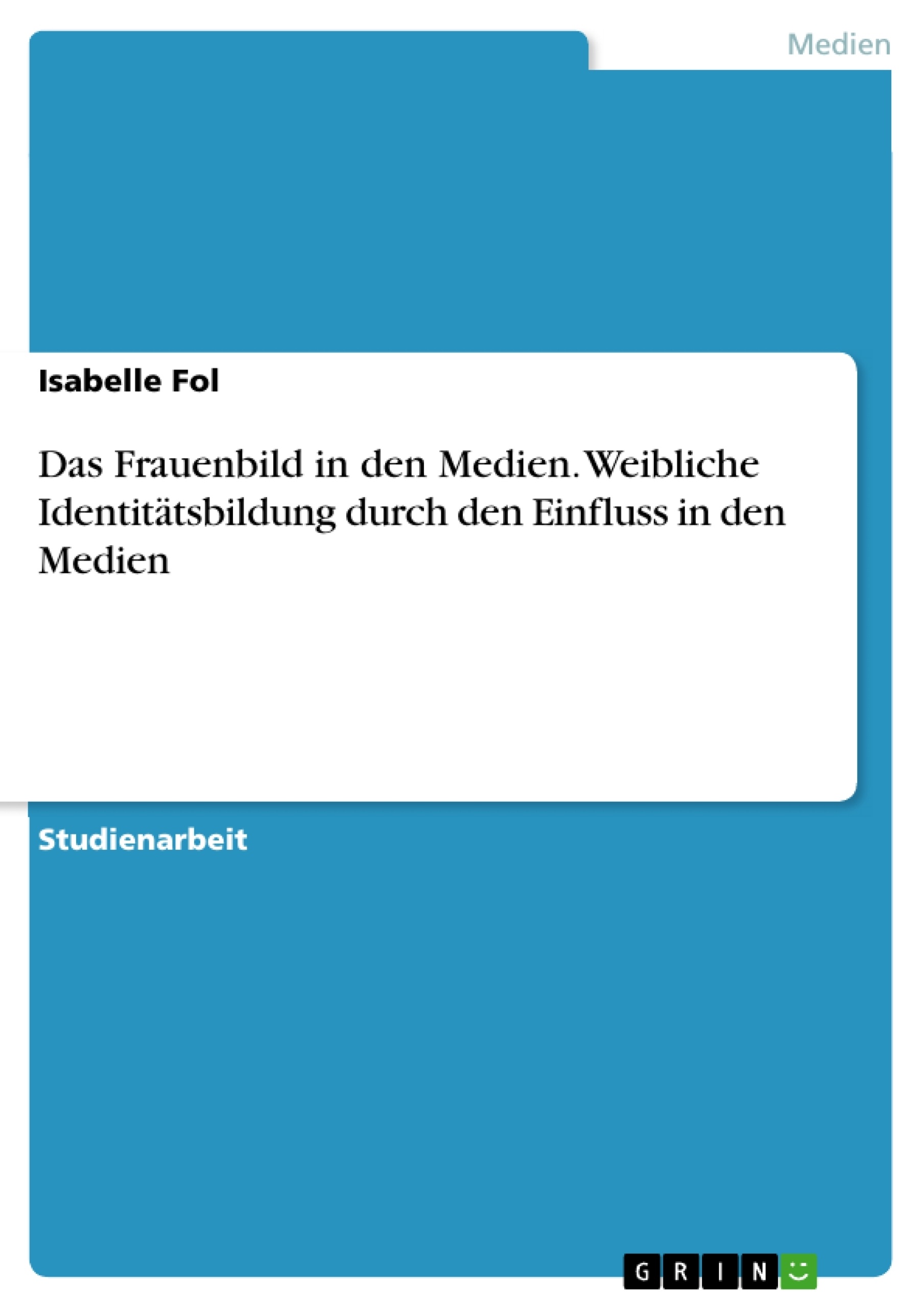Massenmedien verbreiten tagtäglich Darstellungen von Frauen - seien dies Stereotypen, Rollenbilder
oder einfach nur Klischees. Diese in den Medien dargestellten Frauenbilder und
Geschlechterdifferenzen werden von den MedienkonsumentInnen täglich rezipiert und verinnerlicht.
So prägen uns die in den Medien und somit in der Öffentlichkeit tradierten Bilder von Frauen und
Männern in unserem Denken und Verhalten - bewusst wie aber auch unbewusst. Medien sind zwar
nur ein Faktor, der Mensch und Kultur prägt, aber ein entscheidender, was in den Fragestellungen
der Gender Studies, aber auch der Media and Cultural Studies Eingang findet. Die Gender
Studies versuchen Gender im Kontext einer Kultur zu erörtern, so dass die Konstruktion von
Weiblichkeit und die weibliche Identitätsbildung durch Medien einen Teilbereich darstellt. Gender
Studies beschäftigen sich mit dem Faktum, dass das Verhältnis zwischen Männer- und Frauenbilder
im gesellschaftlichen, somit auch kulturellen Kontext und im Zusammenhang des Prozesses der
medialen Zeichenbildung zu sehen ist. Sie deuten immer wieder darauf hin, dass die Konstruktion
unserer Geschlechtlichkeit nicht nur naturgegeben, sondern auch stark kulturspezifisch und
gesellschaftlich ist. Die Gender-Debatte der 70er Jahre und die daraus resultierende Gender-Theorie machen die
Unterscheidung von Sex (biologisches Geschlecht) und Gender (soziales Konstrukt) und verweisen
auf Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht, das die Kernaussage enthält, dass man nicht als
Frau geboren, sondern zur Frau erzogen werde. Diese Aussage - auch wenn ein wenig überspitzt -
verweist auf die Problematik der Geschlechter- und Kulturdebatte. Konstrukteure von Geschlechts-Identitäten sind nicht nur die Sprache, sondern alle kulturellen Techniken, insbesondere die Massenmedien wie Film und Fernsehen (Schneider, p.49).
Medien und Kultur stehen in Wechselwirkung, so dass Medien immer kulturspezifische Produkte
sind; folglich von der jeweils vorherrschenden Ideologie geprägt werden. Medien sind der Spiegel
einer Gesellschaft. Im Gegenzug helfen sie aber auch unterstützend die herrschenden Ideologien und
Ideale zu verbreiten und fördern; so auch bei der Konstruktion von Weiblichkeit und
Männlichkeit. Der Kreis schliesst sich. Die in den Medien konstituierten Frauenbilder und somit auch die weibliche Identitätsbildung sind immer im Kontext der Kultur und der herrschenden Ideologie zu analysieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Frauenbild in den Medien
- 2.1 Allgemeine Feststellungen zum in den Medien konstituierten Frauenbild
- 2.2 Das Frauenbild im Fernsehen
- 2.2.1 (Jugend-) Serien
- 2.2.2 Spielfilme
- 2.3 Das Frauenbild in den Printmedien
- 2.3.1 Frauenzeitschriften
- 2.3.2 Jugendzeitschriften
- 2.4 Das Frauenbild in der Werbung
- 2.5 Das Frauenbild im Internet
- 3 Weibliche Identitätsbildung durch Medien
- 3.1 Weibliche Identitätsbildung durch die in den Medien konstituierten Frauenbilder
- 3.2 Geschlechtsdifferenzierende Sprache
- 4 Schlusswort und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Frauen in verschiedenen Medien und deren Einfluss auf die weibliche Identitätsbildung. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, wie traditionelle Muster und Klischees in der medialen Präsentation von Frauen fortbestehen und wie diese Darstellungen das weibliche Geschlecht beeinflussen.
- Das in den Medien konstruierte Frauenbild und seine Entwicklung.
- Der Einfluss verschiedener Medien (Fernsehen, Printmedien, Werbung, Internet) auf das Frauenbild.
- Der Zusammenhang zwischen medialen Frauenbildern und weiblicher Identitätsbildung.
- Die Rolle patriarchaler Strukturen in der medialen Darstellung von Frauen.
- Die Wirkung geschlechtsdifferenzierender Sprache auf die Identitätsbildung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Einfluss von Medien auf die Konstruktion von Weiblichkeit und Identitätsbildung. Sie betont die Wechselwirkung zwischen Medien, Kultur und Ideologie, und wie Medien sowohl Spiegel der Gesellschaft als auch aktive Gestalter von Geschlechterrollen sind. Die Arbeit fokussiert auf die Darstellung des Frauenbildes in verschiedenen Medien und deren Einfluss auf die weibliche Identitätsbildung, unter Berücksichtigung der Gender Studies und der Bedeutung kultureller Konstrukte.
2 Das Frauenbild in den Medien: Dieses Kapitel analysiert das Frauenbild in verschiedenen Medien, von Fernsehen und Printmedien bis hin zu Werbung und Internet. Es zeigt auf, wie Frauen oft durch einen männlichen Blick wahrgenommen und definiert werden, oft reduziert auf ihr Aussehen und Sexualität. Der Kapitel hebt die persistente Präsenz traditioneller Geschlechterrollen und Klischees hervor und untersucht, wie diese die gesellschaftlichen Machtverhältnisse widerspiegeln. Die Analyse der verschiedenen Medienformate beleuchtet die spezifischen Strategien der Darstellung des Frauenbildes, von der Visualisierung in Printmedien bis zur Sexualisierung in der Werbung.
3 Weibliche Identitätsbildung durch Medien: Dieses Kapitel untersucht den direkten Einfluss der in den Medien konstituierten Frauenbilder auf die weibliche Identitätsbildung. Es wird der Prozess beleuchtet, wie mediale Darstellungen von Weiblichkeit internalisiert und in die Selbstwahrnehmung integriert werden. Dabei spielt auch die geschlechtsdifferenzierende Sprache eine wichtige Rolle, die zum Aufbau und zur Verstärkung von Geschlechterstereotypen beiträgt. Das Kapitel veranschaulicht, wie die Medien sowohl die Selbstwahrnehmung als auch die Fremdwahrnehmung von Frauen prägen, und wie dies die Entwicklung der weiblichen Identität beeinflusst.
Schlüsselwörter
Frauenbild, Medien, Identitätsbildung, Gender Studies, Weiblichkeit, Medienkonsum, Geschlechterrollen, Patriarchat, Sexualisierung, Printmedien, Fernsehen, Werbung, Internet, Kultur, Ideologie.
Häufig gestellte Fragen zum Thema: Medien und Weibliche Identitätsbildung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Frauen in verschiedenen Medien (Fernsehen, Printmedien, Werbung, Internet) und deren Einfluss auf die weibliche Identitätsbildung. Der Fokus liegt auf der Analyse traditioneller Muster und Klischees und deren Wirkung auf Frauen.
Welche Medien werden in der Arbeit analysiert?
Die Analyse umfasst ein breites Spektrum an Medien: Fernsehen (inkl. Serien und Spielfilme), Printmedien (Frauen- und Jugendzeitschriften), Werbung und das Internet. Die Untersuchung beleuchtet die spezifischen Strategien der Darstellung des Frauenbildes in jedem Medium.
Wie wird das Frauenbild in den Medien dargestellt?
Die Arbeit zeigt auf, wie Frauen in den Medien oft durch einen männlichen Blick wahrgenommen und definiert werden, häufig reduziert auf ihr Aussehen und ihre Sexualität. Traditionelle Geschlechterrollen und Klischees bleiben bestehen und spiegeln gesellschaftliche Machtverhältnisse wider. Die Analyse deckt die Persistenz dieser Muster in verschiedenen Medienformaten auf.
Welchen Einfluss haben Medien auf die weibliche Identitätsbildung?
Die Arbeit untersucht, wie mediale Darstellungen von Weiblichkeit internalisiert und in die Selbstwahrnehmung integriert werden. Der Prozess der Identitätsbildung wird im Kontext der Medienkonsums beleuchtet, wobei auch die Rolle geschlechtsdifferenzierender Sprache eine wichtige Rolle spielt. Die Medien prägen sowohl die Selbst- als auch die Fremdwahrnehmung von Frauen und beeinflussen so die Entwicklung der weiblichen Identität.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte beinhalten: Frauenbild, Medien, Identitätsbildung, Gender Studies, Weiblichkeit, Medienkonsum, Geschlechterrollen, Patriarchat, Sexualisierung, Printmedien, Fernsehen, Werbung, Internet, Kultur und Ideologie.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse des Frauenbildes in verschiedenen Medien, ein Kapitel zum Einfluss der Medien auf die weibliche Identitätsbildung und ein Schlusswort mit Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen medialen Frauenbildern und weiblicher Identitätsbildung zu untersuchen. Sie analysiert die Konstruktion des Frauenbildes in den Medien und dessen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und das Selbstverständnis von Frauen.
Wie wird die geschlechtsdifferenzierende Sprache in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Wirkung geschlechtsdifferenzierender Sprache auf die Identitätsbildung und zeigt auf, wie diese zum Aufbau und zur Verstärkung von Geschlechterstereotypen beiträgt.
Welche Rolle spielt das Patriarchat in der medialen Darstellung von Frauen?
Die Arbeit untersucht, wie patriarchale Strukturen in der medialen Darstellung von Frauen sichtbar werden und wie diese Darstellungen gesellschaftliche Machtverhältnisse widerspiegeln.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte und Ergebnisse jedes Kapitels prägnant darstellt.
- Quote paper
- Isabelle Fol (Author), 2002, Das Frauenbild in den Medien. Weibliche Identitätsbildung durch den Einfluss in den Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44207