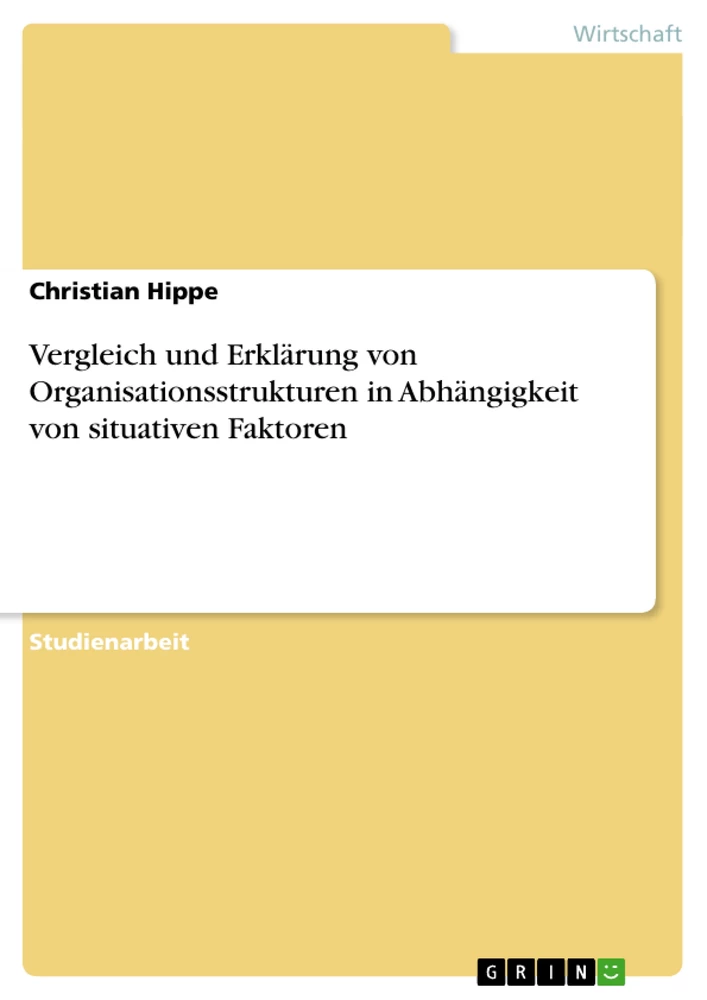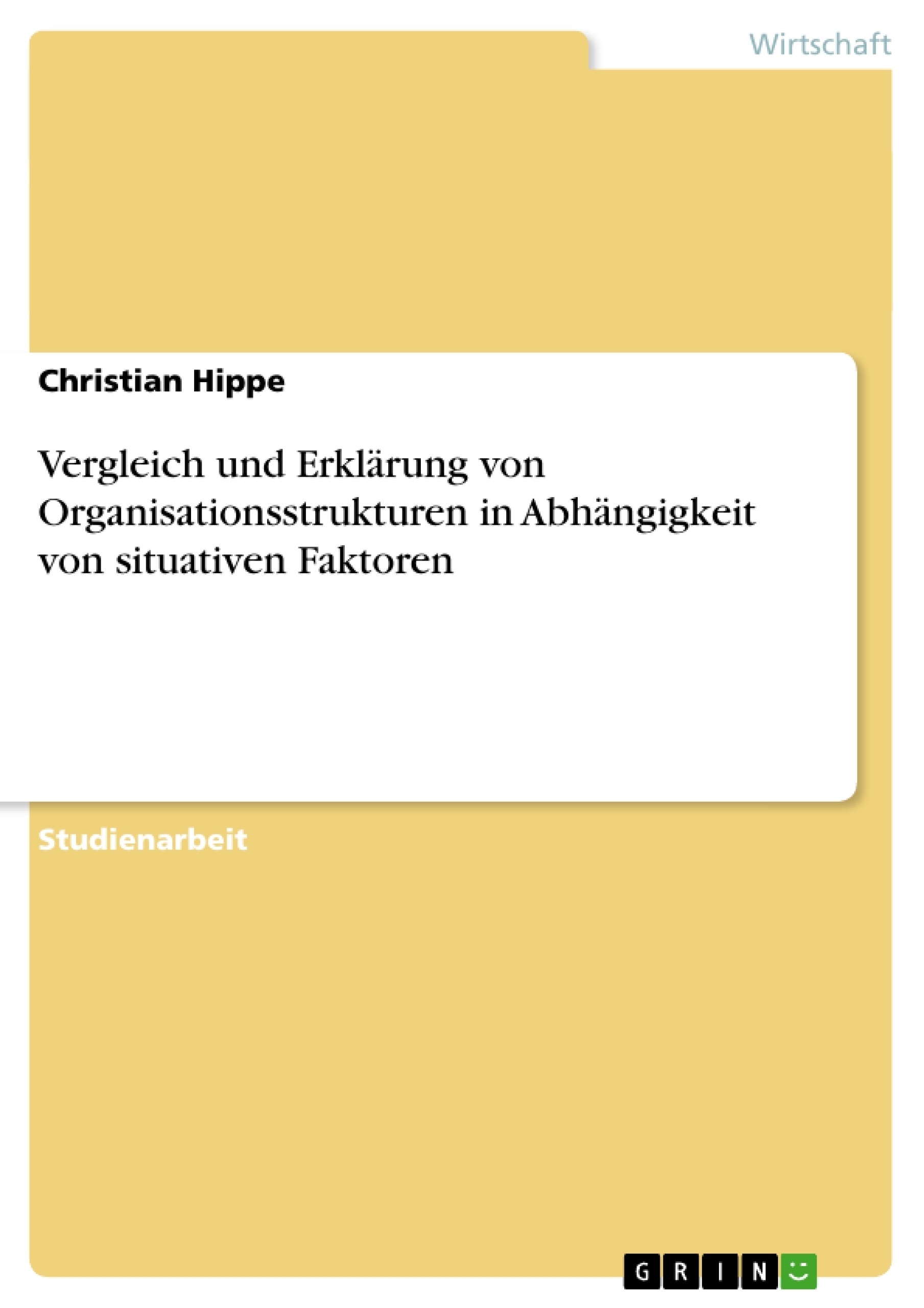Eine aus Soziologen, Psychologen und Ökonomen bestehende Gruppe von Wissenschaftlern begann Anfang der 60er Jahre an der Universität Aston in Großbritannien mit einer Reihe von Arbeiten zur vergleichenden Organisationsforschung. Diese sind als Aston-Studie bzw. Aston-Programm bekannt geworden und wurden zur Grundlage verschiedener Studien in aller Welt. Die Aston-Studie basiert auf dem Situativen Ansatz, der seine Wurzeln in verschiedenen Theorien hat, wie etwa dem Bürokratieansatz von Max Weber. Grundlegende Annahme beider Studien ist, dass die Effizienz einer Organisation im Wesentlichen durch ihre formale Struktur beeinflusst wird. Argumentations- bzw. Erklärungsweisen weichen jedoch durch Unterschiede in der Definition von Strukturen voneinander ab.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine Beurteilung der Qualität des Situativen Ansatzes als Grundlage für ein konkretes Forschungsprojekt am Beispiel der Aston-Studie. In Kapitel 2 erfolgt zunächst eine kurze Einführung in die Grundidee des Ansatzes sowie eine Abgrenzung von den Gedanken Webers. Tiefergehende Ausführungen bezüglich des methodischen und konzeptionellen Vorgehens schließen sich im dritten Kapitel an. Am konkreten Beispiel der Aston-Studie wird hier das zu Grunde liegende Forschungsprinzip von der Erstellung eines konzeptionellen Rahmens, über die Operationalisierung von Variablen, bis hin zur Vorgehensweise bei der Interpretation von Zusammenhängen zwischen Situation und Organisationsstruktur verdeutlicht.
Die Grundlagenforschung der frühen 60er Jahre wurde in einer Reihe weiterführender Arbeiten von Mitgliedern der Aston-Gruppe selbst, aber auch von anderen Wissenschaftlern aufgegriffen, in Bezug auf die Qualität der Ergebnisse bewertet und erweitert. So liegt es auch im Interesse dieser Arbeit, die Studie kritisch zu betrachten und das methodische und konzeptionelle Vorgehen der Forschergruppe zu hinterfragen. Aufgrund des Umfangs der Forschungsarbeiten und der Menge des verfügbaren Materials kann jedoch nur ein sehr kleiner Aspekt der Kritik aufgegriffen werden. Kapitel 4 befasst sich dahingehend mit der Faktorenanalyse, einem Verfahren, das in der empirischen Sozialforschung häufig Anwendung findet, im Kontext der Aston-Studie jedoch sehr wohl als problematisch eingestuft wird. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die Faktorenanalyse kurz vorgestellt, bevor im zweiten Teil die Umsetzung im Rahmen der Studie erläutert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Situative Ansatz
- Die Aston-Studie
- Untersuchungsgegenstand
- Der konzeptionelle Rahmen
- Operationalisierung der Strukturvariablen und Forschungsmethodik
- Interkorrelation der Strukturdimensionen
- Die Faktorenanalyse
- Steckt ein Fehler im Detail?
- Ausblick - Eine Frage des Blickwinkels
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit bewertet die Qualität des situativen Ansatzes in der Organisationsforschung anhand der Aston-Studie. Sie untersucht die Grundidee des Ansatzes, grenzt ihn von Webers Bürokratiemodell ab und analysiert das methodische und konzeptionelle Vorgehen der Aston-Studie. Die Arbeit befasst sich kritisch mit der Anwendung der Faktorenanalyse in der Studie.
- Der situative Ansatz in der Organisationsforschung
- Vergleich des situativen Ansatzes mit dem Bürokratieansatz von Max Weber
- Methodische und konzeptionelle Analyse der Aston-Studie
- Kritische Betrachtung der Faktorenanalyse in der Aston-Studie
- Zusammenhang zwischen Organisationsstruktur und situativen Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Aston-Studie und den situativen Ansatz ein. Sie beschreibt die Studie als ein bedeutendes Forschungsprojekt in der Organisationsforschung, das auf dem situativen Ansatz basiert und die Beziehung zwischen Organisationsstruktur und situativen Faktoren untersucht. Die Arbeit zielt darauf ab, den situativen Ansatz anhand der Aston-Studie zu beurteilen, seine methodischen und konzeptionellen Aspekte zu analysieren und kritische Punkte zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf die angewandte Faktorenanalyse.
Der Situative Ansatz: Dieses Kapitel erläutert den zentralen Aspekt des situativen Ansatzes – die Abhängigkeit der Organisationsstruktur von den Umgebungsbedingungen. Im Gegensatz zu Webers Bürokratieansatz, der eine optimale Struktur für alle Organisationen postuliert, betont der situative Ansatz die Anpassungsfähigkeit der Struktur an verschiedene Situationen. Die Arbeit verweist auf die Kritik an Webers Modell und die daraus resultierende Entwicklung des situativen Ansatzes, der die formale Struktur als abhängig von der Situation und bestimmend für das Verhalten der Organisationsmitglieder betrachtet. Die empirische Analyse dieser Beziehungen und die Entwicklung von Orientierungshilfen für zukünftige strukturelle Entwicklungen sind zentrale Ziele des Ansatzes.
Die Aston-Studie: Dieses Kapitel beschreibt die Aston-Studie, die sich mit den Beziehungen zwischen Organisation, Gruppe und Individuum befasst. Basierend auf dem situativen Ansatz untersucht die Studie den Zusammenhang zwischen Struktur- und Situationsvariablen sowie die Auswirkungen der Organisationsstruktur auf Gruppenverhalten und individuelles Verhalten. Der Untersuchungsgegenstand umfasst 52 Organisationen aus der Region Birmingham, die nach Größe und Tätigkeitsbereich ausgewählt wurden. Das Kapitel legt den Fokus auf die Methodik und den konzeptionellen Rahmen der Studie und beschreibt den Prozess von der Datenerhebung bis hin zur Interpretation der Ergebnisse.
Interkorrelation der Strukturdimensionen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Faktorenanalyse, ein in der empirischen Sozialforschung häufig verwendetes Verfahren, das jedoch im Kontext der Aston-Studie kritisch betrachtet wird. Der erste Abschnitt beschreibt die Faktorenanalyse, während der zweite Abschnitt ihre Anwendung in der Aston-Studie erläutert und kritisch bewertet. Insbesondere wird die Analyse der Interkorrelationen zwischen den Strukturdimensionen hinterfragt.
Schlüsselwörter
Situativer Ansatz, Aston-Studie, Organisationsstruktur, Organisationsformen, Max Weber, Bürokratie, Faktorenanalyse, empirische Sozialforschung, Situationsvariablen, Strukturvariablen, Organisationsdesign.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: "Die Aston-Studie und der situative Ansatz in der Organisationsforschung"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert den situativen Ansatz in der Organisationsforschung anhand der Aston-Studie. Sie untersucht die Grundidee des Ansatzes, vergleicht ihn mit Webers Bürokratiemodell und bewertet kritisch die Methodik und die Ergebnisse der Aston-Studie, insbesondere die Anwendung der Faktorenanalyse.
Was ist der situative Ansatz in der Organisationsforschung?
Der situative Ansatz betont die Abhängigkeit der Organisationsstruktur von den Umgebungsbedingungen. Im Gegensatz zu Webers Bürokratieansatz, der eine optimale Struktur für alle Organisationen postuliert, argumentiert der situative Ansatz für die Anpassungsfähigkeit der Struktur an verschiedene Situationen. Die empirische Analyse dieser Beziehungen und die Entwicklung von Orientierungshilfen für zukünftige strukturelle Entwicklungen sind zentrale Ziele.
Was ist die Aston-Studie und welche Rolle spielt sie in der Arbeit?
Die Aston-Studie ist ein bedeutendes Forschungsprojekt, das den Zusammenhang zwischen Organisationsstruktur und situativen Faktoren untersucht. Sie analysiert 52 Organisationen aus Birmingham und konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen Organisation, Gruppe und Individuum. Die Seminararbeit nutzt die Aston-Studie als Fallbeispiel, um den situativen Ansatz zu evaluieren.
Wie wird die Methodik der Aston-Studie in der Seminararbeit bewertet?
Die Seminararbeit analysiert detailliert die Methodik und den konzeptionellen Rahmen der Aston-Studie. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der kritischen Bewertung der Anwendung der Faktorenanalyse zur Untersuchung der Interkorrelationen zwischen den Strukturdimensionen. Die Arbeit hinterfragt die Gültigkeit und die Interpretation der Ergebnisse dieser Analyse.
Wie wird der situative Ansatz mit dem Bürokratieansatz von Max Weber verglichen?
Die Seminararbeit stellt einen expliziten Vergleich zwischen dem situativen Ansatz und Webers Bürokratiemodell an. Dabei werden die Unterschiede in den Grundannahmen und den Implikationen für die Organisationsgestaltung herausgearbeitet. Der situative Ansatz wird als Gegenmodell zu Webers universalistischem Ansatz präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Inhalte der Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Situativer Ansatz, Aston-Studie, Organisationsstruktur, Organisationsformen, Max Weber, Bürokratie, Faktorenanalyse, empirische Sozialforschung, Situationsvariablen, Strukturvariablen, Organisationsdesign.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Situative Ansatz, Die Aston-Studie (mit Unterkapiteln zu Untersuchungsgegenstand, konzeptionellem Rahmen und Methodik), Interkorrelation der Strukturdimensionen (mit Unterkapiteln zur Faktorenanalyse und deren kritischer Bewertung) und Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, die Qualität des situativen Ansatzes anhand der Aston-Studie zu bewerten. Sie will die methodischen und konzeptionellen Aspekte des Ansatzes und der Studie analysieren und kritische Punkte, insbesondere bezüglich der Faktorenanalyse, beleuchten.
- Quote paper
- Christian Hippe (Author), 2005, Vergleich und Erklärung von Organisationsstrukturen in Abhängigkeit von situativen Faktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44153