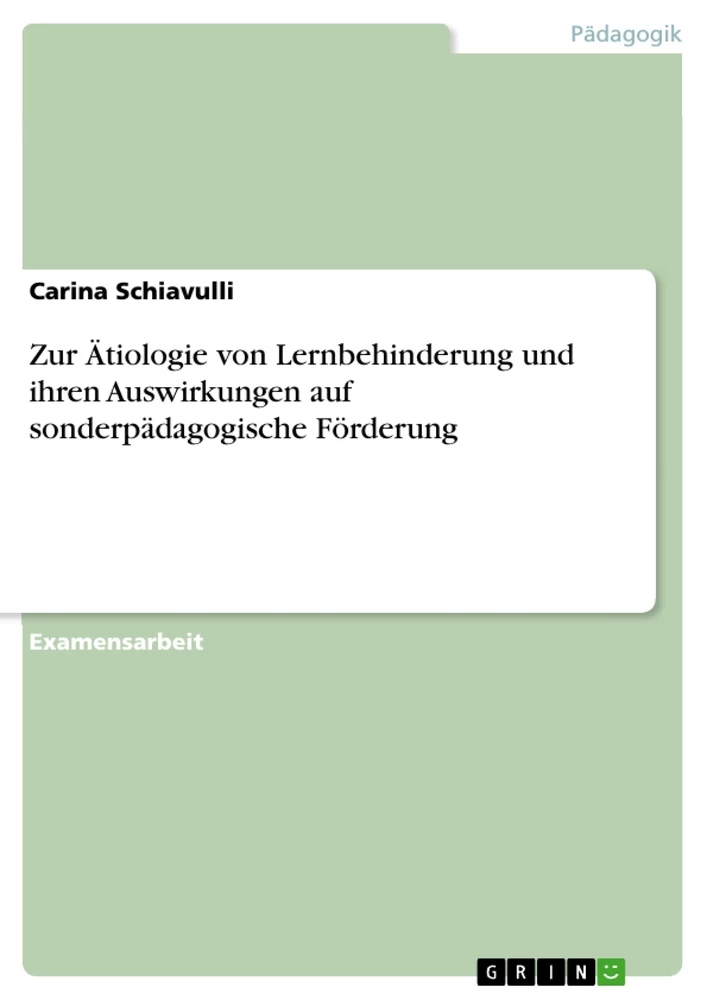Schwierigkeiten im Lernen kann jeder bekommen und hat die Mehrheit bereits erfahren. Allerdings gelingt es meistens, Lernschwierigkeiten zu bewältigen, sodass diese nur vorübergehend und bereichsspezifisch auftreten. Die Lernprobleme, die sich aber manifestieren, können persistieren und sich bis zu einer Lernbehinderung weiterentwickeln. Auch im Erwachsenenalter können Lernprobleme weiter bestehen bleiben und in verschiedenen Lebensbereichen Unterstützung bedürfen.
Mit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich seit 1999 der Begriff des sonderpädagogischen Förderbedarfs etabliert, der den Wechsel von einem defizitorientierten Begriff zu einem ressourcenorientierten Begriff bewältigen soll. Einen Wandel bringen gegenwärtig auch die Inklusionsdebatten mit sich, die ebenfalls seit Jahren geführt werden und die Problematik der Lernbehindertenpädagogik aktuell hält. Denn mit der Problemstellung, wie didaktisch und methodisch dem inklusiven Unterricht begegnet werden soll, entsteht gleichzeitig die nächste Problemlage: Lernschwierigkeiten scheinen ständig zu wachsen und demzufolge kommt die Frage nach den Ursachen für diese Entwicklung leicht auf.
Hieraus ergibt sich, dass die vorliegende Arbeit der Frage nachgeht, welche Determinanten die Genese einer Lernbehinderung beeinflussen können und welche Möglichkeiten der Prävention und Intervention die Sonderpädagogik bietet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zur Begriffsbestimmung von Lernbehinderung
- 2.1 Kernsymptome und Kriterien zur Feststellung
- 2.2 Die Klassifikationssysteme
- 2.2.1 Lernbehinderung nach ICD-10
- 2.2.2 Lernbehinderung nach DSM-V
- 2.3 Abgrenzung zu verwandten Begriffen
- 2.4 Komorbiditäten und Differentialdiagnostik
- 2.4.1 Lernbehinderung und Verhaltensprobleme
- 2.4.2 Lernbehinderung und Aggression
- 2.4.3 Lernbehinderung und Angst
- 2.4.4 Lernbehinderung und AD(H)S
- 2.4.5 Teilleistungs- und kombinierte Störungen als Differentialdiagnose
- 2.5 Prävalenz
- 2.6 Mögliche Auswirkungen und Folgestörungen
- 3 Die Ätiologie von Lernbehinderung
- 3.1 Ein entwicklungspsychologischer Ansatz
- 3.2 Das Resilienzkonzept
- 3.2.1 Zum Begriff Resilienz
- 3.2.2 Die Risiko- und Schutzfaktoren
- 3.2.2.1 Die Vulnerabilität
- 3.2.2.2 Personale Faktoren
- 3.2.2.3 Der familiäre Faktor: Das häusliche Umfeld
- 3.2.2.4 Der institutionelle Faktor: Die Schule
- 3.2.3 Weitere Determinanten aus der Umwelt
- 3.2.3.1 Der sozio-ökonomische Status
- 3.2.3.2 Der Migrationshintergrund
- 3.3 Psychologische Erklärungsmodelle
- 4 Frühförderung von Risikokindern
- 4.1 Was bedeutet Frühförderung?
- 4.2 Die allgemeinen Prinzipien der Frühförderung
- 4.3 Möglichkeiten der Frühförderung
- 5 Förderung von Schülern mit dem FS Lernen
- 5.1 Differenzierungsformen
- 5.1.1 Äußere Differenzierung
- 5.1.1.1 Das deutsche Schulsystem
- 5.1.1.2 Die Differenzierung nach Unterrichtsformen
- 5.1.1.3 Differenzierung durch Förderunterricht
- 5.1.2 Innere Differenzierung
- 5.1.2.1 Die natürliche Differenzierung
- 5.1.2.2 Binnendifferenzierung nach Wember
- 5.2 Möglichkeiten der Förderung im Unterricht
- 5.2.1 Prinzipien der Förderplanung und -arbeit
- 5.2.2 Die Förderung von Schutzfaktoren
- 5.2.3 Die Förderung von Kognition
- 5.2.4 Der Nachteilsausgleich
- 6 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ätiologie von Lernbehinderung, ihre Auswirkungen und mögliche Förderansätze. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Determinanten von Lernbehinderung zu entwickeln und geeignete Präventions- und Interventionsmaßnahmen im sonderpädagogischen Kontext aufzuzeigen.
- Begriffsbestimmung und Klassifikation von Lernbehinderung
- Komorbiditäten und Differentialdiagnostik bei Lernbehinderung
- Entwicklungspsychologische und resilienzorientierte Ansätze zur Erklärung von Lernbehinderung
- Frühförderung von Risikokindern
- Differenzierte Fördermöglichkeiten im Unterricht für Schüler mit Lernbehinderung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die komplexe Thematik der Lernbehinderung ein und skizziert die zentralen Fragen der Arbeit: Begriffsbestimmung, Auswirkungen, Einflussfaktoren, Resilienz und Förderung. Sie hebt die Schwierigkeit hervor, Lernbehinderung eindeutig zu definieren und die Notwendigkeit, von einem defizitorientierten zu einem ressourcenorientierten Verständnis zu wechseln, im Kontext der Inklusionsdebatte.
2 Zur Begriffsbestimmung von Lernbehinderung: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Definition von Lernbehinderung. Es werden Kernsymptome, diagnostische Kriterien, verschiedene Klassifikationssysteme (ICD-10 und DSM-V) und die Abgrenzung zu verwandten Begriffen erläutert. Ein besonderer Fokus liegt auf Komorbiditäten wie Verhaltensproblemen, Aggression, Angst und AD(H)S. Die Prävalenz von Lernbehinderung und deren potenziellen Folgen werden ebenfalls behandelt. Der Kapitelverlauf zeigt die Herausforderungen bei der Definition auf, die sich aus unterschiedlichen Terminologien und dem Stigma des Begriffs ergeben.
3 Die Ätiologie von Lernbehinderung: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen von Lernbehinderung aus entwicklungspsychologischer und resilienzorientierter Perspektive. Der entwicklungspsychologische Ansatz beleuchtet erbliche Faktoren und Umwelteinflüsse. Das Resilienzkonzept wird detailliert vorgestellt, wobei Risiko- und Schutzfaktoren, die Vulnerabilität des Kindes, personale, familiäre und institutionelle Faktoren (Schule) sowie sozioökonomischer Status und Migrationshintergrund als Einflussgrößen analysiert werden. Das Kapitel bietet ein vielschichtiges Bild der komplexen Interaktion zwischen Anlage und Umwelt bei der Entstehung von Lernbehinderung.
4 Frühförderung von Risikokindern: Dieses Kapitel widmet sich der Frühförderung von Kindern mit erhöhtem Risiko für Lernbehinderung. Es definiert den Begriff der Frühförderung, beschreibt allgemeine Prinzipien und stellt verschiedene Fördermöglichkeiten vor. Der Fokus liegt auf präventiven Maßnahmen, die frühzeitig die Entwicklung unterstützen und das Risiko für eine manifest werdende Lernbehinderung reduzieren sollen.
5 Förderung von Schülern mit dem FS Lernen: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Förderansätze für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Es unterscheidet zwischen äußerer und innerer Differenzierung im Unterricht und präsentiert konkrete Methoden der Förderung, wie beispielsweise die Förderung von Schutzfaktoren und die Berücksichtigung kognitiver Aspekte. Der Nachteilsausgleich wird als wichtiges Element inklusiven Unterrichts hervorgehoben. Der Kapitelverlauf zeigt die Notwendigkeit einer individuellen und differenzierten Förderung, um den spezifischen Bedürfnissen von Schülern mit Lernbehinderung gerecht zu werden.
Schlüsselwörter
Lernbehinderung, Ätiologie, Resilienz, Frühförderung, inklusive Pädagogik, Förderunterricht, Komorbidität, Differentialdiagnostik, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Entwicklungspsychologie, sonderpädagogischer Förderbedarf.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Lernbehinderung: Ätiologie, Prävention und Förderung"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Lernbehinderung. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Ätiologie (Ursachen), Prävention und Förderung von Lernbehinderung.
Wie wird Lernbehinderung definiert und klassifiziert?
Das Dokument beschreibt die Definition von Lernbehinderung anhand von Kernsymptomen und diagnostischen Kriterien. Es werden die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-V erläutert und die Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen diskutiert. Die Herausforderungen bei der Definition aufgrund unterschiedlicher Terminologien und des Stigmas werden hervorgehoben.
Welche Komorbiditäten sind bei Lernbehinderung häufig?
Das Dokument behandelt häufige Komorbiditäten (begleitende Störungen) wie Verhaltensprobleme, Aggression, Angststörungen und AD(H)S. Die Differentialdiagnostik, also die Unterscheidung von Lernbehinderung und anderen Störungen, wird ebenfalls thematisiert.
Welche Ursachen werden für Lernbehinderung genannt?
Die Ätiologie von Lernbehinderung wird aus entwicklungspsychologischer und resilienzorientierter Perspektive betrachtet. Es werden erbliche Faktoren, Umwelteinflüsse, Risiko- und Schutzfaktoren (personale, familiäre, institutionelle Faktoren, sozioökonomischer Status, Migrationshintergrund) analysiert. Die komplexe Interaktion zwischen Anlage und Umwelt wird hervorgehoben.
Was versteht man unter Frühförderung von Risikokindern?
Das Dokument definiert Frühförderung und beschreibt allgemeine Prinzipien und Möglichkeiten der frühzeitigen Unterstützung von Kindern mit erhöhtem Risiko für Lernbehinderung. Der Fokus liegt auf präventiven Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos.
Welche Fördermöglichkeiten für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt verschiedene Förderansätze im Unterricht, darunter äußere und innere Differenzierung. Konkrete Fördermethoden wie die Förderung von Schutzfaktoren, die Berücksichtigung kognitiver Aspekte und der Nachteilsausgleich werden erläutert. Die Notwendigkeit einer individuellen und differenzierten Förderung wird betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter umfassen: Lernbehinderung, Ätiologie, Resilienz, Frühförderung, inklusive Pädagogik, Förderunterricht, Komorbidität, Differentialdiagnostik, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Entwicklungspsychologie, sonderpädagogischer Förderbedarf.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Determinanten von Lernbehinderung zu entwickeln und geeignete Präventions- und Interventionsmaßnahmen im sonderpädagogischen Kontext aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Carina Schiavulli (Autor:in), 2018, Zur Ätiologie von Lernbehinderung und ihren Auswirkungen auf sonderpädagogische Förderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441365