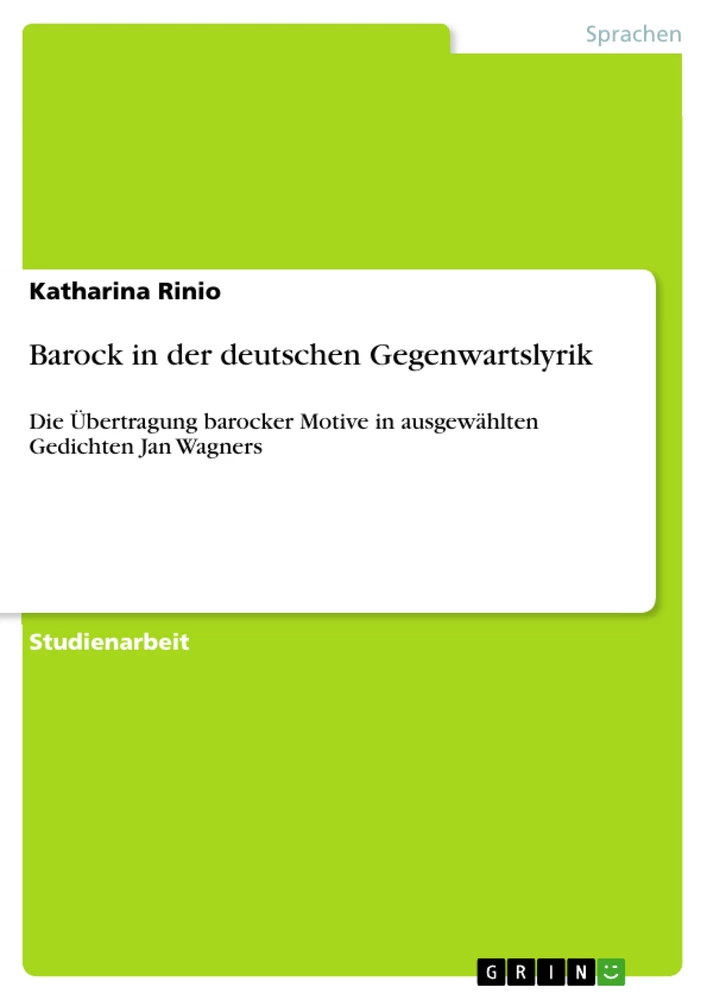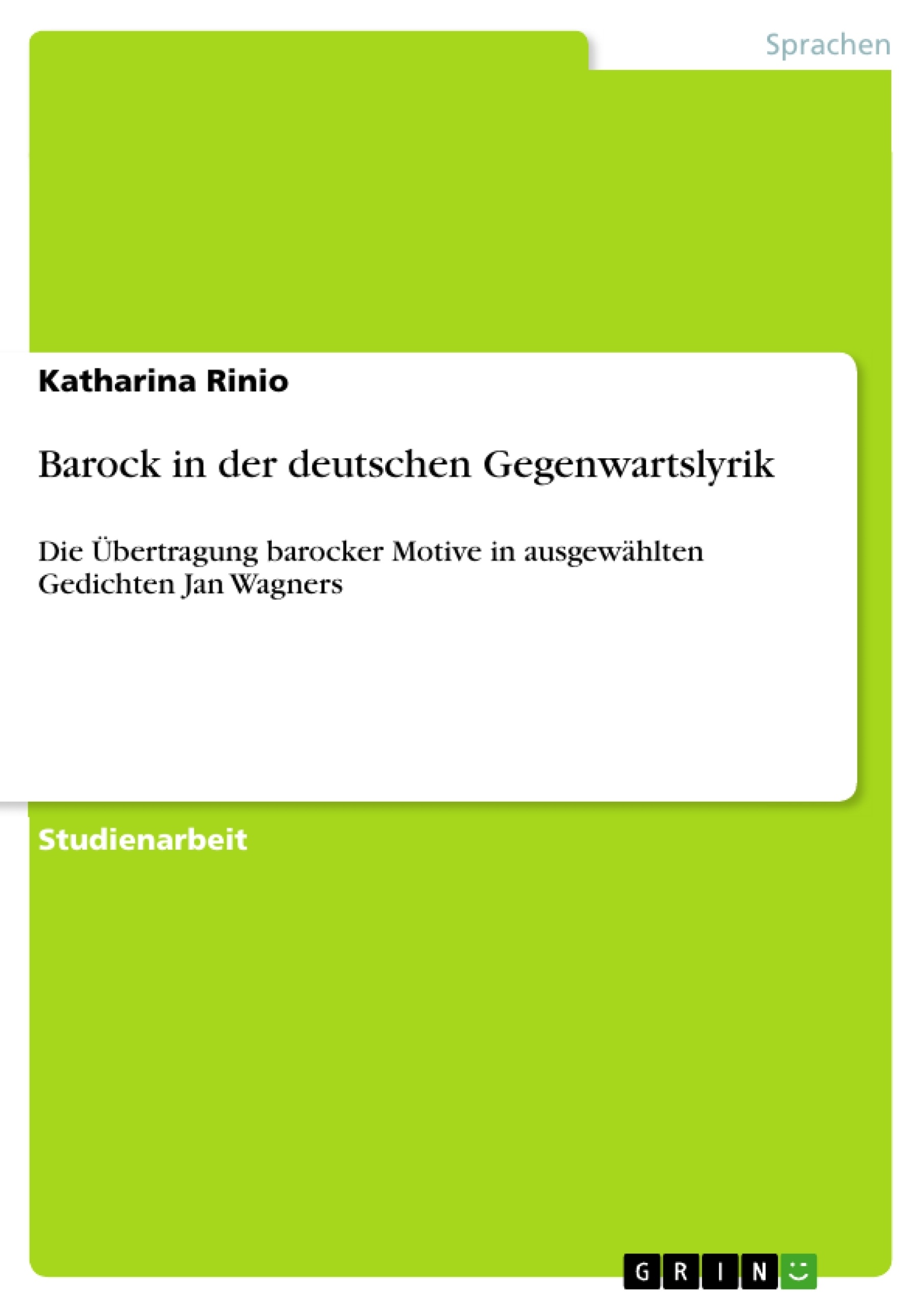Die Kritik am gegenwärtigen Lyrikkanon ist groß. Vor allem in der Gesellschaft zeigt sich eher größerer Unmut, wenn es um neuste, lyrische Werke geht: Ein denkbar schlechtes Image. Uwe Kolbe stellt das Potential moderner Lyrik gänzlich in Frage. Wenn wir uns daher einmal die traditionelle Dichtkunst aus dem 17. Jahrhundert genauer ansehen und sie mit zeitgenössischen Werken vergleichen, treffen wahrlich zwei Gegensätze aufeinander: Während die Lyrik der frühen Neuzeit, speziell des Barocks, von einer obligatorischen Regelpoetik geprägt ist, zeichnen sich die zeitgenössischen Gedichte dagegen vor allem durch Formfreiheit und Experimentierfreude aus. Waren Gedichte also früher besser, weil sie in der Strenge erst ihre Blüte entfaltet haben?
Unter der Annahme, dass es möglich ist, zeitgenössisch hochwertige Gedichte zu schreiben, die wieder auf barocke Stilmittel zurückgreifen und alte Schreibkorsette anlegen, wird die Schreibkunst des modernen Lyrikers Jan Wagner genauer betrachtet. Wagner ist beliebt als Dichter, der nah an den Menschen ist, da man ihn, im Gegensatz zu seinen Kollegen, wieder verstehen kann.
Diese Arbeit befasst sich daher mit der zeitgenössischen Wiederkehr von Vorstellungen und Bildern der „Vergänglichkeit“ in den Gedichten Jan Wagners, wie sie in der Lyrik der Barockzeit entwickelt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zeitalter Barock
- Themen des 17. Jahrhunderts
- Merkmale und Motive der Barocklyrik
- Jan Wagner und sein künstlerisches Schaffen
- Jan Wagner: „,houdini im spiegel“ aus: Achtzehn Pasteten (2007)
- Zur Form
- Analyse
- Gedichtanalyse: Jan Wagner: giersch aus: Regentonnenvariationen (2014)
- Zur Form
- Analyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, ob und wie barocke Merkmale in der Lyrik des modernen Dichters Jan Wagner auftauchen und wirken. Im Zentrum stehen die zeitgenössische Wiederkehr von Vorstellungen und Bildern der „Vergänglichkeit“ in den Gedichten Jan Wagners, wie sie in der Lyrik der Barockzeit entwickelt wurden. Dabei wird das Motiv der Antithetik im Zusammenhang mit dem Hauptmotiv Vanitas („alles ist eitel“) näher beleuchtet.
- Die Wiederaufnahme barocker Motive in der zeitgenössischen Lyrik
- Die Rolle der Antithetik und des Vanitas-Motivs in Jan Wagners Gedichten
- Die Relevanz barocker Stilmittel für die moderne Lyrik
- Die Analyse von Gedichten Jan Wagners im Kontext des Barocks
- Die Aktualität des Themas Vergänglichkeit in der Gegenwartsliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung thematisiert die Kritik am gegenwärtigen Lyrikkanon und stellt den Kontrast zwischen traditioneller Barocklyrik und zeitgenössischen Gedichten dar. Sie erläutert die Motivation und Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Schreibkunst des Lyrikers Jan Wagner im Kontext barocker Stilmittel zu untersuchen.
- Zeitalter Barock: Dieser Abschnitt bietet einen Einblick in die Epoche des Barocks, beleuchtet die Themen des 17. Jahrhunderts und analysiert die Merkmale und Motive der Barocklyrik. Er stellt die besondere Rolle der Regelpoetik und das Ideal des „gelehrten Dichters“ dar.
- Jan Wagner und sein künstlerisches Schaffen: Dieser Abschnitt stellt Jan Wagner als modernen Lyriker vor und erläutert, warum seine Poetik als „erleichternd“ und „nah an den Menschen“ wahrgenommen wird.
- Jan Wagner: „,houdini im spiegel“ aus: Achtzehn Pasteten (2007): In diesem Kapitel wird das Gedicht „‚houdini im spiegel‘“ analysiert, wobei die Form und die Bedeutung des Gedichts im Kontext des Barocks untersucht werden.
- Gedichtanalyse: Jan Wagner: giersch aus: Regentonnenvariationen (2014): Dieses Kapitel analysiert das Gedicht „giersch“ aus dem Band „Regentonnenvariationen“ und untersucht Form und Bedeutung des Gedichts im Kontext des Barocks.
Schlüsselwörter
Barocklyrik, Jan Wagner, Vergänglichkeit, Antithetik, Vanitas, Regelpoetik, Formfreiheit, Moderne, Tradition, Gedichtanalyse, Gegenwartslyrik.
- Citation du texte
- Katharina Rinio (Auteur), 2017, Barock in der deutschen Gegenwartslyrik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441222