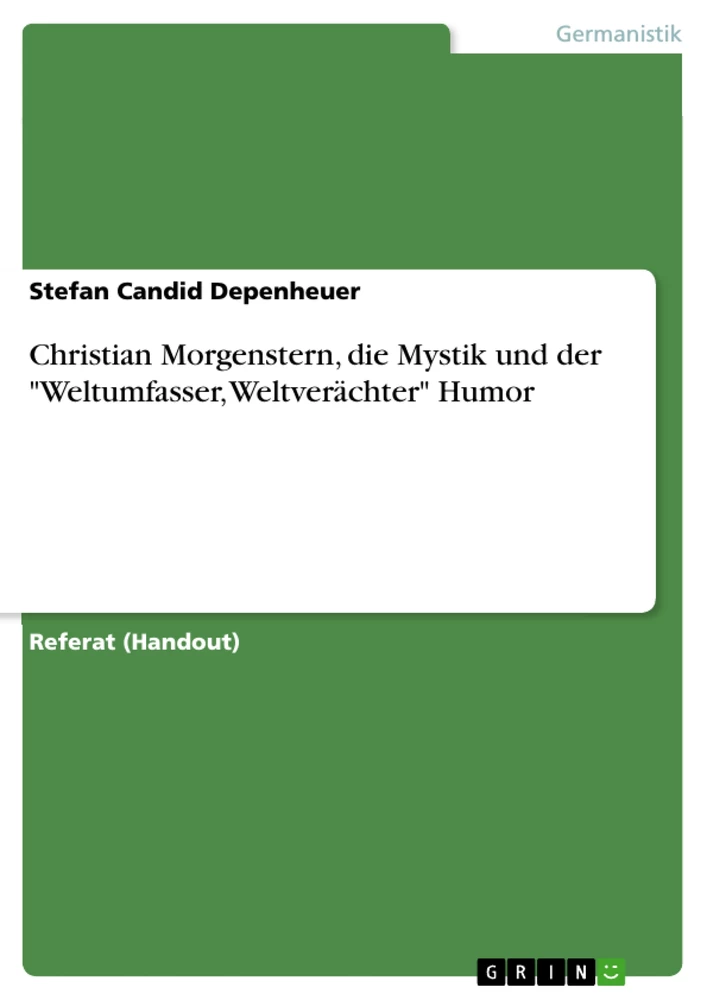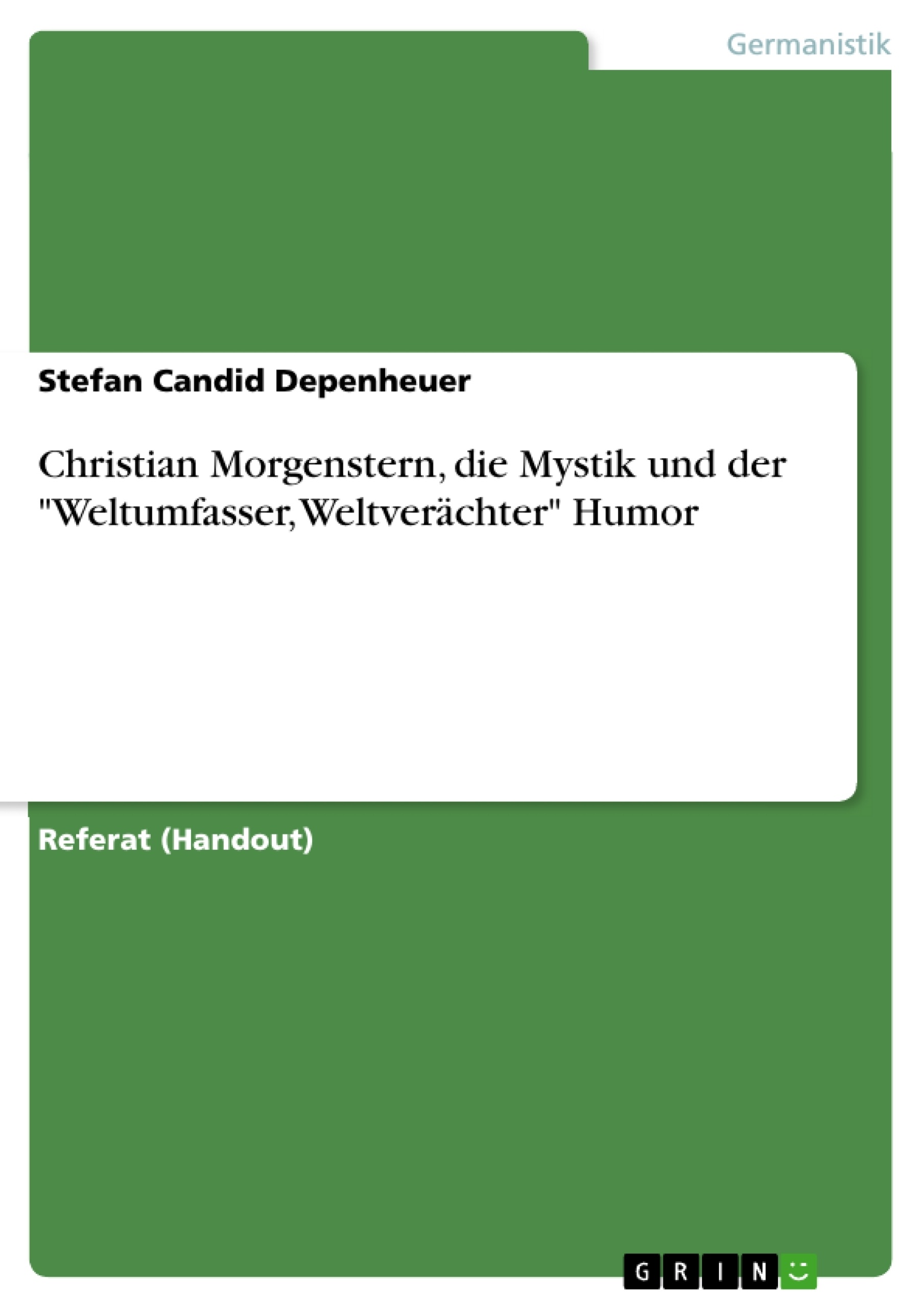Die „Galgenlieder“ stellen Christian Morgensterns berühmtestes Werk dar. Dem breiten Publikum ist der Münchner Dichter hauptsächlich durch diese Schätze humoristischer Lyrik bekannt. Neben einer Kurzbiografie des Autors gewährt diese Handreichung einen Überblick über Entstehung, Wirkungsgeschichte und Interpretationsansätze.
Christian Morgenstern, die Mystik und der Weltumfasser, Weltveracher Humor
Christian Morgenstern (1871—1914) ist, wie der Germanist Heiko Postma bemerkt, „als Dichter beruhmt geworden (und geblieben), aber eben nicht mit den Werken, fur die er beruhmt werden wollte"[1]. In seiner Aphorismensammlung „Stufen“ schreibt er selbst uber sein Werk als philosophischer Dichter und Schrifsteller (im Kontrast zu seinem „Beiwerk“, dem humoristischen Arbeiten): „Und wenn ich, ein Mensch von ursprunglich glanzender Begabung, alles in allem ein Dilettant geblieben bin, so hat die Halfte der Schuld daran gewiB die Unsumme von Dilettantismus, von Halbheit und Kulturlosigkeit, die ich uberall gefunden habe, wohin mich meine bewegte Jugend gefuhrt hat.“
Diesem Dilemma wollen wir in unserem Referat nachforschen, ohne den Fokus auf den „beruhmten“ Teil seiner Werke — also den humoristischen — zu verlieren. Dazu betrachten wir zuerst die Vita einer Seele, die — so sein Freund Rudolf Steiner — „den Sieg des Geistes uber alle Leiblichkeit“ bezeugt.
Kindheit und Jugend (1871-93)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Christian Morgenstern wird am 6. Mai 1871 als einziges Kind einer Kunstmaler-Familie in Munchen geboren. Von der Mutter, die fruh stirbt, erbt er ein schweres Lungenleiden, das einen fruhen Tod vorhersehbar macht. Ein Versuch des Vaters, den eher sprachlich als kunstlerisch begabten Jungen auf eine Militarlaufbahn vorzubereiten, schlagt fehl.[2] Stattdessen studiert er in Breslau Jura und Nationalokonomie — ohne Begeisterung: Er will Schriftsteller werden und grundet die Zeitschrift „Deutscher Geist“. Mit dem Vater uberwirft er sich nach dessen dritter Hochzeit.
Morgensterns Kindheit ist von einer ihm angenehmen Einsamkeit gepragt; schon in seine Jugendzeit fallen erste mystische Erlebnisse beim Betrachten des Sternenhimmels.
In Berlin (1894-97)
Morgenstern zieht im April 1893 nach Berlin und erhalt eine Stellung an der Nationalgalerie. Daruber hinaus schreibt er fur zahlreiche Feuilletons der Stadt. Die wichtigste geistige Leitfigur wird ihm in dieser Zeit Friedrich Nietzsche. Er entfremdet sich (vorlaufig) vom Christentum und begeistert sich fur die Idee des Ubermenschen in „Also sprach Zarathustra“.
Dem Geiste dieses Denkers widmet er auch seinen Gedichtzyklus humoristisch-phantastischer Dichtung „In Phanta’s SchloB“, ein Werk uber geistige „Auffahrt“ und „Talfahrt“, verbildlicht in der Wanderung durch ein Gebirge, auf dessen hochstem Gipfel das Schloss der personifizierten Phantasie thront. Der Schriftsteller Efraim Frisch schreibt uber den Morgenstern dieser Zeit: „Alles bloB Reformatorische lag ihm fern. Seine Intention ging stets auf ein Ganzes, auf eine Wandlung des Menschen von innen her.“
,,Auf vielen Wegen“ (1898-1908)
Im Oktober 1897 nimmt Morgenstern einen Ubersetzungs-Auftrag fur Werke des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen an, obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal die norwegische Sprache beherrscht. Er reist in den folgenden Monaten durch Skandinavien und trifft Ibsen mehrmals selbst. Fast jahrlich entstehen ab jetzt idealistische Gedichtbande wie „Auf vielen Wegen“ oder „Ich und die Welt“.
Morgensterns Lungenleiden zwingt ihn jedoch zu ausgedehnten Kurreisen durch Sudeuropa. In dieser Zeit entdeckt er die kulturkritischen Schriften des Orientalisten (und Nationalisten) Paul de Lagardes fur sich[3] und steigert sich immer weiter in die geistigen Problematiken seiner Zeit hinein[4]: „Ich sity in der Dammerung und warte. / Warte, warte aufHntwort. Ich babegelautet mit tausend Glocken (...) Hat es niemandgehort?“[5] In diese Lebensphase ohne Antwort fallt die Entstehung eines auBergewohnlichen Werks — der „Galgenlieder“ als „Kinder-Rache an des Daseins tiefem Ernst“[6].
Da sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert, ist er zu zahlreichen Sanatorien-Aufenthalten rund um die Alpen gezwungen. In dieser Einsamkeit nahert er sich dem Christentum uber die Gnosis des Meister Eckart und dem Johannes-Evangelium wieder an. „Das Wort Ich kann niemand sprechen als Gott allein“, konstatiert er und ebnet damit den Weg fur die kommende mystische Wende.
Die letzten Jahre (1908-11)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Morgensterns letzte Jahre werden seine bedeutendsten und erfulltesten. 1908 lernt er Margareta Grosebuch von Liechternstern (sic!) kennen und findet in ihr die lang gesuchte Seelenverwandte. Am 7. Marz 1910 heiraten die beiden. Die metaphysische Dimension ihrer Liebe wird in einer Dua- lismus-Philosophie dichterisch verarbeitet („Ich und Du“, 1911) Auch eine Wiederbegegnung mit dem Vater wird moglich.
Doch auch auf humoristischer Ebene gelingen Morgenstern neue Glanzpunkte: Seine absurd komische Gedichtsammlung „Palm-
strom“ versammelt Episoden aus dem Leben eines liebenswerten Eigen- brotlers und seines rein geistigen, erfindungsfreudigen Freundes von Korf.
Zum wichtigsten Ereignis in Morgensterns Vita wird jedoch die Bekanntschaft mit dem Publizisten Rudolf Steiner und seiner allumfassenden anthroposophischen Lehre, auf die naher einzugehen hier nicht der Platz ist. Lassen wir Morgenstern mit seiner Interpretation dieser Philosophie, die fur ihn eine Offenbarung ist, selbst zu Wort kommen: „Alle Geheimnisse liegen in vollkommener Offenheit vor uns. Wir stufen uns nur gegen sie ab, vom Stein bis zum Seher. Es gibt kein Geheimnis an sich, es gibt nur Uneingeweihte aller Grade.“ Seinem neuen geistigen Fuhrer widmet er den Gedichtband „Wir fanden einen Pfad“; er begleitet ihn auf Vortragsreisen und schlieBt mit ihm eine fruchtbare Freundschaft.
Dem intellektuellen Hohenflug folgt ein immer rascherer korperlicher Niedergang. Morgenstern erkrankt an Bronchitis und verbringt die letzten Monate seines Lebens, gepflegt von seiner Gattin, in Meran im Sudtirol, wo er am 31. Marz 1911 stirbt.[3] [4] [5] [6]
Die „Galgenlieder“
„Ich habe die Welt gu Flugsandgedacbt, dock konnte icb das Kind in mir nicbt toten
Entstehung
Die ersten „Galgenlieder“ stammen aus der zweiten Halfte der 90er Jahre. Sie waren fur das private Amusement einer Gruppe von „funf bis zehn Freunden“ rund um Morgenstern gedacht. Vorgetragen wurden sie unter ironisch-schauerlichen Ritualen in ebendiesem privaten Kreise. Der Titel ruhrt vom sogenannten „Galgenberg“ bei Potsdam her, zu dem Ausfluge unternommen wurden. Fur diese ersten Galgenlieder ist gesichert, dass es ursprunglich wirklich gesungene Lieder waren. Mit der Zeit wuchsen die Werke um solche, die nur noch indirekt etwas mit „Galgen“ zu tun hatten und nicht mehr fur die „Rituale“ bestimmt waren.
Einen eigenen „Mythos“ zur Entstehung der Galgenlieder gestaltete Morgenstern in dem kurzen Vorwort „Wie die Galgenlieder entstanden“ aus. Der anspielungsreiche Text (z. B. Mt 5,13, „Ihr seid das Salz der Erde“) parodiert die Marchen- sowie Bibelsprache und erzielt durch diese Uberhohung einen zusatzlichen absurd-komischen Effekt.
Obwohl Morgenstern die Werke zeitweise sogar verbrennen wollte, lieB er sie im Marz 1905 aufgrund der positiven Resonanz beim Vortrag in Cabarets drucken. Die Beiwerke (kritische Anmerkungen etc.) wurden erst 1921 postum veroffentlicht. Die Widmung „Dem Kind im Manne“ bezieht sich auf das Nietzsche-Zitat „Im achten Manne ist ein Kind versteckt; das will spielen.“ aus dem ersten Buch des „Zarathustra“ im Kapitel „Von alten und jungen Weiblein“[7] [8].
Morgensterns Humor-Philosophie und Sprachkritik
„Werheifituberhaupt?Man nenntihn.><[8]
Seinen Humor definiert Morgenstern als „Bewusstwerden des Gegensatzes zwischen Ding an sich und Erscheinung und die hieraus entspringende souverane Weltbetrachtung, welche die gesamte Erscheinungswelt, vom GroBten bis zum Kleinsten, mit gleichem Mitgefuhl umschlieBt, ohne ihr jedoch einen anderen als relativen Gehalt und Wert zugestehen zu konnen.“
Bereits die Einleitung „Wie die Galgenlieder entstanden“ sowie das erste, programmatische Gedicht „Galgenberg“ macht die eine philosophische Grundhaltung deutlich: „Die Galgenpoesie ist ein Stuck Weltanschauung. (...) Ein Galgenbruder ist die beneidenswerte Zwischenstufe zwischen Mensch und Universum (...) Man sieht vom Galgenberg die Welt anders“; „Gerade das, was unabwendlich, / fruchtet unsrem Spott als Ziel.“ Diese Haltung entspricht dem nietzscheanischen „Amor fati“ — das Unabwendliche so hinnehmen, wie es ist, und durch Kunst verschonern — und parodiert es zugleich, indem diese „Verschonerung“ gleichsam „spottisch“ betrachtet wird. Der Humor sieht in der Vielheit die Einheit (namlich das Absurde). Somit ist der Humor die hochststehende „Abwehrleistung“ gegen den Nihilismus.
In Anklang an Nietzsches „Umwertung aller Werte“ fordert Morgenstern die „Umwortung aller Worte“: In seiner Weltsicht ist den Menschen der direkte geistige Zugang zu den Dingen nicht moglich (es gibt fur ihn keine Ding-Welt an sich), also kann die Sprache diese Dinge auch nur sehr unzulanglich beschreiben. Die Arbitraritat der Sprache erscheint ihm absurd: „Wird man nie begreifen, daB Worte nur Entscheidungen sind, nicht Erkenntnisse?“
Die „Sprach-Spiel-Welt“[9] der Galgenlieder
- Spiel mit bildlicben Ausdrucken und Etymologie: z. B. „Die drei Winkel“, die mittels eines lateinischen „Zauberspruchs“, der auf die Volksetymologie des folgenden Begriffs anspielt, zu „Winkeladvokaten“ verwandelt werden
- Spiel mit Homonymen: z. B., „Zwolf-Elf“ im Sinne von „Elf“ = 1. Zahl, 2. Fabelwesen
- Spiel mit Neologismen: z. B. der „Gingganz“ als neues Wort fur einen „in Gedanken Verlorenen“ — hier im absurden Bezug auf einen Stiefel, dem das Wandern lastig wird und der deshalb ausgezogen werden will, dabei jedoch von seinem „Knecht“ darauf aufmerksam gemacht wird, dass er gerade ohne Herrn umherlauft und folglich freimllig wandert
- Reimspiele: „Das asthethische Wiesel“ als Parodie auf das dichterisch verbreitete Phanomen der Zweckreime (z. B. durch extrem gebrochene Reime: „das raffinier- / te Tier“)
- Klangspiele: z. B. „Das groBe Lalula“ als reines, sinnbefreites Lautspiel und „Fisches Nachtgesang“ als stummes Klanggedicht und Bildgedicht in einem (Zeichen des elementum breve w = Schuppen, Titel = Schwanz)
Beiwerke zu den Galgenliedern
Morgenstern erfand den „Privatgelehrten“ Dr. phil. Jeremias Mueller und lieB ihn (nach erstem Zogern — ein „BrieP‘ Muellers an Morgenstern zeugt davon) einen Kommentar zu seinen Galgenliedern schreiben („22 Galgenlieder und deren gemeinverstandliche Deutung“). Mit diesem absurd-pedantischen „kritischen Apparat“ parodiert Morgenstern die vertrackte Schreibweise der Geisteswissenschaftler sowie ihre Neigung zu Uber-Interpretationen.
- „Versuch einer Einleitung“: Der „Versuch einer Einleitung“ ist ein Paradebeispiel der germanistischen Maxime „Viel reden, nichts sagen“. Seinen Gipfelpunkt erreicht der Text im letzten, 169 Worter lange Satz, der keinen wirklichen Inhalt hat, gleichwohl grammatikalisch korrekt und sinnvoll ist. Sein „Grundgerust“ lautet wie folgt: „Es darf daher getrost enthauptet werden, [...] daB hier [d. h. in den Galgenliedern] einem sozumaBen und im Sinne der Zeit [...] hydratherapeutischen [sic] Moment ersten Ranges [...] gegenubergestanden und beigewohnt werden zu durfen gelten lassen zu mussen sein mochte.“ — soll heiBen, es darf „enthauptet“ werden, dass es sein mochte (= konnte), dass man gelten lassen muss, dass man hier einem „hydratherapeutischen Moment ersten Ranges“ gegenuberstehen und beiwohnen darf.
- „Vorreden“ von Lichtwar Gelasius: Lichtwar Gelasius ist eine weitere erfundene Gestalt, die sich hier in barocker Ausdrucksweise — auch die Rechtschreibung ist dem teilweise angepasst („Krewz“) — als Urheber des „Lustigen Buchs“ (der „Galgenlieder“) vorstellt, in dem „ein gut Stuck Sonne“ eingefangen ist.
Literarische Tradition
Vorbilder fur Morgensterns Galgenlieder ist besonders das reiche Repertoire der deutschen Kinderlieder. Auch in die Tradition der „Eulenspiegeleien“ reiht sich Morgenstern mit seinem Werk ein. Besondere Bedeutung fur Morgenstern sollte auch dem Barockschriftsteller Johann Fischart (1545—91) beigemessen werden. Bereits hier finden sich Sprachspiele bis hin zur Lautlyrik („Nun trara tpapw gluk trara tpapa [...]“), Reimspiele („Der Knecht, der muss deBhalben wandern, / Zog darnach reimenshalb nach Flandern“) und ausufernde Neologismen („Affentheurlich Naupengeheurliche Geschichtklitterung“, Titel seines wichtigsten Werks).
Reaktionen
Die Reaktionen auf Morgensterns Galgenlieder fielen uberwiegend positiv aus. Auch wenn es Stimmen gab, die sich uber den „hoheren Nonsens“ echauffierten und ihn als Blodsinn verwarfen, herrschte das Urteil des Literaturhistorikers Georg Witkowski vor: „Wer ihnen [den Galgenliedern] tiefer in die lustigen Ratselaugen schaut, sieht daraus ein tiefes, dem tragischen Durchdringen der groBen Zusammenhange verwandtes Weltwissen hervorleuchten.“ Zu den Bewunderern gehorten unter anderem Kurt Tucholsky und Hermann Hesse.
Literaturliste
BAUER, Michael: Christian Morgensterns Leben und Werk. Munchen 1954 (1933)
MORGENSTERN, Christian: Gesammelte Werke. Munchen 1965
PoSTMA, Heiko:um des Reimes willen“. Uber den Poeten Christian Morgenstern (1871—1914). Hannover 2015 WALTER, Jurgen: Sprache und Spiel in Christian Morgensterns Galgenliedern. Munchen 1966
[1] Postma 2015, S. 3
[2] Kein Wunder, denn Morgenstern lebte exakt in der Friedenszeit kurz nach dem Ende des deutsch-franzosischen Krieges und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
[3] Der Enthusiasmus geht so weit, dass er zeitweise wunscht, auf seinem Grabstein die Worte ,,Lest Lagarde!“ einzumeiBeln.
[4] Als da waren: Verzweifelte Sinnsuche, Aufstieg des Materialismus durch technischen Fortschritt &ct.
[5] aus: ,,Mensch Wanderer“, 1905, zitiert nach BAUER 1954
[6] aus dem eroffnenden Gedicht ,,Galgenberg“
[7] Noch besser bekannt ist dieses Kapitel fur das schlieBende Zitat des „alten Weibleins": „Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!"
[8] aus: „Wie die Galgenlieder entstanden"
Häufig gestellte Fragen zu Christian Morgenstern, die Mystik und der Weltumfasser, Weltveracher Humor
Wer war Christian Morgenstern?
Christian Morgenstern (1871-1914) war ein deutscher Dichter, der vor allem für seine humoristischen Werke, insbesondere die "Galgenlieder", bekannt ist. Er war aber auch ein philosophischer Schriftsteller, der sich mit Mystik und Weltanschauung auseinandersetzte.
Was sind die "Galgenlieder"?
Die "Galgenlieder" sind eine Sammlung von absurd-komischen Gedichten, die Morgenstern ab den 1890er Jahren schrieb. Sie zeichnen sich durch Sprachspiele, Neologismen, Reimspiele und Klangspiele aus und parodieren oft traditionelle literarische Formen.
Was ist Morgensterns Humor-Philosophie?
Morgenstern definierte seinen Humor als das Bewusstwerden des Gegensatzes zwischen Ding an sich und Erscheinung. Er sah im Humor eine Möglichkeit, die Absurdität der Welt zu erkennen und ihr mit Mitgefühl zu begegnen. Er forderte eine "Umwortung aller Worte", da er die Sprache als unzulänglich zur Beschreibung der Dinge ansah.
Wie entstanden die "Galgenlieder"?
Die ersten "Galgenlieder" entstanden im privaten Kreis und wurden unter ironisch-schauerlichen Ritualen vorgetragen. Der Titel bezieht sich auf den "Galgenberg" bei Potsdam. Morgenstern verfasste auch einen eigenen "Mythos" zur Entstehung der "Galgenlieder", der die Märchen- und Bibelsprache parodiert.
Was sind die "Beiwerke" zu den Galgenliedern?
Die "Beiwerke" zu den Galgenliedern sind kritische Anmerkungen und Kommentare, die Morgenstern dem fiktiven "Privatgelehrten" Dr. phil. Jeremias Mueller zuschrieb. Damit parodierte er die vertrackte Schreibweise der Geisteswissenschaftler und ihre Neigung zu Über-Interpretationen.
Was beeinflusste Morgensterns Werk?
Morgensterns Werk wurde von verschiedenen Einflüssen geprägt, darunter die deutsche Kinderlieder-Tradition, die "Eulenspiegeleien", Friedrich Nietzsche und der Barockschriftsteller Johann Fischart. Später in seinem Leben fand er auch Inspiration in der Anthroposophie Rudolf Steiners.
Wie wurde Morgensterns Werk aufgenommen?
Die Reaktionen auf Morgensterns "Galgenlieder" waren überwiegend positiv. Obwohl es auch kritische Stimmen gab, die den "höheren Nonsens" ablehnten, wurde sein Werk von vielen als tiefgründig und humorvoll zugleich geschätzt.
Welche Rolle spielte Mystik in Morgensterns Leben?
Morgenstern hatte schon in seiner Jugend mystische Erlebnisse. Später näherte er sich dem Christentum über die Gnosis des Meister Eckart und dem Johannes-Evangelium wieder an. Seine mystische Seite findet sich vor allem in seinen idealistischen Gedichtbänden.
- Quote paper
- Stefan Candid Depenheuer (Author), 2018, Christian Morgenstern, die Mystik und der "Weltumfasser, Weltverächter" Humor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441212