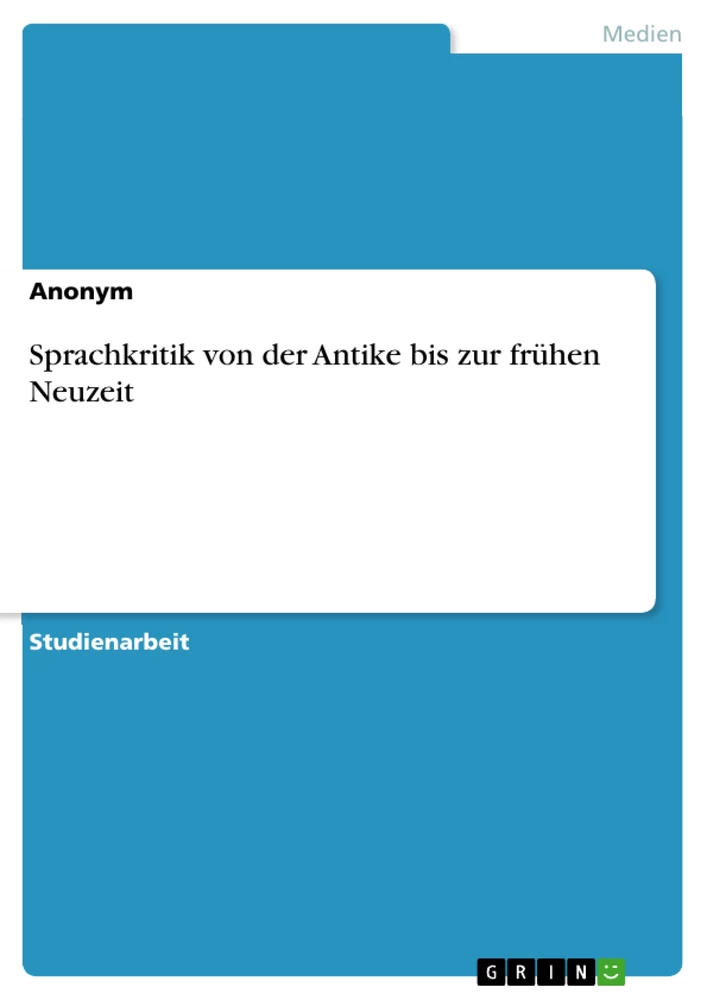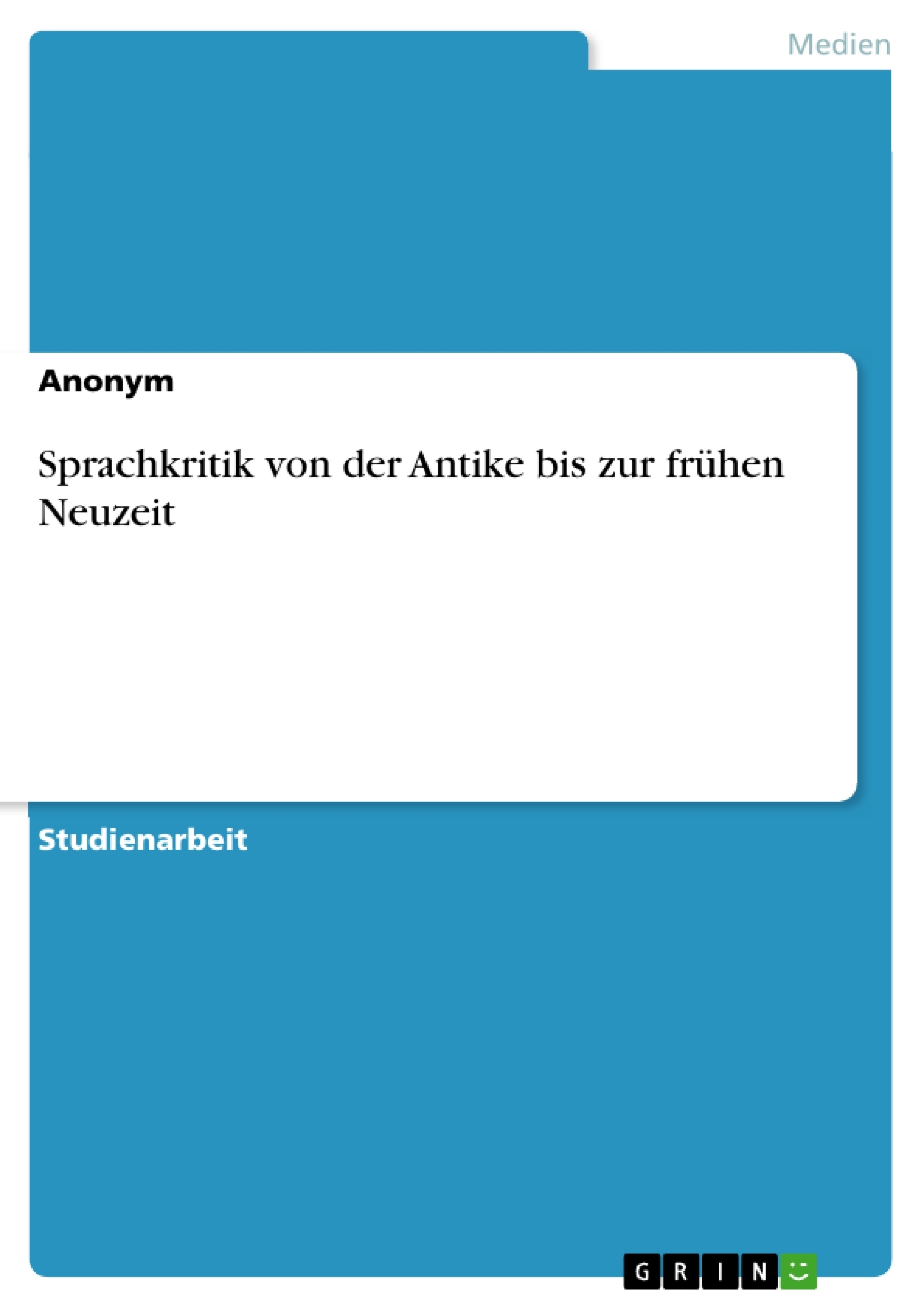Versucht man die Sprachkritik von den anderen Fachgebieten abzugrenzen und den Bereich zu überblicken, den dieser Begriff abdeckt, so wird schnell deutlich, dass dieses Vorhaben nicht einfach zu realisieren ist und viele Schwierigkeiten mit sich bringt.
Von der Vergangenheit bis zur Gegenwart wurden die unterschiedlichsten Ansätze ausprobiert und die vielfältigsten Methoden angewandt. Sie wurden erprobt, abgelehnt und wieder aufgenommen. Geändert haben sich mit der Zeit lediglich die Möglichkeiten.
Kritisiert wurde die Sprache als Ganzes, ihre Teile (z.B. Grammatik oder Rechtschreibung), ihr Sprachgebrauch und Funktion (z.B. in der Politik) und natürlich auch der Sprecher und sein sprachliches Können.
Sprachkritik wurde als Mittel der Erkenntnis und der Wahrheitsfindung angesehen. Sie wurde als Wortkritik betrieben. Wobei die Vergangenheitsform, wegen der Gegenwartsbezogenheit dieser Sachverhalte, nicht ganz zutreffend scheint.
Dies sind das Interessante und das Besondere an der Sprachkritik und ihren Ansatzpunkten, nämlich, dass obwohl sie ihre Anfänge in der Antike haben, sie ihre Relevanz bis heute nicht verloren haben. Mehr noch, die Aktualität der sprachkritischen Problemstellungen bietet immer noch ein breites Feld für die Untersuchungen und Diskussionen.
Ferner ist Sprachkritik zugleich auch Gesellschaftskritik, wie es bei Wolfgang Beutin heißt. „Die zahlreichen historischen Beispiele der Sprachkritik bezeugen: Sprachkritik war allzu oft ein Vehikel der Kritik an ideologischen oder sonstigen gesellschaftlichen Zuständen, und Ideologie- und Gesellschaftskritiker bedienten sich nicht selten sprachkritischer Argumentation“ (Beutin 1976).
Die Urteile, die im Laufe der Zeit über die Sprache und die Kritik an ihr gefällt wurden, sind sehr widersprüchlich und zerstreut.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Versuch einer Definition von Sprachkritik.
- Platons «Kratylos»
- Allgemeines zu dem Dialog.
- Beweisführungen in dem Dialog.
- Ergebnisse des Dialogs
- Universalienstreit
- Der entscheidende Anstoß zu dem Sprachenwechsel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sprachkritik von ihren Anfängen in der Antike bis zur frühen Neuzeit. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Sprachkritik und den Übergang von der Universalsprache zu der deutschen Sprachkritik nachzuzeichnen. Dabei wird insbesondere auf den Dialog „Kratylos“ von Platon eingegangen, der als Beginn der Sprachkritik in der europäischen Geistesgeschichte gilt.
- Die Relevanz der Sprachkritik und ihre verschiedenen Ansätze
- Die philosophische, moralische, politische und literarische Sprachkritik
- Die Entwicklung der Sprachkritik von der Antike bis zur frühen Neuzeit
- Der Einfluss des Universalienstreits auf die Sprachkritik
- Der Übergang von der Universalsprache zu der deutschen Sprachkritik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung unterstreicht die Relevanz und Komplexität des Themas Sprachkritik. Im zweiten Kapitel wird versucht, eine Definition von Sprachkritik zu liefern, die sich an den verschiedenen Richtungen und Zielsetzungen orientiert. Im dritten Kapitel wird Platons Dialog „Kratylos“ analysiert. Zuerst wird auf die allgemeine Ausgangssituation eingegangen, dann auf die Beweisführung und schließlich auf die Ergebnisse des Dialogs für die Sprachkritik. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Universalienstreit im Mittelalter und dessen Bedeutung für die Sprachkritik. Das fünfte Kapitel erläutert den Übergang von Latein zu Deutsch in der frühen Neuzeit.
Schlüsselwörter
Sprachkritik, Antike, Platon, Kratylos, Universalienstreit, Mittelalter, Neuzeit, deutsche Sprache, Universalsprache.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2008, Sprachkritik von der Antike bis zur frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441130