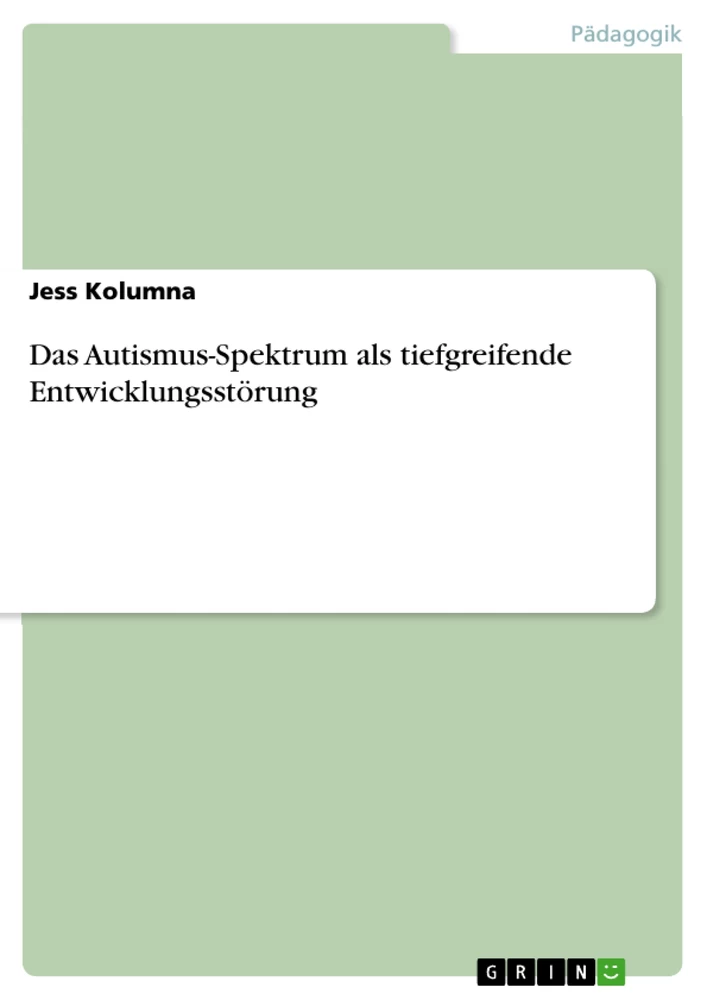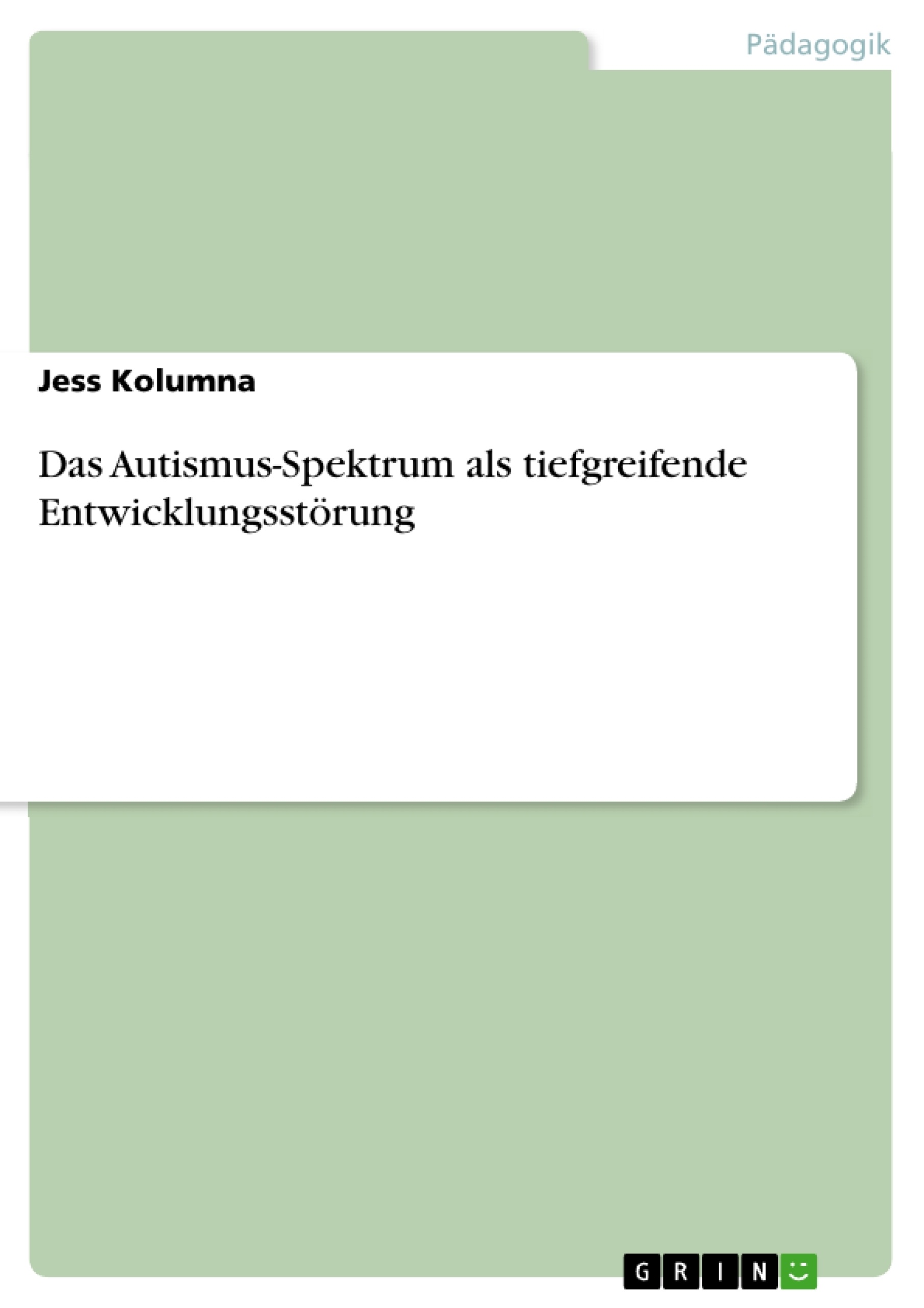Unter Autismus versteht man eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die eine Beeinträchtigung der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie der Verhaltensvaribilität impliziert. Tiefgreifend bedeutet, dass ein ganzes Spektrum an Beeinträchtigungen existiert, die sich auf „[…] Bereiche des Wahrnehmens, Verhaltens und der Emotionen“ beziehen können und die Entwicklung eines Kindes tiefgreifend beeinflussen. Bei Autismus ist nicht von einer Behinderung oder Krankheit zu reden, sondern eher von einer Besonderheit oder einem „Anderssein“. Eine Störung entwickelt sich häufig erst durch gesellschaftliche Einflüsse in Form von Ausgrenzungen, die zu Stresssymptomen und psychischen Störungen bei Betroffenen führen können.
Seinen Ursprung hat der Autismus als Symptom der Schizophrenie, geprägt durch den Psychiater Eugen Bleuler im Jahr 1911 unter Rückkopplung auf die starke Zurückgezogenheit der Betroffenen. Erst 1938 stellte der Kinderarzt Hans Asperger einen Zusammenhang mit psychisch auffälligen Kindern im Hinblick auf das Autismus-Syndrom, von da an auch „Asperger-Syndrom“ genannt. Eine Konkretisierung machte Leo Kanner 1943, indem die autistische Störung mit einer Problematik des affektiven Kontakts in Zusammenhang gebracht wurde. Auch die Zurückführung auf ein erzieherisches Fehlverhalten war eine weit verbreitete, mittlerweile widerlegte Annahme. Heute wird Autismus, ähnlich wie auch ADHS, als genetisch bedingte und tiefgreifende Entwicklungsstörung auf neurologischer Grundlage betrachtet, welche durch zusätzliche Belastungen aus dem Umfeld zu einer psychischen Störung ausarten kann. Ursachen von Autismus sind biologisch-neurologisch begründet, da Fehlbildungen bzw. Anomalien in den Hirnstrukturen sowie -funktionen zu beobachten sind. Das Kleinhirn, welches für Motorik, Koordination und Sprechmuskulatur zuständig ist, ist bei autistischen Menschen beispielsweise kleiner. Des Weiteren wird am limbischen System, welches mit der Amygdala für Emotionen und Sozialverhalten zuständig ist, geforscht. Festzuhalten ist, dass sowohl genetische als auch Umweltfaktoren wie Komplikationen oder Fehlverhalten in der Schwangerschaft Auswirkungen auf das Gehirn und damit auf eine autistische Beeinträchtigung haben können.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Autismus?
- Welche Formen gibt es?
- Was sind die Symptome?
- Wie diagnostiziert man Autismus?
- Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
- Wie sind die Prognosen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Vorlesung „Entwicklungsneurologie und Krankheiten des Kindesalters“ befasst sich mit dem Autismus-Spektrum als tiefgreifende Entwicklungsstörung. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Formen von Autismus, die typischen Symptome, die Diagnostik sowie die verschiedenen Therapiemöglichkeiten.
- Definition und Charakteristika des Autismus-Spektrums
- Unterscheidung verschiedener Formen von Autismus, z.B. Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, Atypischer Autismus
- Symptombilder und Verhaltensauffälligkeiten bei Autismus
- Diagnostische Verfahren und die Rolle von Klassifikationssystemen
- Therapiemöglichkeiten und die Bedeutung der frühzeitigen Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
Was ist Autismus?
Autismus wird als eine tiefgreifende Entwicklungsstörung definiert, die die soziale Interaktion und Kommunikation sowie die Verhaltensvariabilität betrifft. Der Text beleuchtet den historischen Hintergrund des Autismus und seine Entwicklung von einem Symptom der Schizophrenie zu einer genetisch bedingten Entwicklungsstörung auf neurologischer Grundlage.
Welche Formen gibt es?
Der Text beschreibt drei Hauptformen von Autismus: das Asperger-Syndrom, den Frühkindlichen Autismus (Kanner-Syndrom) und den Atypischen Autismus. Die Unterschiede zwischen diesen Formen liegen in den Ursachen, den Symptomen und dem Schweregrad der Beeinträchtigungen.
Was sind die Symptome?
Die Symptome von Autismus werden in zwei Kategorien eingeteilt: Frühsymptome bei Kleinkindern und spätere, sich entwickelnde Symptome im Bereich Sprache, Wahrnehmung, sozialer Interaktion, Steuerung von Emotionen und Interessen. Der Text hebt zudem positive Merkmale von Autisten, wie z.B. besondere Begabungen, hervor.
Wie diagnostiziert man Autismus?
Der Text erklärt die Diagnose von Autismus durch Kinderärzte, Psychiater, Neurologen und klinische Psychologen. Die Diagnose basiert auf einer gründlichen Anamnese, Untersuchung und Beobachtung, wobei die Klassifikationssysteme „ICD 10“ und „DSM IV“ als Maßstab dienen. Es werden verschiedene Instrumente zur Diagnose von Autismus vorgestellt, die auf der Beobachtung von Verhaltensmustern und dem Mangel spezifischer Fähigkeiten basieren.
Schlüsselwörter
Autismus-Spektrum, tiefgreifende Entwicklungsstörung, soziale Interaktion, Kommunikation, Verhaltensvariabilität, Asperger-Syndrom, Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus, Symptome, Diagnostik, Therapiemöglichkeiten, Prognosen, genetische Faktoren, Umweltfaktoren, neurologische Grundlage, Klassifikationssysteme, ICD 10, DSM IV.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Autismus im medizinischen Sinne?
Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung auf neurologischer Grundlage, die soziale Interaktion, Kommunikation und Verhaltensvariabilität beeinträchtigt.
Welche Formen des Autismus werden unterschieden?
Es wird zwischen dem Frühkindlichen Autismus (Kanner-Syndrom), dem Asperger-Syndrom und dem Atypischen Autismus differenziert.
Was sind typische neurologische Ursachen für Autismus?
Beobachtet werden Anomalien in Hirnstrukturen, wie ein kleineres Kleinhirn oder Veränderungen im limbischen System (Amygdala), die Emotionen und Motorik steuern.
Wie wird Autismus heute diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt durch Fachärzte basierend auf Anamnese und Beobachtung unter Anwendung von Klassifikationssystemen wie ICD-10 oder DSM-IV.
Welche Rolle spielen Umweltfaktoren bei der Entstehung?
Neben genetischen Faktoren können auch Komplikationen während der Schwangerschaft Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung und somit auf eine autistische Beeinträchtigung haben.
Gibt es positive Merkmale bei Menschen im Autismus-Spektrum?
Ja, viele Betroffene zeigen besondere Begabungen und Inselbegabungen in spezifischen Interessenbereichen.
- Quote paper
- Jess Kolumna (Author), 2017, Das Autismus-Spektrum als tiefgreifende Entwicklungsstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441095