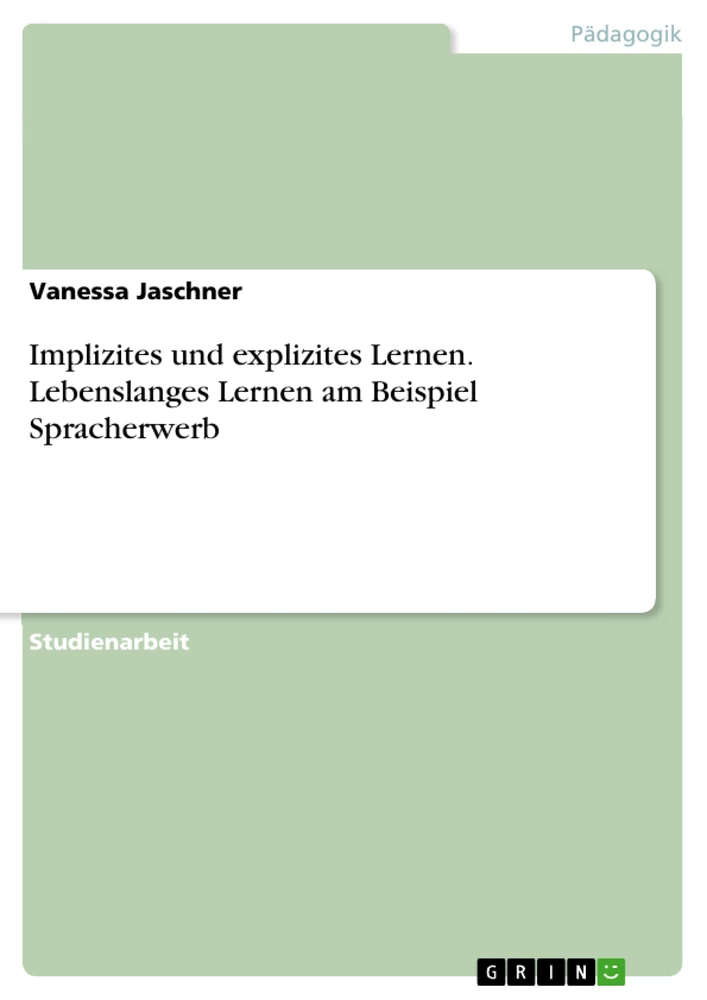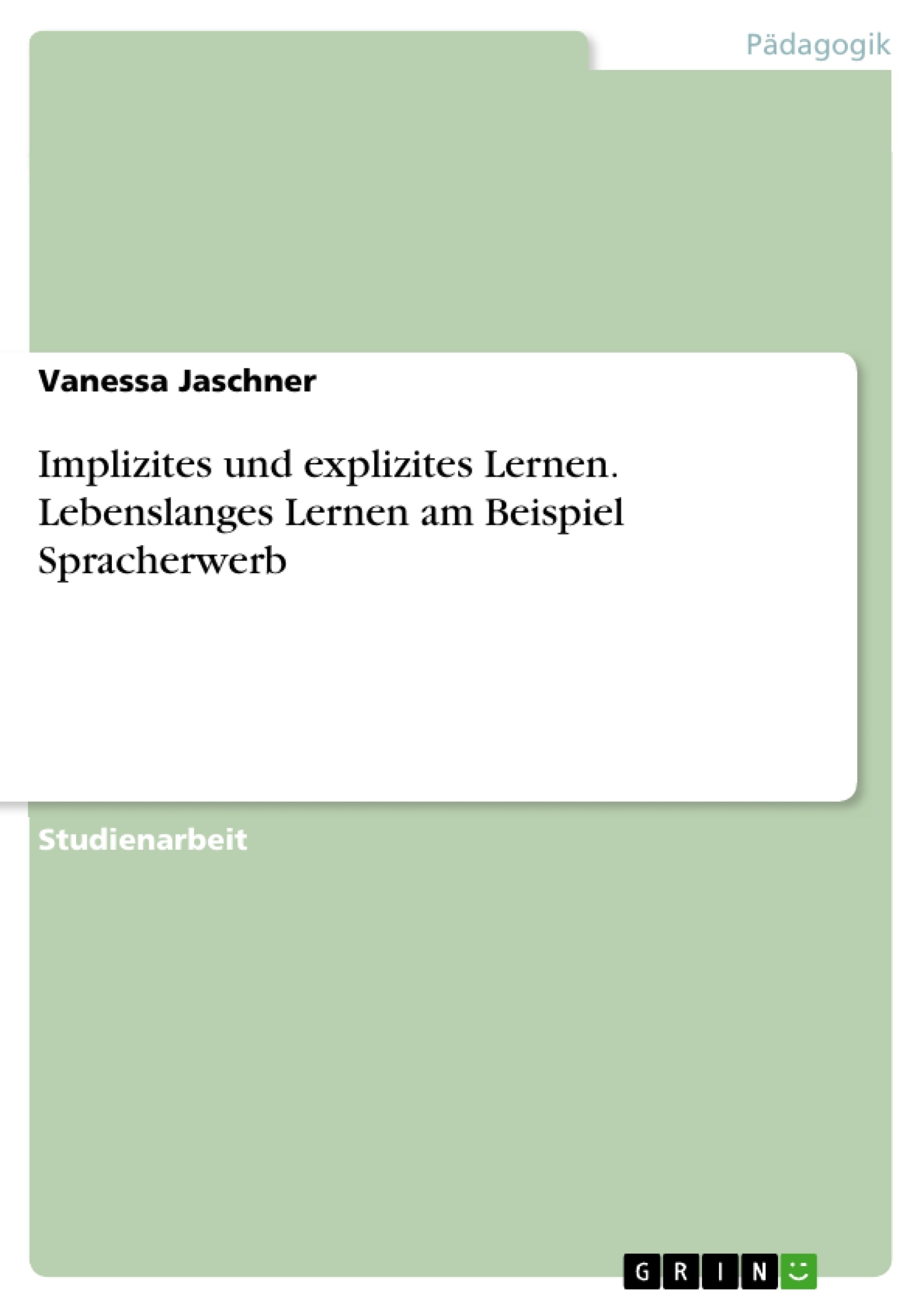„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.“ Hinter diesem bekannten Sprichwort steckt die Aussage, dass man in jungen Jahren natürlich in der Lage ist Neues zu lernen, dies im Erwachsenenalter allerdings nicht mehr möglich ist. Doch entspricht das wirklich den Tatsachen? Ist es während der Kindheit wirklich leichter zu lernen? Und verliert das Gedächtnis diese Lernfähigkeit im Laufe der Jahre? Ist es schlussfolgernd daraus überhaupt noch möglich im höheren Alter Neues zu lernen? Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der damit verbundenen Verlängerung der Erwerbszeit ergibt sich die Notwendigkeit nach lebenslangem Lernen. Erst kürzlich wurde das Rentenalter auf 67 Jahre angehoben. Ein Berufseinsteiger mit 20 Jahren hat demnach eine theoretische Erwerbszeit von knapp 50 Jahren vor sich. Ob die Kenntnisse aus einer, in jungen Jahren absolvierten Berufsausbildung über solch einen langen Zeitraum ausreichen, soll kritisch betrachtet werden. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Weiterbildungen oder eventuell sogar Neuorientierungen zum beruflichen Lebenslauf in Zukunft dazu gehören. Lebenslanges Lernen wird somit als Grundvoraussetzung zum Erhalt der Erwerbstätigkeit gesehen.
Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser zu vermitteln, dass Lernen, trotz abnehmender Leistungsfähigkeit im Alter, durchaus lebenslang möglich ist. Lernen sollte nicht mit einer negativen Prägung, wie sie vielleicht aus Schulzeiten entstanden ist, behaftet sein, da Lernen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und einer sich schnell wandelnden Gesellschaft eine Notwendigkeit darstellt die Erwerbsfähigkeit langfristig zu erhalten und sich im Alter im Alltag gut zurecht zu finden. Die Arbeit stellt dar, wie in den unterschiedlichen Lebensphasen auf unterschiedliche Art Wissen aufgenommen und abgespeichert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau und Ziel der Arbeit
- Definition Lernen und lebenslanges Lernen
- Gedächtnis
- Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
- Kurzzeitgedächtnis
- Lernen als Ergebnis der Langzeitspeicherung
- Explizites Wissen
- Deklaratives (explizites) Gedächtnis
- Explizites Lernen
- Implizites Können
- Non-deklaratives (implizites) Gedächtnis
- Implizites Lernen
- Wissen und Können
- Implizites und explizites Lernen im Verlauf des Lebens am Beispiel Spracherwerb
- Diskussionsteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens, insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel und die damit verbundene Verlängerung der Erwerbszeit. Sie beleuchtet die verschiedenen Gedächtnisprozesse und Lernmechanismen, um zu zeigen, dass Lernen über die gesamte Lebensspanne möglich ist, trotz altersbedingter Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten. Die Arbeit widerlegt die Annahme, dass Lernfähigkeit im Alter abnimmt.
- Das menschliche Gedächtnis und seine verschiedenen Speicherfunktionen
- Explizites und implizites Lernen: Unterschiede und Zusammenhänge
- Altersbedingte Veränderungen des Gedächtnisses und deren Auswirkungen auf das Lernen
- Lebenslanges Lernen als Notwendigkeit im Kontext des demografischen Wandels
- Der Spracherwerb als Beispiel für lebenslanges Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des lebenslangen Lernens ein und widerlegt das Sprichwort "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr". Sie betont die Notwendigkeit lebenslangen Lernens angesichts des demografischen Wandels und der verlängerten Erwerbszeit. Der Aufbau der Arbeit und das Ziel, den Leser von der Möglichkeit des lebenslangen Lernens zu überzeugen, werden dargelegt. Die Arbeit definiert Lernen als Prozess der Informationsaufnahme und als Ergebnis, das im Gedächtnis gespeichert wird und sich als verändertes Verhalten manifestiert.
Gedächtnis: Dieses Kapitel beschreibt das Gedächtnis und seine verschiedenen Speicherfunktionen. Es erklärt, wie Informationen aufgenommen, verarbeitet und letztendlich als Lernergebnis resultieren. Die Unterkapitel befassen sich mit Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sowie dem Kurzzeitgedächtnis, die als Vorstufen zum Langzeitgedächtnis und damit zum eigentlichen Lernprozess betrachtet werden. Die Beschreibung dieser Prozesse bildet die Grundlage für das Verständnis der späteren Kapitel über explizites und implizites Lernen.
Lernen als Ergebnis der Langzeitspeicherung: Dieses Kapitel differenziert zwischen explizitem und implizitem Wissen und Lernen. Es erklärt das deklarative (explizite) und das non-deklarative (implizite) Gedächtnis und erläutert die jeweiligen Lernmechanismen. Die Unterscheidung zwischen Wissen und Können wird ebenfalls thematisiert, was für das Verständnis der verschiedenen Lernformen essentiell ist. Die Kapitel liefern eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Gedächtnissysteme und ihrer Interaktionen im Lernprozess.
Implizites und explizites Lernen im Verlauf des Lebens am Beispiel Spracherwerb: Dieses Kapitel veranschaulicht die Anwendung der zuvor erläuterten Lernmechanismen im Kontext des Spracherwerbs über die Lebensspanne. Es analysiert, wie sich explizite und implizite Lernprozesse in verschiedenen Lebensphasen manifestieren und wie diese Strategien für optimales Lernen genutzt werden können. Der Spracherwerb dient als anschauliches Beispiel für die Anpassungsfähigkeit des menschlichen Gehirns und die Möglichkeit des lebenslangen Lernens.
Schlüsselwörter
Lebenslanges Lernen, Gedächtnis, explizites Lernen, implizites Lernen, Spracherwerb, Wissen, Können, demografischer Wandel, Altersbedingte Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lebenslanges Lernen – Gedächtnisprozesse und Lernmechanismen
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens, insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel und die damit verbundene Verlängerung der Erwerbszeit. Sie widerlegt die Annahme, dass Lernfähigkeit im Alter abnimmt und beleuchtet verschiedene Gedächtnisprozesse und Lernmechanismen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt das menschliche Gedächtnis und seine Speicherfunktionen, explizites und implizites Lernen (mit Unterschieden und Zusammenhängen), altersbedingte Veränderungen des Gedächtnisses und deren Auswirkungen auf das Lernen, lebenslanges Lernen im Kontext des demografischen Wandels und den Spracherwerb als Beispiel für lebenslanges Lernen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Gedächtnis, Lernen als Ergebnis der Langzeitspeicherung (explizit und implizit), ein Kapitel zum impliziten und expliziten Lernen am Beispiel Spracherwerb und einen Diskussionsteil. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird unter explizitem und implizitem Lernen verstanden?
Explizites Lernen bezieht sich auf bewusstes und absichtliches Lernen, das im deklarativen Gedächtnis gespeichert wird. Implizites Lernen hingegen ist unbewusst und findet im non-deklarativen Gedächtnis statt. Die Arbeit erläutert die jeweiligen Lernmechanismen und Unterschiede detailliert.
Welche Rolle spielt der demografische Wandel?
Der demografische Wandel mit der verlängerten Erwerbszeit wird als wichtiger Kontext für die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens hervorgehoben. Die Arbeit argumentiert, dass Anpassungsfähigkeit und Lernfähigkeit über die gesamte Lebensspanne erhalten bleiben.
Wie wird der Spracherwerb in die Arbeit eingebunden?
Der Spracherwerb dient als anschauliches Beispiel für lebenslanges Lernen. Das Kapitel analysiert, wie sich explizite und implizite Lernprozesse in verschiedenen Lebensphasen beim Spracherwerb manifestieren und wie diese Strategien für optimales Lernen genutzt werden können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Lebenslanges Lernen, Gedächtnis, explizites Lernen, implizites Lernen, Spracherwerb, Wissen, Können, demografischer Wandel und altersbedingte Veränderungen.
Welche Aussage wird in der Einleitung widerlegt?
Die Einleitung widerlegt das Sprichwort "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" und betont die Möglichkeit des lebenslangen Lernens.
Wie definiert die Arbeit "Lernen"?
Lernen wird als Prozess der Informationsaufnahme und als Ergebnis definiert, das im Gedächtnis gespeichert wird und sich als verändertes Verhalten manifestiert.
Welche Kapitel gibt es und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zur Einleitung, zum Gedächtnis (inkl. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Kurzzeitgedächtnis), zum Lernen als Ergebnis der Langzeitspeicherung (explizit und implizit), zum impliziten und expliziten Lernen am Beispiel Spracherwerb und einen Diskussionsteil. Jedes Kapitel behandelt die Thematik detailliert und veranschaulicht die Zusammenhänge.
- Quote paper
- Vanessa Jaschner (Author), 2017, Implizites und explizites Lernen. Lebenslanges Lernen am Beispiel Spracherwerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441036