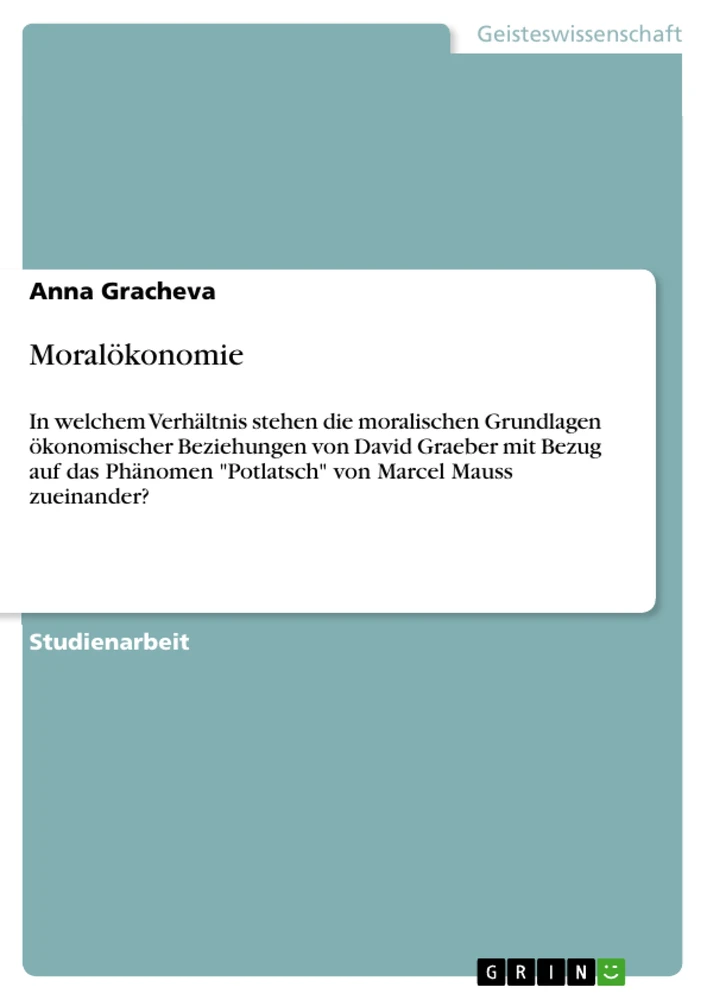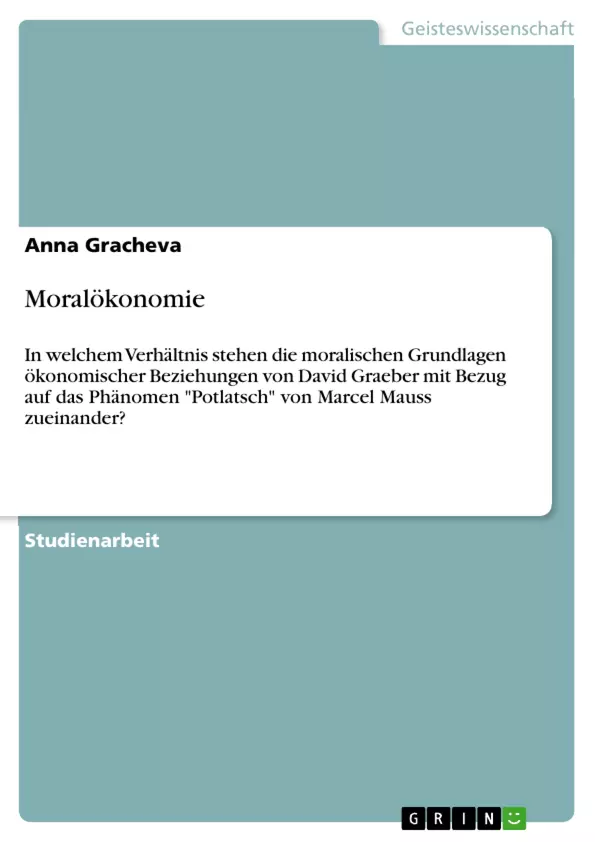In dieser Hausarbeit sollen die Konzepte der Theorien von Mauss und Graeber näher betrachtet werden. Diese vorliegende Hausarbeit behandelt die Frage: In welchem Verhältnis die moralischen Grundlagen ökonomischer Beziehungen von David Graeber mit Bezug auf das Phänomen „Potlatsch" von Marcel Mauss zueinanderstehen.
Es werden die von David Graeber formulierten drei moralischen Prinzipien Kommunismus, Hierarchie, Austausch (das Letztere mit Bezug auf Mauss’ „Potlatsch“) miteinander verglichen, mit der Erwartung, dass sie Reziprozität implizieren und, im Grunde genommen, voneinander nicht zu unterscheiden sind. Denn jedes von den Prinzipien beruht nur auf zwei gesellschaftlichen Funktionen: Beziehungsstiftende Funktion und Anerkennungsstiftende Funktion.
Zuerst wird ein Überblick auf die Gabentheorie von Marcel Mauss und auf die Abhandlung über die moralischen Grundlagen ökonomischer Beziehungen von David Graeber geschaffen. Danach werden beziehungsstiftende und anerkennungsstiftende Funktionen skizziert, die diesen Prinzipien folgen sollen. Nach der begrifflichen Klärung der gesellschaftlichen Funktionen werden die moralischen Grundlagen (Kommunismus, Hierarchie und Tausch) näher behandelt. Zu jedem Prinzip werden die Beispiele angeführt, mit der Erwartung, dass jedes Prinzip die beziehungs- und anerkennungsstiftenden Funktionen beinhaltet und erfüllt. Schließlich werden die Schlussfolgerungen gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Einblicke in die Moralökonomie
- 1. Marcel Mauss: Die Gabe
- 2. David Graeber: Moralische Grundlagen ökonomischer Beziehungen
- III. Begriffliche Klärung
- 1. Beziehungsstiftende Funktion
- 2. Anerkennungsstiftende Funktion
- IV. Moralische Prinzipien
- 1. Kommunismus
- 2. Hierarchie
- 3. Austausch/Potlatsch
- a) Potlatsch
- b) Tausch
- V. Fazit
- VI. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Verhältnis zwischen den moralischen Grundlagen ökonomischer Beziehungen nach David Graeber und dem Phänomen des Potlatsch bei Marcel Mauss. Es wird analysiert, inwiefern Graebers drei moralische Prinzipien – Kommunismus, Hierarchie und Austausch – mit Mauss' Konzept des Gabentauschs und insbesondere des Potlatsch zusammenhängen.
- Vergleich der moralischen Prinzipien von Graeber (Kommunismus, Hierarchie, Austausch).
- Analyse der beziehungsstiftenden und anerkennungsstiftenden Funktionen ökonomischer Beziehungen.
- Untersuchung des Potlatsch als extreme Form der Reziprozität im Kontext von Mauss' Gabentheorie.
- Beurteilung der Relevanz von Vertrauen und Gegenseitigkeit in den unterschiedlichen ökonomischen Modellen.
- Erörterung der impliziten Reziprozität in scheinbar nicht-reziproken Beziehungen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Graebers Theorie der moralischen Grundlagen ökonomischer Beziehungen und Mauss' Analyse des Potlatsch. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der den Vergleich der drei moralischen Prinzipien Graebers (Kommunismus, Hierarchie, Austausch) beinhaltet und ihre Verbindung zu den beziehungsstiftenden und anerkennungsstiftenden Funktionen erforscht. Die Arbeit erwartet, dass alle drei Prinzipien Reziprozität implizieren und letztlich untrennbar miteinander verbunden sind.
II. Einblicke in die Moralökonomie: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die relevanten Theorien von Mauss und Graeber. Es präsentiert Mauss' Konzept des Gabentauschs mit seiner dreifachen Verpflichtung (Geben, Nehmen, Erwidern) und die Analyse des Potlatsch als extreme Form der Reziprozität, die gleichzeitig beziehungsstiftende und anerkennungsstiftende Funktionen erfüllt. Graebers Abkehr von einer rein tauschbasierten Sichtweise wird vorgestellt, wobei seine drei moralischen Prinzipien – Kommunismus, Hierarchie und Austausch – als Grundlage sozialer und ökonomischer Interaktionen eingeführt werden. Die Kapitel erläutert die spezifischen Charakteristika jedes Prinzips und implizite Reziprozitätsformen.
III. Begriffliche Klärung: Dieses Kapitel beleuchtet die beziehungsstiftende und anerkennungsstiftende Funktion der ökonomischen Beziehungen im Detail. Es untersucht die Rolle des Vertrauens im Kontext der gegenseitigen Hilfe und Kooperation. Es wird argumentiert, dass die Erwartung der Gegenleistung ein Element des Vertrauens darstellt und die erfolgreiche Erwiderung dieses Vertrauen bestätigt. Die Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse der moralischen Prinzipien.
Schlüsselwörter
Moralökonomie, Gabentausch, Potlatsch, Marcel Mauss, David Graeber, Reziprozität, Kommunismus, Hierarchie, Austausch, Beziehungsstiftende Funktion, Anerkennungsstiftende Funktion, Vertrauen, Gegenseitigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Moralökonomie und Potlatsch
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen den moralischen Grundlagen ökonomischer Beziehungen nach David Graeber und dem Phänomen des Potlatsch bei Marcel Mauss. Der Fokus liegt auf dem Vergleich von Graebers drei moralischen Prinzipien (Kommunismus, Hierarchie und Austausch) mit Mauss' Konzept des Gabentauschs und insbesondere des Potlatsch.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Theorien von Marcel Mauss (Gabentausch, Potlatsch) und David Graeber (drei moralische Prinzipien: Kommunismus, Hierarchie und Austausch) um die moralischen Grundlagen ökonomischer Beziehungen zu analysieren.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie Graebers drei moralische Prinzipien mit Mauss' Konzept des Gabentauschs und des Potlatsch zusammenhängen. Sie analysiert die beziehungsstiftenden und anerkennungsstiftenden Funktionen ökonomischer Beziehungen, die Rolle des Potlatsch als extreme Form der Reziprozität und die Bedeutung von Vertrauen und Gegenseitigkeit in verschiedenen ökonomischen Modellen. Die implizite Reziprozität in scheinbar nicht-reziproken Beziehungen wird ebenfalls erörtert.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, der die drei moralischen Prinzipien Graebers analysiert und ihre Verbindung zu den beziehungsstiftenden und anerkennungsstiftenden Funktionen erforscht. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Reziprozität in den verschiedenen ökonomischen Modellen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel mit Einblicken in die Moralökonomie (Mauss und Graeber), ein Kapitel zur begrifflichen Klärung (Beziehungs- und Anerkennungsstiftende Funktionen), ein Kapitel zu den moralischen Prinzipien (Kommunismus, Hierarchie, Austausch/Potlatsch), ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Moralökonomie, Gabentausch, Potlatsch, Marcel Mauss, David Graeber, Reziprozität, Kommunismus, Hierarchie, Austausch, Beziehungsstiftende Funktion, Anerkennungsstiftende Funktion, Vertrauen und Gegenseitigkeit.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit geht davon aus, dass alle drei moralischen Prinzipien Graebers (Kommunismus, Hierarchie und Austausch) Reziprozität implizieren und letztlich untrennbar miteinander verbunden sind.
Wie wird der Potlatsch in der Arbeit behandelt?
Der Potlatsch wird als extreme Form der Reziprozität im Kontext von Mauss' Gabentheorie untersucht und seine beziehungsstiftenden und anerkennungsstiftenden Funktionen analysiert.
Welche Rolle spielt das Vertrauen?
Vertrauen und Gegenseitigkeit spielen eine zentrale Rolle in der Analyse der verschiedenen ökonomischen Modelle. Die Erwartung der Gegenleistung wird als Element des Vertrauens betrachtet, und die erfolgreiche Erwiderung bestätigt dieses Vertrauen.
- Arbeit zitieren
- Anna Gracheva (Autor:in), 2016, Moralökonomie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/440871