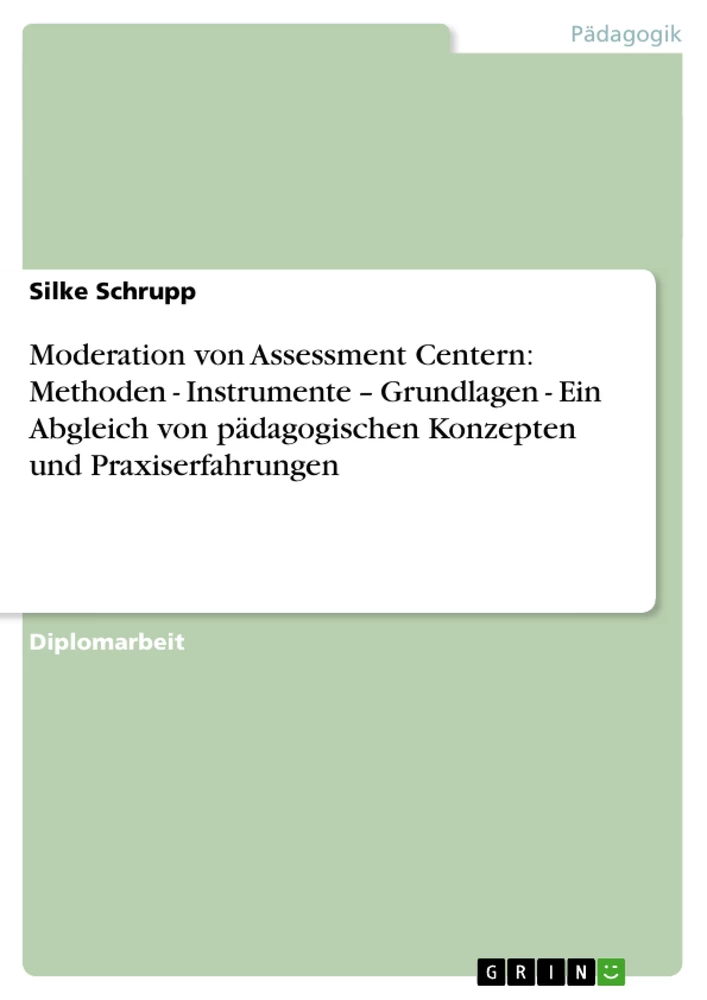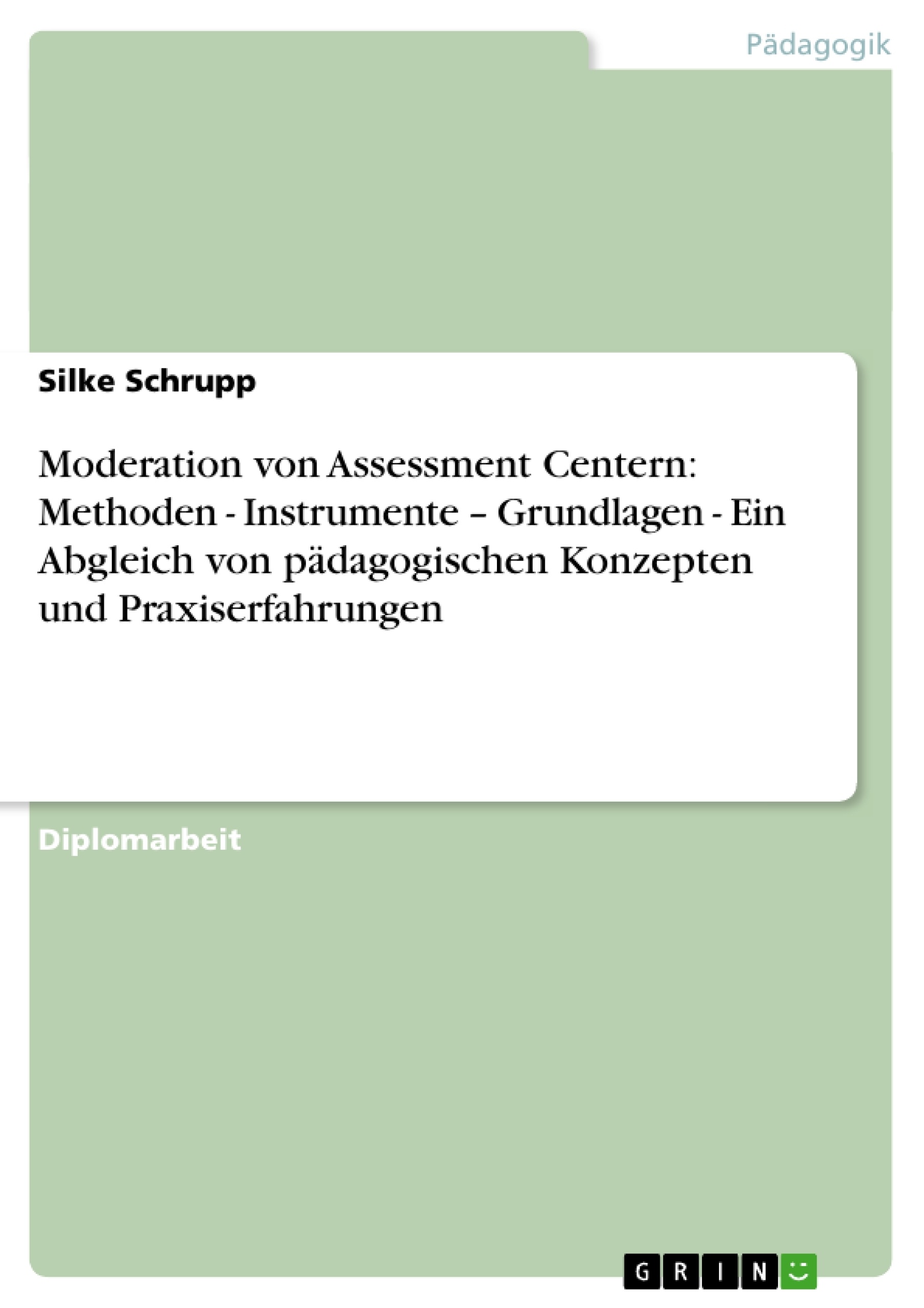Im Rahmen meiner Moderationsausbildung an der Universität Bielefeld konnte ich erfahren, wie wichtig die innere Haltung des Moderators ist. Ich habe Moderationstechniken und Interventionsmöglichkeiten bei der Arbeit mit Gruppen kennen gelernt. Ich konnte erfahren, welche gruppendynamischen Effekte in den einzelnen Lern- und Arbeitsphasen entstehen und wie man als Moderator mit Konflikten in der Gruppe umgehen sollte. Immer wieder wurde mir dabei bewusst, dass man bei der Arbeit mit Gruppen Menschen und deren Bedürfnisse ernst nehmen muss. Außerdem konnte ich feststellen, dass nicht nur die Methode, sondern auch die Persönlichkeit, das Auftreten und die Art zu kommunizieren, Erfolgsfaktoren für Moderation sind. Diese Erkenntnisse sind für mich auch bei meiner Arbeit als Moderatorin von Beobachtergruppen bei Assessment Centern sehr hilfreich gewesen. Andererseits musste ich feststellen, dass ich nicht alles, was ich gelernt und für richtig und gut befunden habe, in diesem Rahmen umsetzen konnte. Das Verfahren Assessment Center ist so angelegt, dass organisatorische Rahmenbedingungen und Wünsche des Kunden die Möglichkeiten einschränken, die Moderationssituationen in jeder Hinsicht teilnehmer-orientiert zu gestalten.
Ausgehend von dieser Erfahrung möchte ich nun die Moderation von Assessment Centern genauer betrachten. Es soll dabei zunächst um eine allgemeine Beschreibung der moderierten Situationen in einem Assessment Center gehen und um die Methoden, die dabei eingesetzt werden. Der Fokus der vorliegenden Arbeit soll allerdings auf der Moderation der Beobachterdiskussionen liegen. Im Verlauf dieser Diskussionen wird die Entscheidungsfindung der Beobachter hinsichtlich einer Beurteilung der Teilnehmer moderiert (im Anschluss an die Übungen, die die Teilnehmer absolvieren).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Moderationsmethode
- 2.1 Geschichte der Moderation
- 2.2 Aufgaben eines Moderators
- 2.3 Moderationstechniken
- 2.4 Auftreten und Persönlichkeit des Moderators
- 2.5 Anwendungsbereiche und Arten der Moderation
- 2.5.1 Konfliktmoderation
- 2.5.2 Entscheidungsmoderation
- 3. Das Assessment Center
- 3.1 Geschichte des Assessment Centers
- 3.2 Ziele der Methode Assessment Center im Sinne der Personalauswahl und Personalentwicklung
- 3.3 Konstruktionsregeln und Qualitätsmaßstäbe für Assessment Center
- 3.4 Kritische Elemente der Methode Assessment Center
- 3.4.1 Validierungsprobleme
- 3.4.2 Wahrnehmung und Beurteilung
- 3.4.3 Kommunikationsprobleme
- 3.5 Durchführung eines Assessment Centers
- 3.5.1 Ablauf und Übungen
- 4. Pädagogischer Hintergrund der Moderationsmethode
- 4.1 Theoretische Grundlagen der Moderationsmethode
- 4.2 Gruppenpädagogik und Moderation
- 4.3 Erwachsenenbildung und Moderation
- 4.4 Elemente der Moderationsmethode betrachtet unter pädagogischer Perspektive
- 4.4.1 Die Kommunikationsregeln und der Ansatz der Humanistischen Pädagogik
- 4.4.1.1 Das Menschenbild der Humanistischen Pädagogik
- 4.4.1.2 Gruppenleitung und Kommunikationsregeln bei der Themenzentrierten Interaktion
- 4.4.2 Der Austausch von Beobachtungen, Wissen und Erfahrungen und der Ansatz des pädagogischen Konstruktivismus
- 4.4.2.1 Das Menschenbild des Konstruktivismus
- 4.4.2.2 Die Moderationsmethode als konstruktivistischer Lernansatz
- 5. Betrachtung der Moderationsmethode im Rahmen des Assessment Centers
- 5.1 Moderierte Situationen im Assessment Center
- 5.2 Die Moderation als Aufgabe des Unternehmensberaters
- 5.3 Anwendung der Themenzentrierten Interaktion auf eine moderierte Konfliktsituation im Assessment Center
- 5.3.1 Fallbeispiel: Beobachterdiskussion nach der Übung „Verhandlungsführung“
- 5.3.2 Analyse des Praxisbeispiels (Konfliktsituation)
- 5.4 Anwendung des konstruktivistischen Lernansatzes auf eine moderierte Entscheidungssituation im Assessment Center
- 5.4.1 Die Konstruktion diskursiv hergestellter Wirklichkeiten im Assessment Center
- 5.4.2 Fallbeispiel: Beobachterdiskussion zur „richtigen“ Mitarbeiterführung
- 5.4.3 Analyse des Praxisbeispiels (Entscheidungssituation)
- Analyse der Aufgaben und Herausforderungen der Moderation im Assessment Center
- Anwendung der Moderationsmethode auf verschiedene Situationen im Assessment Center, insbesondere Beobachterdiskussionen
- Verbindung von pädagogischen Konzepten wie der Humanistischen Pädagogik und dem Konstruktivismus zur theoretischen Fundierung der Moderation im Assessment Center
- Beurteilung der Umsetzbarkeit pädagogischer Prinzipien im Assessment Center
- Kritische Reflexion der Grenzen der Moderation im Rahmen des Assessment Centers
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Die Moderationsmethode
- Kapitel 3: Das Assessment Center
- Kapitel 4: Pädagogischer Hintergrund der Moderationsmethode
- Kapitel 5: Betrachtung der Moderationsmethode im Rahmen des Assessment Centers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle der Moderationsmethode im Kontext von Assessment Centern. Sie beleuchtet die spezifischen Herausforderungen der Moderation von Beobachterdiskussionen im Assessment Center und analysiert die Anwendbarkeit pädagogischer Konzepte auf diese Situation. Das Ziel ist es, die Rolle des Moderators im Assessment Center aus einer pädagogischen Perspektive zu betrachten und seine Handlungsmöglichkeiten sowie Grenzen zu erforschen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Moderation von Assessment Centern ein und erläutert den persönlichen Erfahrungshintergrund der Autorin. Sie stellt das Problemfeld der Moderation in Beobachterdiskussionen im Assessment Center dar und begründet die Relevanz der Arbeit. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse der Moderationssituationen und die Verbindung von pädagogischen Konzepten mit der Moderationsmethode im Kontext des Assessment Centers.
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Moderationsmethode und ihre verschiedenen Aspekte. Es beleuchtet die Geschichte der Moderation, die Aufgaben eines Moderators, verschiedene Moderationstechniken sowie das Auftreten und die Persönlichkeit eines Moderators. Zudem werden die Anwendungsbereiche und Arten der Moderation, insbesondere Konflikt- und Entscheidungsmoderation, behandelt.
Dieses Kapitel widmet sich dem Assessment Center als Verfahren der Personalauswahl und -entwicklung. Es beleuchtet die Geschichte der Methode, die Ziele im Kontext der Personalauswahl und -entwicklung, die Konstruktionsregeln und Qualitätsmaßstäbe sowie die kritischen Elemente, wie Validierungsprobleme, Wahrnehmung und Beurteilung und Kommunikationsprobleme. Schließlich wird auf die Durchführung eines Assessment Centers und den Ablauf von Übungen eingegangen.
Dieses Kapitel untersucht den pädagogischen Hintergrund der Moderationsmethode. Es beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Moderation, den Zusammenhang mit der Gruppenpädagogik und der Erwachsenenbildung sowie die pädagogischen Aspekte der Moderationsmethode. Im Detail werden die Kommunikationsregeln und der Ansatz der Humanistischen Pädagogik sowie der Austausch von Beobachtungen, Wissen und Erfahrungen und der Ansatz des pädagogischen Konstruktivismus betrachtet.
Dieses Kapitel analysiert die Anwendung der Moderationsmethode im Kontext des Assessment Centers. Es betrachtet die moderierten Situationen im Assessment Center, die Rolle des Moderators als Unternehmensberater und die Anwendung von Konzepten wie der Themenzentrierten Interaktion und dem konstruktivistischen Lernansatz auf konkrete Situationen im Assessment Center. Darüber hinaus werden Fallbeispiele zur Beobachterdiskussion nach der Übung „Verhandlungsführung“ und zur „richtigen“ Mitarbeiterführung sowie die Analyse der Praxisbeispiele aus Konflikt- und Entscheidungssituationen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Assessment Center, Moderation, Beobachterdiskussion, Humanistische Pädagogik, Konstruktivismus, Teilnehmerorientierung, Entscheidungsfindung, Konfliktmoderation, Validierung, Kommunikationsprobleme, pädagogische Konzepte, Personalauswahl, Personalentwicklung.
- Quote paper
- Silke Schrupp (Author), 2005, Moderation von Assessment Centern: Methoden - Instrumente – Grundlagen - Ein Abgleich von pädagogischen Konzepten und Praxiserfahrungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44071