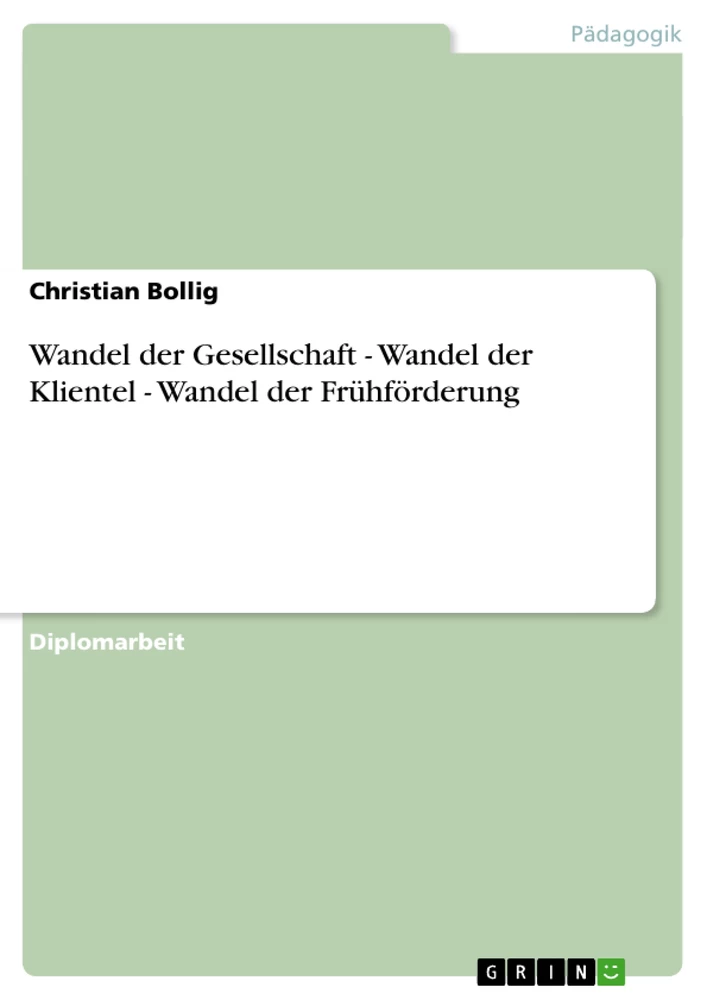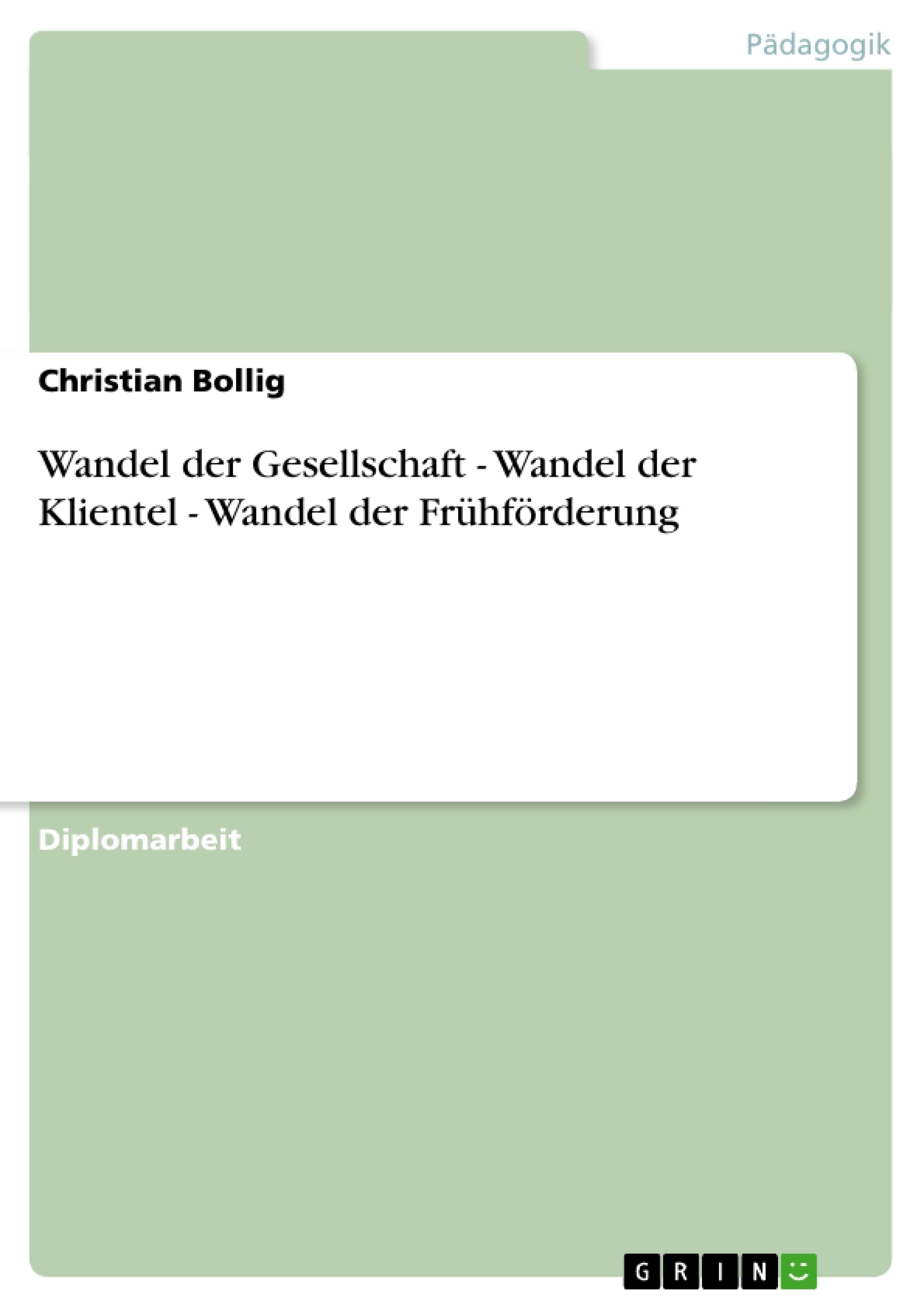Den Ursprung meiner Auseinandersetzung mit dem Thema der vorliegenden Arbeit stellen meine Beobachtungen während eines Praktikums im „Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung“ in Köln dar. Am nachhaltigsten beschäftigte mich der Umstand, dass von der Gesamtzahl der Kinder, die ich im Rahmen der heilpädagogischen Frühförderung miterlebte, nur ein einziges Kind als im „klassischen“ Sinne behindert diagnostiziert war. Alle anderen Kinder erhielten frühförderliche Maßnahmen, da bei ihnen zwar keine manifesten Behinderungsbilder vorlagen, sie jedoch in ihrer Entwicklung in unterschiedlichen Bereichen beeinträchtigt waren. Gespräche mit den Mitarbeitern der Einrichtung und die zur Frühförderung vorliegende Fachliteratur zeigten, dass diese Verteilung nicht repräsentativ für die gesamte Frühförderung ist, jedoch in ihrer Tendenz eine Realität der Frühförderung darstellt: seit Bestehen der Frühförderung haben sich Kinder mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten, von denen ein Großteil aus psychosozial belasteten Familien stammt, zur anteilig größten Gruppe der von Frühförderung betreuten Kinder entwickelt.
Aus der Auseinandersetzung mit dieser Thematik entwickelte sich die dieser Arbeit zugrundeliegende, zweigeteilte Fragestellung:
1. Lassen sich Gründe ausfindig machen für eine Zunahme des Anteils der
2. Welches sind die Konsequenzen für die Frühförderung bezogen auf die Arbeit mit dieser Zielgruppe?
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Gesellschaftliche Wandlungsprozesse
- 1.1 Theoretische Grundlagen
- 1.1.1 Sozialstruktur
- 1.1.2 Theorie des sozialen Wandels
- 1.2 Gesellschaftliche Krise
- 1.2.1 Soziale Ungleichheit
- 1.2.2 Sozio-ökonomische Polarisierung
- 1.3 Soziale Randgruppen
- 1.3.1 Arme
- 1.3.1.1 Was ist Armut?
- 1.3.1.2 Konzepte der Armutsforschung
- 1.3.1.3 Entwicklung und Ausmaß der Armut
- 1.3.1.4 Besondere Risikogruppen
- 1.3.2 Langzeitarbeitslose
- 1.3.2.1 Entwicklung und Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit
- 1.3.2.2 Besondere Risikogruppen
- 1.3.3 Soziale und psychische Auswirkungen der Randständigkeit
- 1.4 Wandel von Familie
- 1.4.1 Bedeutungswandel des Begriffs „Familie“
- 1.4.2 Demographische Entwicklung und Wandel von Familie
- 1.4.2.1 Eheschließung und Scheidung
- 1.4.2.2 Geburtenentwicklung und Kinderzahl
- 1.4.2.3 Pluralität von Familien- und Lebensformen
- 1.4.2.4 Einschätzung und Bewertung dieser Entwicklungen
- 1.5 Zwischenbilanz
- 2. Gefährdungen der Kindheit
- 2.1 Gefährdungen der Kindheit aufgrund der Veränderungen familialer Strukturen
- 2.1.1 Auswirkungen von Scheidung
- 2.1.2 Auswirkungen der geringeren Kinderzahl
- 2.2 Gefährdungen der Kindheit im Kontext sozioökonomischer Wandlungsprozesse und deprivierender Lebensumstände
- 2.2.1 Psychosoziale Risiken
- 2.2.2 Armut und psychosoziale Risiken
- 2.2.2.1 Kinderarmut
- 2.2.2.2 Armut im familialen Kontext
- 2.2.2.2.1 Subjektive Belastung und Bewältigung von Armut
- 2.2.2.2.2 Ressourcen als moderierende Faktoren
- 2.2.3 Auswirkungen von Armut auf die kindlichen Entwicklungsbereiche
- 2.3 Zwischenbilanz
- 3. Konsequenzen für die Frühförderung
- 3.1 Wandel innerhalb der Zielgruppe der Frühförderung
- 3.2 Schwerpunkte in der Arbeit der Frühförderung mit psychosozial belasteten Familien
- 3.2.1 Prävention
- 3.2.1.1 Früherkennung von Entwicklungsgefährdungen
- 3.2.1.2 Öffentlichkeitsarbeit und politische Einflussnahme
- 3.2.2 Konzeptuelle Schwerpunkte in der Frühförderung mit psychosozial belasteten Familien
- 3.2.3 Erweiterung der professionellen Netzwerke
- 4. Schluss
- 5. Literaturverzeichnis
- 6. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Veränderungen, dem Wandel der Klientel in der Frühförderung und den daraus resultierenden Konsequenzen für die frühfördernde Praxis. Ziel ist es, die Gründe für die Zunahme von Kindern mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten aus psychosozial belasteten Familien in der Frühförderung zu beleuchten und daraus Handlungsempfehlungen für die zukünftige Arbeit abzuleiten.
- Gesellschaftliche Wandlungsprozesse und soziale Ungleichheit
- Wandel familiärer Strukturen und deren Auswirkungen auf Kinder
- Gefährdungen der kindlichen Entwicklung im Kontext von Armut und sozialen Risiken
- Veränderte Anforderungen an die Frühförderung
- Konzeptuelle und praktische Konsequenzen für die Arbeit in der Frühförderung
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangsbeobachtung des Autors während eines Praktikums in einer Einrichtung für Frühförderung, die den Fokus auf die zunehmende Zahl von Kindern mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten aus psychosozial belasteten Familien lenkt. Diese Beobachtung führt zur zentralen Forschungsfrage nach den Gründen für diesen Anstieg und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Frühförderung. Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel, die gesellschaftliche Veränderungen, deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung und die Konsequenzen für die Frühförderung behandeln.
1. Gesellschaftliche Wandlungsprozesse: Dieses Kapitel analysiert gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland, die mit sozialer Ungleichheit und Armut in Verbindung stehen. Es beleuchtet theoretische Grundlagen des sozialen Wandels, beschreibt das Ausmaß sozialer Ungleichheit und die Herausforderungen für betroffene soziale Gruppen, insbesondere arme Familien und Langzeitarbeitslose. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen dieser Prozesse auf die Entwicklung von Kindern und Familienstrukturen, wobei der Wandel des Familienbegriffs und die demografische Entwicklung detailliert dargestellt werden.
2. Gefährdungen der Kindheit: Kapitel zwei untersucht die Auswirkungen der in Kapitel eins beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen auf die Entwicklung von Kindern. Es analysiert, wie Veränderungen in der Familienstruktur (z.B. Scheidung, geringere Kinderzahl) und sozioökonomische Faktoren (z.B. Armut, psychosoziale Belastungen) die kindliche Entwicklung gefährden können. Der Zusammenhang zwischen Armut, psychosozialen Risiken und den Auswirkungen auf verschiedene Entwicklungsbereiche von Kindern wird umfassend erörtert.
3. Konsequenzen für die Frühförderung: Das dritte Kapitel befasst sich mit den Konsequenzen der veränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten und der daraus resultierenden Zunahme von Kindern aus psychosozial belasteten Familien für die Frühförderung. Es analysiert den Wandel innerhalb der Zielgruppe der Frühförderung und legt dar, welche Schwerpunkte in der Arbeit mit diesen Familien gesetzt werden müssen. Präventive Maßnahmen, konzeptuelle Schwerpunkte und die Erweiterung professioneller Netzwerke werden als wichtige Aspekte diskutiert.
Schlüsselwörter
Frühförderung, gesellschaftlicher Wandel, soziale Ungleichheit, Armut, Familie, kindliche Entwicklung, psychosoziale Belastung, Prävention, Risikofaktoren, Entwicklungsauffälligkeiten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Gesellschaftliche Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Frühförderung
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Das Dokument untersucht den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Veränderungen, dem Wandel der Klientel in der Frühförderung und den daraus resultierenden Konsequenzen für die frühfördernde Praxis. Der Schwerpunkt liegt auf der Zunahme von Kindern mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten aus psychosozial belasteten Familien und der Ableitung von Handlungsempfehlungen für die zukünftige Arbeit in der Frühförderung.
Welche gesellschaftlichen Wandlungsprozesse werden behandelt?
Das Dokument analysiert gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland, die mit sozialer Ungleichheit und Armut in Verbindung stehen. Es beleuchtet theoretische Grundlagen des sozialen Wandels, beschreibt das Ausmaß sozialer Ungleichheit und die Herausforderungen für betroffene soziale Gruppen, insbesondere arme Familien und Langzeitarbeitslose. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Wandel des Familienbegriffs und der demografischen Entwicklung (Eheschließung, Scheidung, Geburtenentwicklung).
Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf Kinder?
Das Dokument untersucht die Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen auf die Entwicklung von Kindern. Es analysiert, wie Veränderungen in der Familienstruktur (z.B. Scheidung, geringere Kinderzahl) und sozioökonomische Faktoren (z.B. Armut, psychosoziale Belastungen) die kindliche Entwicklung gefährden können. Der Zusammenhang zwischen Armut, psychosozialen Risiken und den Auswirkungen auf verschiedene Entwicklungsbereiche von Kindern wird umfassend erörtert.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die Frühförderung?
Das Dokument beschreibt die Konsequenzen der veränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten und der daraus resultierenden Zunahme von Kindern aus psychosozial belasteten Familien für die Frühförderung. Es analysiert den Wandel innerhalb der Zielgruppe der Frühförderung und legt dar, welche Schwerpunkte in der Arbeit mit diesen Familien gesetzt werden müssen. Präventive Maßnahmen, konzeptuelle Schwerpunkte und die Erweiterung professioneller Netzwerke werden als wichtige Aspekte diskutiert.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in fünf Hauptkapitel gegliedert: Einleitung, Gesellschaftliche Wandlungsprozesse, Gefährdungen der Kindheit, Konsequenzen für die Frühförderung und Schlussfolgerungen. Zusätzlich enthält es ein Literaturverzeichnis und einen Anhang.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Frühförderung, gesellschaftlicher Wandel, soziale Ungleichheit, Armut, Familie, kindliche Entwicklung, psychosoziale Belastung, Prävention, Risikofaktoren, Entwicklungsauffälligkeiten.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick, der ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter beinhaltet. Diese Struktur ermöglicht einen schnellen und gezielten Zugriff auf die relevanten Informationen.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Ziel ist es, die Gründe für die Zunahme von Kindern mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten aus psychosozial belasteten Familien in der Frühförderung zu beleuchten und daraus Handlungsempfehlungen für die zukünftige Arbeit abzuleiten.
- Quote paper
- Christian Bollig (Author), 2005, Wandel der Gesellschaft - Wandel der Klientel - Wandel der Frühförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44007