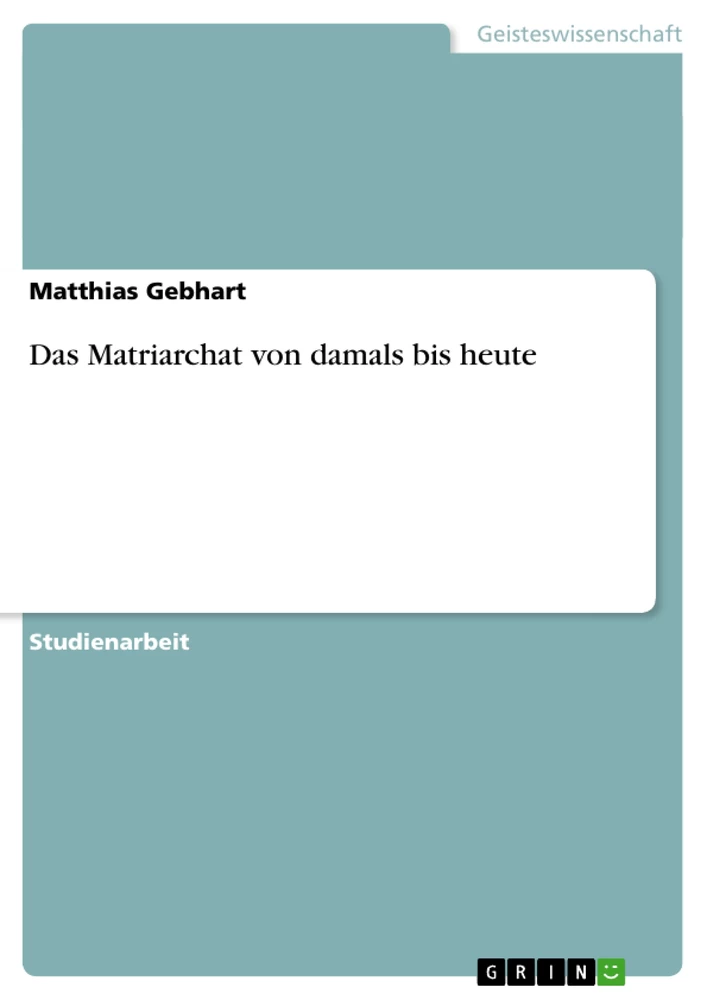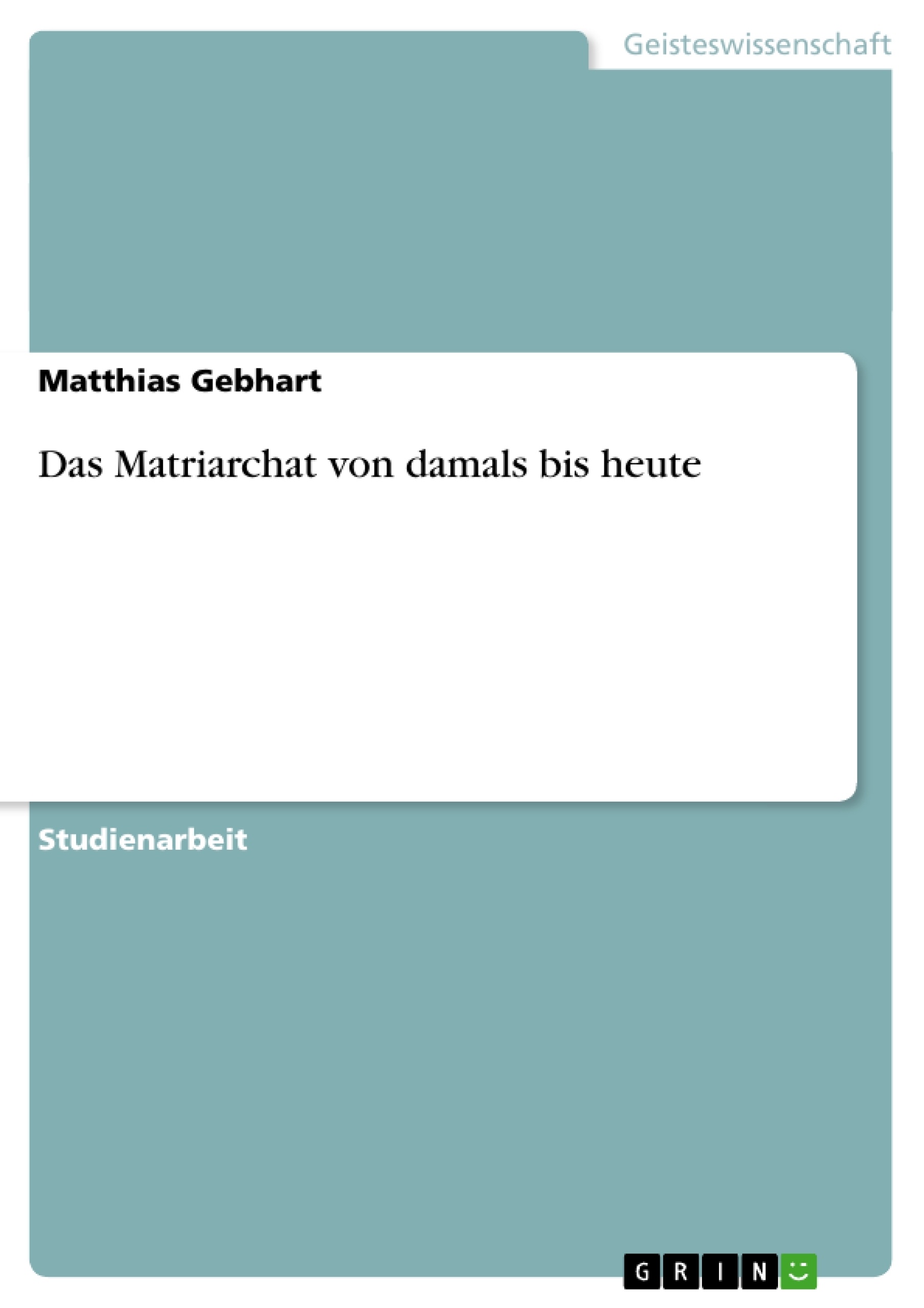Die Könige wurden schon vor langer Zeit gestürzt, die Justiz handelt nach verbindlichen Gesetzen, die soziale Absicherung wurde auf staatliche Beine gestellt; im Normalfall sehen sich die europäischen und nordamerikanischen Industriestaaten als die fortschrittlichsten und freiheitlichsten dieser Welt. Ob allerdings ein 80jähriger Rentner, der von seiner Mindestrente lebt, bei uns wirklich mehr Ansehen und Rechte genießt als in manchen anderen Kulturen ist zweifelhaft. Da jedoch vermutlich jede Gesellschaft sich für die beste hält ist es natürlich nicht verwunderlich, dass wir auch in punkto Gleichberechtigung der Frau die führende Stellung einnehmen. Durch unseren großen Intellekt haben wir es zu Stande gebracht gesellschaftliche Tabus zu durchbrechen, Frauen dürfen jetzt sogar Bundeskanzlerin werden und wählen. Betrachtet man ältere ethnologische Werke wie von Bachofen oder Morgan scheint dies jedoch nur die gerechte Entwicklung, den ihrer Meinung zufolge herrschten zu Beginn der Menschheit die Frauen, bis schließlich irgendwann die Männer an der Reihe waren. Nachdem nun beide Geschlechter jeweils eine Zeit die Oberhand hatten, ist es also kaum verwunderlich, dass sie sich diese Aufgabe nun teilen, schließlich ist herrschen ja auch anstrengend. Bachofen und Morgan sind aber nicht die einzigen die sich zu diesem Thema Gedanken machten, die Rede ist vom Matriarchat. Hiervon handelt die folgende Arbeit. Im Anschluss möchte ich nun zuerst die Anfänge der Matriarchatsdebatte beschreiben und dazu beginnend bei Bachofen mich bis zur jüngsten Vergangenheit vorarbeiten. Danach soll ein kurzer Überblick gegeben werden wie sich die Debatte weiterentwickelte als erstmals fundiertere Fakten zu diesem Thema vorlagen und welche Schlüsse man daraus zog. Im letzten Teil dieser Arbeit soll dann noch ein wenig detaillierter auf die Meinung Göttner- Abendroths eingegangen werden. Ich berufe mich hierbei im wesentlichen auf die Werke „Frauenmacht ohne Herrschaft“ von Ilse Lenz und Ute Luig, „Frauenmacht oder Sklaverei der Urzeit“ von Susanne Schröter und Heide Göttner-Abendroths „Matriarchate als herrschaftsfreie Gesellschaften“.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Das Matriarchat damals und heute
- Am Anfang schuf Gott die Frau
- Johann Jakob Bachofen
- Lewis Henry Morgan
- John Ferguson McLennan
- Edward Alexander Westermarck
- Wilhelm Wundt
- Friedrich Engels
- Mathilde Vaerting
- Bertha Eckstein-Diener
- Erste Studien und ihre Folgen
- Wie das Matriarchat langsam das matriarchale verliert
- Eleanor Leacock
- Alice Schlegel
- Karla Poewe
- Heide Göttner-Abendroth
- Schlussworte
- Anhang: Zitierte Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Debatte um das Matriarchat von ihren Anfängen bis in die jüngere Vergangenheit. Ziel ist es, die Entwicklung der Theorien und Argumente nachzuvollziehen und die wichtigsten Perspektiven aufzuzeigen. Dabei wird der Fokus auf die evolutionistischen Ansätze gelegt und der Einfluss bedeutender Denker beleuchtet.
- Entwicklung der Matriarchatstheorie im 19. und 20. Jahrhundert
- Evolutionistische Perspektiven auf gesellschaftliche Entwicklung
- Die Rolle von Frauen in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen
- Verbindung von Matriarchat, Eigentum und gesellschaftlicher Organisation
- Kritische Auseinandersetzung mit den Theorien des Matriarchats
Zusammenfassung der Kapitel
Das Matriarchat damals und heute: Dieser einleitende Abschnitt gibt einen Überblick über die gesamte Arbeit und skizziert den historischen Verlauf der Matriarchatsdebatte. Es wird die zentrale Frage nach dem Ursprung und der Entwicklung gesellschaftlicher Strukturen behandelt und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven angekündigt. Der Abschnitt dient als Brücke zwischen der Einleitung und den folgenden Kapiteln, die die Debatte im Detail analysieren.
Am Anfang schuf Gott die Frau: Dieses Kapitel präsentiert die frühen Ansätze der Matriarchatsdebatte, beginnend mit Johann Jakob Bachofen und seinem Werk "Das Mutterrecht". Es werden die evolutionistischen Perspektiven der frühen Denker analysiert, die das Mutterrecht als frühe Phase der menschlichen Gesellschaftsentwicklung sahen. Die verschiedenen Theorien von Bachofen, Morgan, McLennan, Westermarck, Wundt, Engels, Vaerting und Eckstein-Diener werden im Kontext ihrer Zeit und ihres Einflusses auf spätere Debatten vorgestellt. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden ihrer Ansätze und den jeweiligen Argumentationslinien.
Erste Studien und ihre Folgen: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Weiterentwicklung der Matriarchatsdebatte nach den ersten bahnbrechenden Werken. Es wird untersucht, wie neue ethnografische Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse die Diskussion beeinflusst haben. Die Kapitel analysiert die Veränderungen in der theoretischen Auseinandersetzung, den Einfluss neuer Forschungsmethoden und die Entwicklung der Kritik an den früh entwickelten Theorien. Es wird eine Brücke zwischen den frühen evolutionistischen Ansätzen und den kritischen Perspektiven der späteren Wissenschaftlerinnen geschaffen.
Wie das Matriarchat langsam das matriarchale verliert: Das Kapitel konzentriert sich auf die Perspektiven von Leacock, Schlegel, Poewe und Göttner-Abendroth. Es analysiert, wie diese Wissenschaftlerinnen die bestehenden Theorien weiterentwickelt und kritisch hinterfragt haben. Die Kapitel beleuchtet die Verschiebung des Fokus von evolutionistischen Modellen hin zu einer differenzierteren Betrachtung unterschiedlicher Gesellschaftssysteme. Der Schwerpunkt liegt auf einer kritischen Auseinandersetzung mit den vorherigen Ansätzen und der Entwicklung neuer theoretischer Frameworks.
Schlüsselwörter
Matriarchat, Mutterrecht, Vaterrecht, Evolutionismus, Gynaikokratie, Ethnologie, Geschlechterrollen, Gesellschaftliche Entwicklung, Eigentum, Familienstrukturen, Ethnografie, Heide Göttner-Abendroth, Lewis Henry Morgan, Johann Jakob Bachofen.
Häufig gestellte Fragen zum Text "Das Matriarchat damals und heute"
Was ist der Hauptgegenstand des Textes "Das Matriarchat damals und heute"?
Der Text untersucht die Debatte um das Matriarchat von ihren Anfängen bis in die jüngere Vergangenheit. Er verfolgt die Entwicklung der Theorien und Argumente nach und beleuchtet die wichtigsten Perspektiven, insbesondere die evolutionistischen Ansätze und den Einfluss bedeutender Denker.
Welche Themenschwerpunkte werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Entwicklung der Matriarchatstheorie im 19. und 20. Jahrhundert, evolutionistische Perspektiven auf gesellschaftliche Entwicklung, die Rolle von Frauen in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen, die Verbindung von Matriarchat, Eigentum und gesellschaftlicher Organisation sowie eine kritische Auseinandersetzung mit den Theorien des Matriarchats.
Welche Wissenschaftler*innen und ihre Theorien werden im Text vorgestellt?
Der Text präsentiert die Ansätze von Johann Jakob Bachofen, Lewis Henry Morgan, John Ferguson McLennan, Edward Alexander Westermarck, Wilhelm Wundt, Friedrich Engels, Mathilde Vaerting und Bertha Eckstein-Diener im Hinblick auf frühe Matriarchatstheorien. Weiterhin werden die Perspektiven von Eleanor Leacock, Alice Schlegel, Karla Poewe und Heide Göttner-Abendroth im Kontext der Weiterentwicklung und kritischen Auseinandersetzung mit diesen Theorien beleuchtet.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text gliedert sich in ein Vorwort, die Kapitel "Das Matriarchat damals und heute" (mit den Unterkapiteln "Am Anfang schuf Gott die Frau" und "Wie das Matriarchat langsam das matriarchale verliert"), Schlussworte und einen Anhang mit der zitierten Literatur. Er enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, Angaben zur Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet der Text?
Der Text bietet Zusammenfassungen zu den Kapiteln "Das Matriarchat damals und heute" (Überblick und historischer Verlauf der Debatte), "Am Anfang schuf Gott die Frau" (frühe Ansätze und evolutionistische Perspektiven), "Erste Studien und ihre Folgen" (Weiterentwicklung der Debatte und Einfluss neuer Erkenntnisse) und "Wie das Matriarchat langsam das matriarchale verliert" (kritische Perspektiven und Weiterentwicklung der Theorien).
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis des Textes relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind Matriarchat, Mutterrecht, Vaterrecht, Evolutionismus, Gynaikokratie, Ethnologie, Geschlechterrollen, Gesellschaftliche Entwicklung, Eigentum, Familienstrukturen, Ethnografie, Heide Göttner-Abendroth, Lewis Henry Morgan und Johann Jakob Bachofen.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text verfolgt das Ziel, die Debatte um das Matriarchat nachzuvollziehen und die wichtigsten Perspektiven aufzuzeigen, mit Fokus auf die evolutionistischen Ansätze und den Einfluss bedeutender Denker.
Für welche Zielgruppe ist der Text bestimmt?
Der Text ist für eine akademische Zielgruppe bestimmt, die sich mit der Geschichte und den Theorien des Matriarchats auseinandersetzen möchte. Die vorgesehene Nutzung ist rein akademisch zur Themenanalyse.
- Citar trabajo
- Matthias Gebhart (Autor), 2004, Das Matriarchat von damals bis heute, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43997