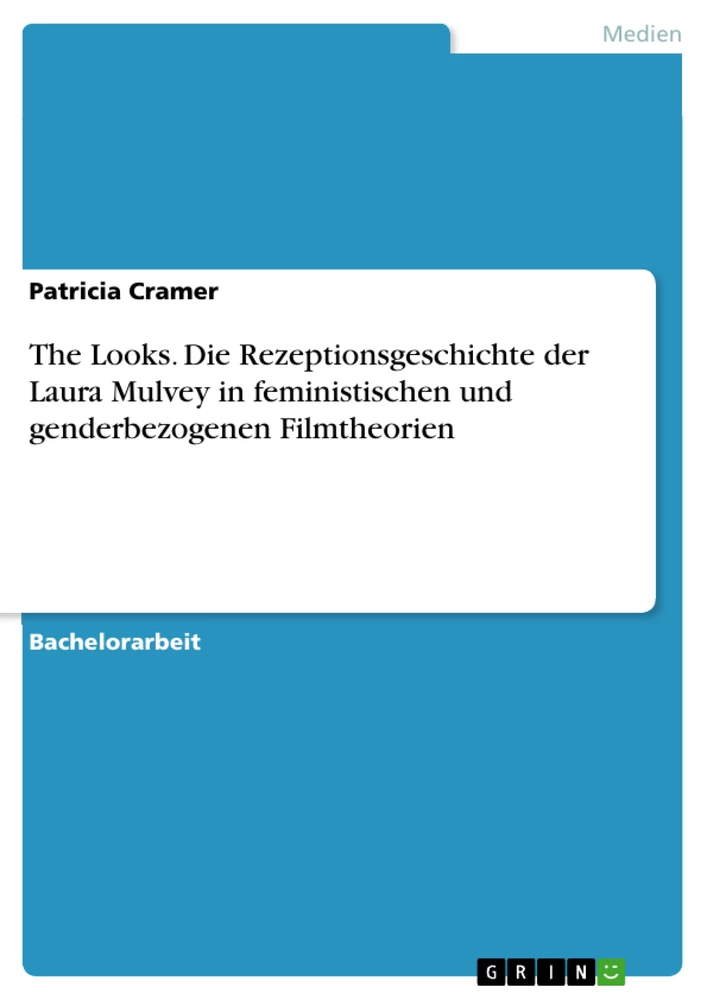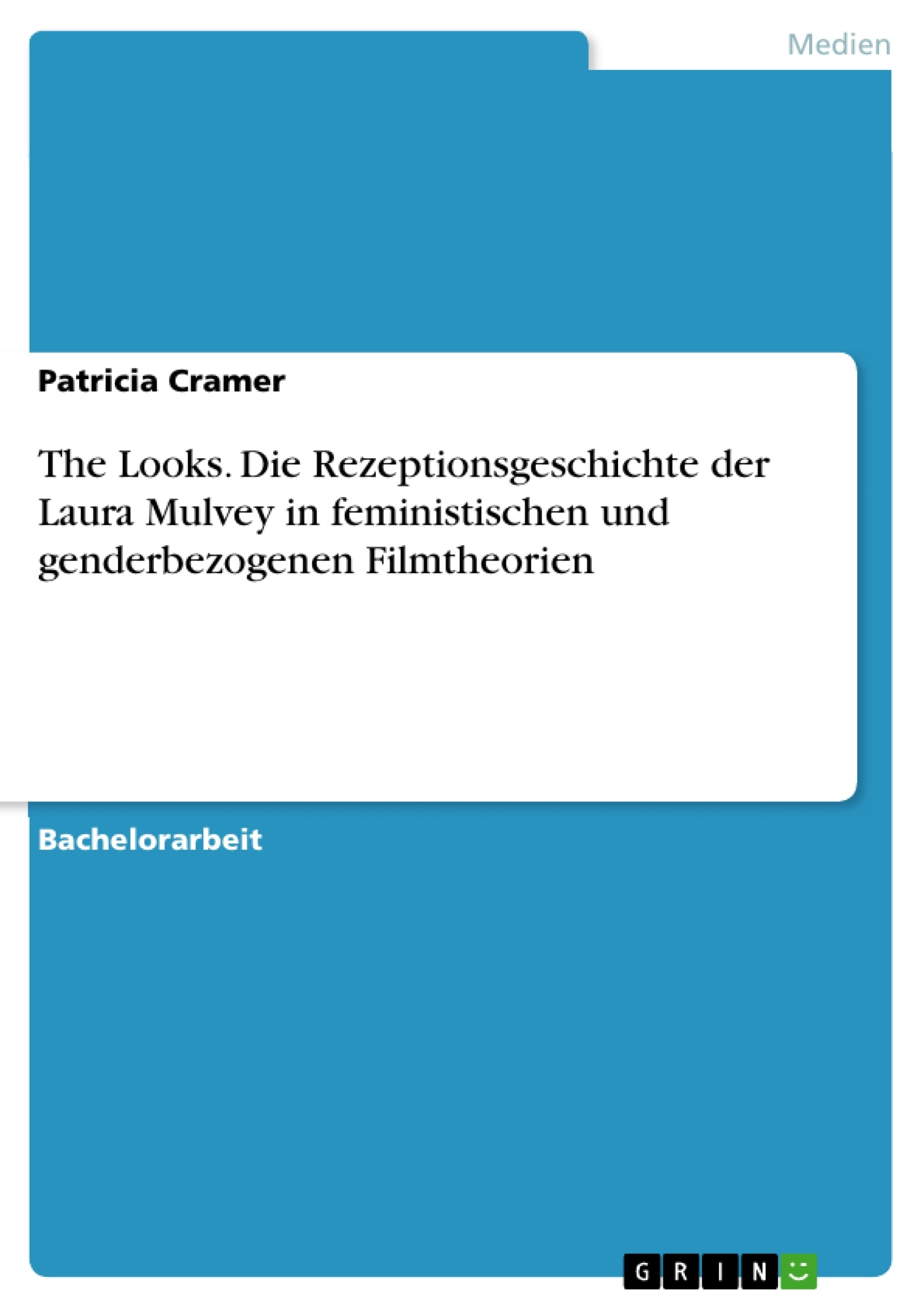Mit der aufkommenden Frauenbewegung Ende der sechziger Jahre, begann auch die feministische Auseinandersetzung mit der Repräsentation von Frauen im Film. In diesem frühen Stadium beschäftigten sich die Theorien mit dem Einfluss der Medien auf die Gesellschaft und die Widerspiegelung der Realität. Die Missstände sollten aufgedeckt werden und viele Theoretikerinnen versuchten sich selbst an Filmen. Mitte der siebziger Jahre kam es zu einer theoretischen Wende in der feministischen Filmtheorie und dieser Paradigmenwechsel begann mit Laura Mulveys Artikel „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ von 1975. Als eine der Ersten machte Mulvey die Psychoanalyse nach Sigmund Freud und Jacques Lacan einer breiten Masse, im Bezug auf die Filmtheorie, zugänglich. Sie prägte den feministischen Filmdiskurs über Jahrzehnte und ihr Text von 1975 ist einer der meistrezipierten Aufsätze der feministischen Filmtheorie.
In jedem Übersichtswerk zu feministischer Filmtheorie findet ihr Essay Eingang und bei der Beschäftigung
mit Filmtheorie kommt man kaum an ihr vorbei. Den Status als ein grundlegender Text zum Verständnis von Film erreichte „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ sehr kurz nach seinem Erscheinen und immer noch wird er als „bahnbrechend“ bezeichnet. Viele TheoretikerInnen griffen Mulveys Thesen auf, erweiterten diese oder übertrugen ihre Argumentationslinie auf andere Personengruppen im Film. Fragen die Mulvey offen lies wurden versucht zu beantworten, wie beispielsweise die sexuelle Orientierung oder Ethnie des Publikums. Andere kritisierten den psychoanalytischen Ansatz und das Mulvey der Zuschauerin keinen Platz einräumte und suchten nach neuen Ansätzen in den Cultural Studies. Die Rezeption von Laura Mulvey, sei es nun durch das Überarbeiten, das Anwenden an konkreten Beispielen oder das Kritisieren ihres Essays, hatte entscheidenden Einfluss auf den Verlauf der feministischen Filmtheorie und führte zur Auseinandersetzung mit der Ethnie und der Genderproblematik.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Laura Mulvey rezipiert sich selbst
- 2.1 „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ und „Afterthoughts“
- 2.2 „Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image“
- 3. Mulvey als Inspiration für Filmtheorien
- 3.1 Mary Ann Doane und die maskierte Frau
- 3.2 bell hooks und der oppositionelle Blick der schwarzen Frau
- 3.3 Steve Neale und der determinierende Blick auf Männer
- 3.4 Linda Williams und Körperflüssigkeiten
- 3.5 Kastrationsangst und die Ähnlichkeit von Frau und Monster im Horrorfilmdiskurs
- 3.6 Das homosexuelle Publikum und die Herausforderung von Mulvey in dem Diskurs der Queer Studies
- 4. Eine andere Form der Rezeption: ausgewählte Film- und Fernsehserienanalysen
- 5. Die Abwendung von dem psychoanalytischen Ansatz: ein kurzer Einblick in die Cultural Studies
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den weitreichenden Einfluss von Laura Mulveys Essay „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ auf die feministische und Gender Filmtheorie. Ziel ist es, einen Überblick über die Rezeption von Mulveys Werk zu geben und dessen Bedeutung für die Entwicklung des Feldes aufzuzeigen.
- Rezeption und Weiterentwicklung von Mulveys Psychoanalyse-basiertem Ansatz in der feministischen Filmtheorie.
- Einfluss von Mulveys Arbeit auf verschiedene Filmtheoretiker*innen (Doane, hooks, Neale, Williams).
- Anwendung und Kritik von Mulveys Thesen im Kontext von Horrorfilmen und Queer Studies.
- Analyse ausgewählter Film- und Fernsehserien im Lichte von Mulveys Theorie.
- Die Abwendung vom psychoanalytischen Ansatz und die Hinwendung zu Cultural Studies.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Beginn der feministischen Auseinandersetzung mit der Repräsentation von Frauen im Film im Kontext der Frauenbewegung Ende der 60er Jahre. Sie hebt Laura Mulveys bahnbrechenden Essay "Visual Pleasure and Narrative Cinema" (1975) als Paradigmenwechsel hervor und betont dessen anhaltenden Einfluss auf die feministische Filmtheorie. Die Arbeit skizziert die Forschungsfrage nach dem andauernden Einfluss und der Relevanz von Mulveys Thesen in aktuellen Filmtheorien und -analysen und kündigt die Struktur der Arbeit an, welche die Rezeption von Mulveys Werk durch verschiedene Theoretiker*innen sowie ausgewählte Filmanalysen umfasst.
2. Laura Mulvey rezipiert sich selbst: Dieses Kapitel befasst sich mit Mulveys eigenen Arbeiten, insbesondere mit „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ und ihren „Afterthoughts“. Es analysiert Mulveys Anwendung der Psychoanalyse Freuds und Lacans auf die Filmtheorie, ihre Beschreibung der Rolle der Frau als Objekt des männlichen Blicks und die Kritik an ihrem Ansatz, sowie die Weiterentwicklung ihrer Thesen in späteren Werken.
3. Mulvey als Inspiration für Filmtheorien: Dieses Kapitel präsentiert die Rezeption von Mulveys Werk durch verschiedene Filmtheoretiker*innen. Es untersucht, wie Doane, hooks, Neale und Williams Mulveys Thesen aufgreifen, erweitern oder kritisieren, und wie diese theoretischen Perspektiven die Analyse von Film und Gender erweitern. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten der weiblichen und männlichen Darstellung im Film, unter Einbezug von Aspekten wie Rasse und sexueller Orientierung.
4. Eine andere Form der Rezeption: ausgewählte Film- und Fernsehserienanalysen: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Filmanalysen, die sich auf Mulveys Konzepte beziehen. Es zeigt die Anwendung und die Reichweite von Mulveys Theorie in der konkreten Filmanalyse und zeigt auf, wie ihre Thesen in unterschiedlichen Kontexten weiterentwickelt und angewendet werden können.
5. Die Abwendung von dem psychoanalytischen Ansatz: ein kurzer Einblick in die Cultural Studies: Dieses Kapitel beleuchtet die Kritik an Mulveys psychoanalytischem Ansatz und die Hinwendung zu Cultural Studies als alternativem theoretischen Rahmen. Es analysiert die Motivationen hinter dieser Abwendung und untersucht die Beziehung zwischen Mulveys Arbeit und den neuen Ansätzen der Cultural Studies.
Schlüsselwörter
Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, Feministische Filmtheorie, Gender Studies, Psychoanalyse (Freud, Lacan), Schaulust, männlicher Blick, weiblicher Blick, Filmrezeption, Mary Ann Doane, bell hooks, Steve Neale, Linda Williams, Horrorfilm, Queer Studies, Cultural Studies.
Häufig gestellte Fragen zu: Rezeption von Laura Mulveys "Visual Pleasure and Narrative Cinema"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den weitreichenden Einfluss von Laura Mulveys Essay "Visual Pleasure and Narrative Cinema" auf die feministische und Gender Filmtheorie. Sie gibt einen Überblick über die Rezeption von Mulveys Werk und zeigt dessen Bedeutung für die Entwicklung des Feldes auf.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rezeption und Weiterentwicklung von Mulveys Psychoanalyse-basiertem Ansatz, den Einfluss ihrer Arbeit auf verschiedene Filmtheoretiker*innen (Doane, hooks, Neale, Williams), die Anwendung und Kritik ihrer Thesen im Kontext von Horrorfilmen und Queer Studies, Analysen ausgewählter Film- und Fernsehserien im Lichte von Mulveys Theorie sowie die Abwendung vom psychoanalytischen Ansatz und die Hinwendung zu Cultural Studies.
Welche Autor*innen werden neben Laura Mulvey behandelt?
Die Arbeit analysiert die Rezeption von Mulveys Werk durch Mary Ann Doane, bell hooks, Steve Neale und Linda Williams. Es wird untersucht, wie diese Theoretiker*innen Mulveys Thesen aufgreifen, erweitern oder kritisieren.
Welche theoretischen Ansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert den psychoanalytischen Ansatz (Freud, Lacan), die feministische Filmtheorie, Gender Studies, Queer Studies und Cultural Studies. Es wird der Wandel von einem psychoanalytischen zu einem cultural studies-orientierten Ansatz in der Filmtheorie beleuchtet.
Welche Arten von Filmen/Serien werden analysiert?
Die Arbeit beinhaltet ausgewählte Film- und Fernsehserienanalysen, die sich auf Mulveys Konzepte beziehen. Die konkreten Titel der Filme und Serien werden in der Arbeit genannt, jedoch nicht im vorliegenden Inhaltsverzeichnis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus sechs Kapiteln: Einleitung, Laura Mulvey rezipiert sich selbst, Mulvey als Inspiration für Filmtheorien, Eine andere Form der Rezeption: ausgewählte Film- und Fernsehserienanalysen, Die Abwendung von dem psychoanalytischen Ansatz: ein kurzer Einblick in die Cultural Studies, und Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, den andauernden Einfluss und die Relevanz von Mulveys Thesen in aktuellen Filmtheorien und -analysen aufzuzeigen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, Feministische Filmtheorie, Gender Studies, Psychoanalyse (Freud, Lacan), Schaulust, männlicher Blick, weiblicher Blick, Filmrezeption, Mary Ann Doane, bell hooks, Steve Neale, Linda Williams, Horrorfilm, Queer Studies, Cultural Studies.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist strukturiert durch eine Einleitung, die die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit vorstellt, gefolgt von Kapiteln, die sich mit Mulveys Werk selbst, der Rezeption durch andere Theoretiker*innen, Filmanalysen und der Abwendung vom psychoanalytischen Ansatz befassen. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
- Quote paper
- Patricia Cramer (Author), 2013, The Looks. Die Rezeptionsgeschichte der Laura Mulvey in feministischen und genderbezogenen Filmtheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439548