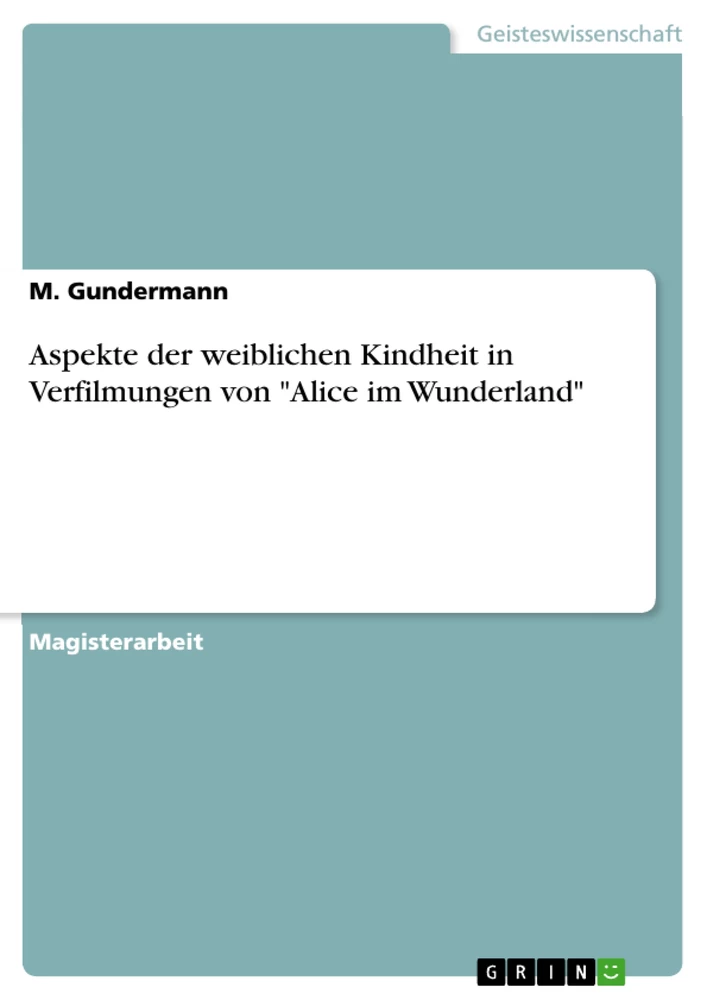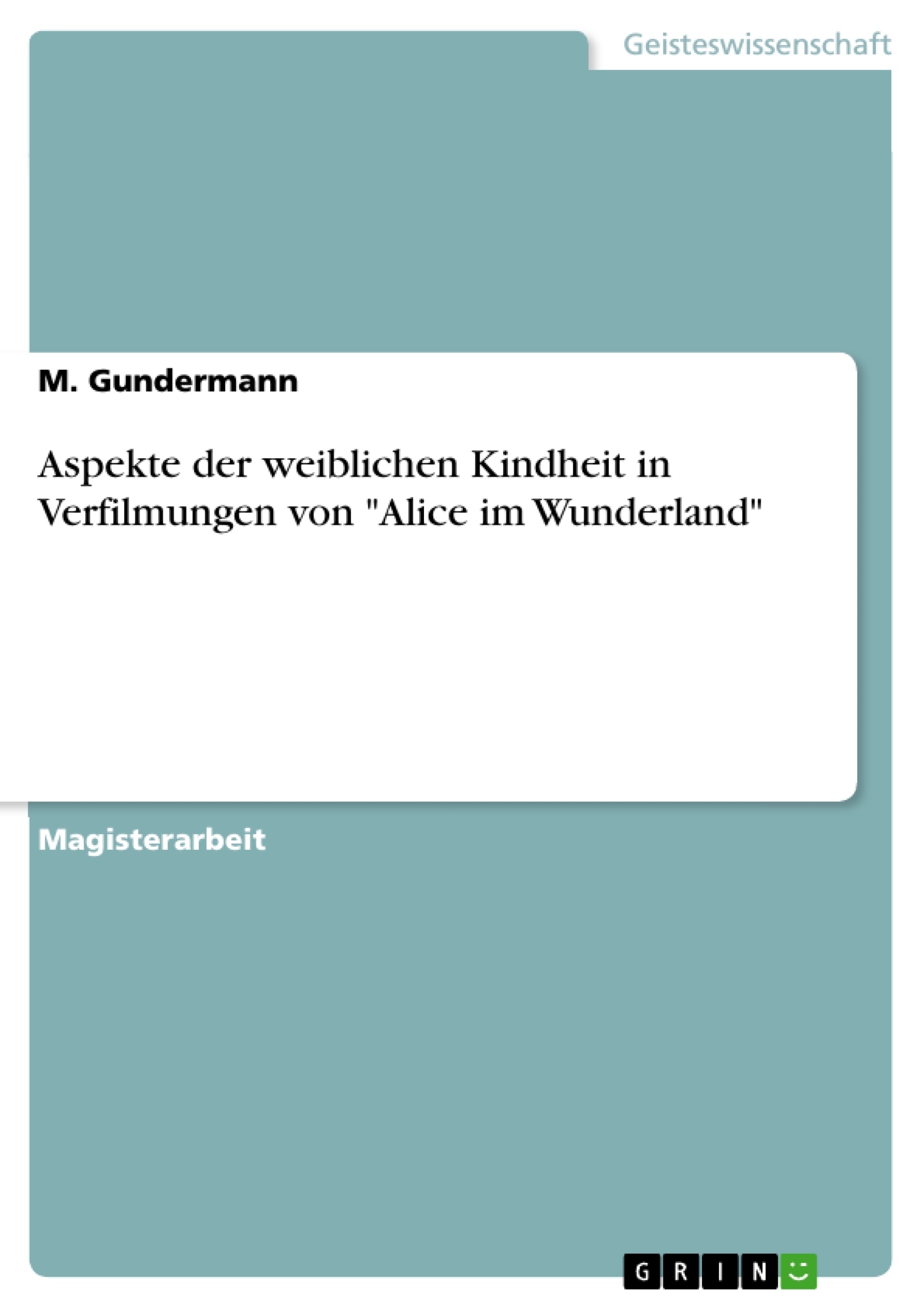Seit fast 150 Jahren ist die Popularität des Kinderbuchklassikers Alice im Wunderland (1865), geschrieben von Lewis Carroll, ungebrochen. Der Grund für die Beständigkeit und Faszination des Buches liegt eindeutig in seiner Zeitlosigkeit. Denn die Geschichte um die kleine Alice und ihre Abenteuer ist so vielschichtig, voll von sprachlichem und inhaltlichem Reichtum, sie lässt so viel Spielraum für eigene Interpretationen, dass jede Generation etwas Neues darin entdecken und auf sich selbst übertragen kann. Überall im (pop-)kulturellen Kontext verweisen daher bis heute zahlreiche Referenzen auf Handlung, Motive und Charaktere. Nicht nur bildende Künstler, damals wie heute – darunter viele Surrealisten, wie Max Ernst und Salvador Dali – nutzten Alice als Inspirationsquelle für ihr Schaffen. Die Abenteuer der siebenjährigen Heldin fanden ihren Weg im Laufe des letzten Jahrhunderts auch auf die Opern-, Theater- und Ballettbühne. Man integrierte die Geschichte sogar in ein Computerspiel mit dem Titel American McGee‘s Alice (2000), das sich großer Beliebtheit erfreute. Und obgleich das Buch bis heute als nicht verfilmbar gilt, sahen ebenfalls viele Filmstudios die Übertragung des Stoffes auf das Medium Film als sehr lohnenswert an, was insbesondere der bildhaften Sprache, der Traumsymbolik und der Kindheitsthematik zu verdanken war. Über 20 Mal war die Geschichte um die kleine Alice sodann auch seit der ersten Adaption von Cecil Hepworth aus dem Jahre 1903 auf der Leinwand zu sehen. Zu ihrer Zielgruppe gehörten dabei überwiegend Kinder. Denn zweifelsohne ist Carrolls Alice im Wunderland eine Hommage an die Kindheit, wie es selten eine gab, und zugleich eine Kritik an allem, was die Welt der Erwachsenen je hervorgebracht hat. Lewis Carroll hat auf diese Weise jedoch auch ein Werk geschaffen, das nicht nur die meisten Kinder in seinen Bann zieht, dem Wunderland fühlt man sich auch als Erwachsener noch zugehörig. Es erlaubt uns nämlich das, was in der rationalen Welt der Erwachsenen nicht mehr möglich ist: Im Wunderland können wir der Macht kindlicher Phantasien und Träume erneut erliegen – jener imaginären, gedanklichen Kraft, mit der jegliche gesellschaftliche Konventionen einer starren Gesellschaftsordnung, jedwede Einschränkungen und jede Art von Regelwerk durchbrochen werden können. Gleichwohl wird die Handlung oftmals nur auf die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens reduziert und weniger auf das Bild von Kindheit, das sie vermittelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Fragestellung und Forschungsstand
- 1.2 Eingrenzung des Gegenstandes
- 1.3 Vorgehensweise
- 2 Was ist Kindheit?
- 2.1 Definition und Begriffswandel
- 2.2 Die Geschichte der Kindheit
- 2.3 Kindheitsbilder im Film und in den Medien
- 3 Magie, Märchen und Traum in der Kindheit
- 3.1 Die Magische Phase und das Selbstverständnis des Wunderbaren
- 3.2 Es war einmal... Von der Bedeutung des Märchens in der Kindheit
- 3.3 Der Kindheitstraum und seine Funktion
- 4 Die Vorlage
- 4.1 Lewis Carroll
- 4.2 Entstehung und historischer Hintergrund der Alice-Romane
- 4.3 Alice im Wunderland: Das Märchen von der kindlichen Traumwelt
- 5 Die Wandlung des Kindheitsbildes in ausgewählten Alice-Verfilmungen
- 5.1 Inszenierung der Idylle? Walt Disneys Alice im Wunderland (1951)
- 5.1.1 Walt Disneys idealistisches Weltbild und die Kritik an der „Disneyfizierung“
- 5.1.2 Alices unschuldige Naivität oder Die Wiederbelebung des romantischen Kindheitsbildes
- 5.1.3 Die Natur als Handlungsort der Kindheit
- 5.1.4 Zuhaus ist es doch am schönsten - Traditionsbewusstsein bei Alice im Wunderland
- 5.2 Millers tiefenpsychologische Kindheitsstudie von Alice im Wunderland (1966)
- 5.2.1 Millers Ästhetik des Minimalismus
- 5.2.2 Das Ende der Naivität: Alices kühle Rationalität als stille Kapitulation vor dem Erwachsenwerden
- 5.2.3 Trennung der Welten: Erwachsenenwelt - Kinderwelt
- 5.2.4 Alice für Erwachsene oder für Kinder? - Eine Adressatenproblematik
- 5.3 Das Wunderland als surrealistisches Alptraumland – Švankmajers Alice (1988)
- 5.3.1 Švankmajer und Der Prager Surrealismus
- 5.3.2 Švankmajer und die düster-groteske Seite der Kindheit
- 5.3.3 Transformation und Metamorphose als Zeichen der kindlichen Identitätskrise
- 5.4 Die Rückkehr zur Kindheit als Ausdruck von Freiheit und Emanzipation in Tim Burtons Alice im Wunderland (2010)
- 5.4.1 Alice als Verkörperung des postmodernen Jugendlichen
- 5.4.2 Das „Wunderland“ wird zum „Unterland“
- 5.4.3 Der Tod des Jabberwocky als emanzipatorischer Befreiungsschlag
- 6 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Darstellung weiblicher Kindheit in verschiedenen Verfilmungen von Lewis Carrolls "Alice im Wunderland". Ziel ist es, die Wandlung des Kindheitsbildes in den ausgewählten Adaptionen zu analysieren und die jeweiligen filmischen Interpretationen im Kontext der jeweiligen Epoche und des künstlerischen Stils zu beleuchten.
- Die Entwicklung des Kindheitsverständnisses im Laufe der Geschichte
- Die Darstellung von Magie, Märchen und Traum in der kindlichen Wahrnehmung
- Der Einfluss verschiedener filmischer Ästhetiken auf die Inszenierung der weiblichen Kindheit
- Die Interpretation von Alice als Symbolfigur für unterschiedliche Phasen und Aspekte der Kindheit
- Die Auseinandersetzung mit den jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten der Filmproduktionen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Forschungsfrage und den Forschungsstand zum Thema Alice-Verfilmungen und Kindheitsdarstellungen. Es umreißt die Vorgehensweise der Arbeit und definiert den Untersuchungsgegenstand.
2 Was ist Kindheit?: Der zweite Abschnitt beleuchtet den komplexen Begriff der Kindheit. Er untersucht dessen Wandel über die Geschichte hinweg, untersucht verschiedene Definitionen und analysiert gängige Kindheitsbilder im Film und in den Medien, um einen Kontext für die spätere Analyse der Alice-Verfilmungen zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des gesellschaftlichen Verständnisses von Kindheit und den damit verbundenen Erwartungen und Rollenzuschreibungen.
3 Magie, Märchen und Traum in der Kindheit: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Magie, Märchen und Träumen in der Kindheit. Es analysiert die Rolle dieser Elemente in der Entwicklung des kindlichen Selbstverständnisses und in der Gestaltung der kindlichen Fantasiewelt. Die Ausführungen legen den Grundstein für das Verständnis der symbolischen Bedeutung der Wunderwelt in den späteren Kapiteln.
4 Die Vorlage: Dieses Kapitel analysiert Lewis Carrolls Werk "Alice im Wunderland" als literarische Vorlage. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Buches, den historischen Kontext sowie die inhaltlichen und sprachlichen Besonderheiten, die für die zahlreichen Adaptionen relevant sind. Die Analyse betont den Einfluss der Vorlage auf die unterschiedlichen filmischen Interpretationen.
5 Die Wandlung des Kindheitsbildes in ausgewählten Alice-Verfilmungen: Das Herzstück der Arbeit analysiert verschiedene Alice-Verfilmungen, unter anderem von Disney (1951), Miller (1966), Švankmajer (1988) und Burton (2010). Die Kapitel untersuchen, wie das Kindheitsbild in diesen Filmen dargestellt wird und wie sich diese Darstellungen im Laufe der Zeit verändert haben. Jede Verfilmung wird hinsichtlich ihrer spezifischen Ästhetik, Interpretation der Geschichte und den damit verbundenen impliziten und expliziten Botschaften untersucht.
Schlüsselwörter
Alice im Wunderland, Kindheitsdarstellung, Filmgeschichte, Filmanalyse, Kindheitsverständnis, Magie, Märchen, Traum, Identitätskrise, Disneyfizierung, Surrealismus, Postmoderne, Lewis Carroll, Verfilmungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Alice im Wunderland"-Verfilmungen und dem Wandel des Kindheitsbildes
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert die Darstellung weiblicher Kindheit in verschiedenen Verfilmungen von Lewis Carrolls "Alice im Wunderland". Sie untersucht die Wandlung des Kindheitsbildes in den ausgewählten Adaptionen und beleuchtet die jeweiligen filmischen Interpretationen im Kontext der jeweiligen Epoche und des künstlerischen Stils.
Welche Alice-Verfilmungen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Alice-Verfilmungen von Disney (1951), Miller (1966), Švankmajer (1988) und Burton (2010). Jede Verfilmung wird hinsichtlich ihrer spezifischen Ästhetik, Interpretation der Geschichte und den damit verbundenen impliziten und expliziten Botschaften untersucht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Kindheitsverständnisses im Laufe der Geschichte, die Darstellung von Magie, Märchen und Traum in der kindlichen Wahrnehmung, den Einfluss verschiedener filmischer Ästhetiken auf die Inszenierung der weiblichen Kindheit, die Interpretation von Alice als Symbolfigur für unterschiedliche Phasen und Aspekte der Kindheit und die Auseinandersetzung mit den jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten der Filmproduktionen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Definition von Kindheit, Magie, Märchen und Traum in der Kindheit, Analyse der literarischen Vorlage (Lewis Carrolls "Alice im Wunderland"), Analyse der ausgewählten Alice-Verfilmungen und Resümee. Jedes Kapitel wird in Unterkapitel unterteilt, die spezifische Aspekte der Thematik behandeln.
Welche Aspekte der einzelnen Verfilmungen werden analysiert?
Die Analyse der einzelnen Verfilmungen konzentriert sich auf die Inszenierung des Kindheitsbildes, die verwendeten filmischen Mittel und die Interpretation der Geschichte im Kontext der jeweiligen Epoche. Es werden beispielsweise Disneys idealistisches Weltbild, Millers tiefenpsychologische Interpretation, Švankmajers surrealistische Darstellung und Burtons postmoderne Adaption untersucht.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie sich das Kindheitsbild in den ausgewählten Alice-Verfilmungen wandelt und wie diese Wandlung die jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexte reflektiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Alice im Wunderland, Kindheitsdarstellung, Filmgeschichte, Filmanalyse, Kindheitsverständnis, Magie, Märchen, Traum, Identitätskrise, Disneyfizierung, Surrealismus, Postmoderne, Lewis Carroll, Verfilmungen.
Wie wird der Begriff "Kindheit" in der Arbeit definiert?
Die Arbeit untersucht den Wandel des Begriffs "Kindheit" über die Geschichte hinweg und analysiert verschiedene Definitionen und gängige Kindheitsbilder im Film und in den Medien. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des gesellschaftlichen Verständnisses von Kindheit und den damit verbundenen Erwartungen und Rollenzuschreibungen.
Welche Rolle spielen Magie, Märchen und Traum in der Analyse?
Magie, Märchen und Träume werden als zentrale Elemente der kindlichen Wahrnehmung und Fantasiewelt analysiert. Ihre Bedeutung für die Entwicklung des kindlichen Selbstverständnisses und ihre symbolische Funktion in den Alice-Verfilmungen werden untersucht.
Wie wird die literarische Vorlage von Lewis Carroll in die Analyse einbezogen?
Die Analyse der literarischen Vorlage beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Buches, den historischen Kontext sowie die inhaltlichen und sprachlichen Besonderheiten, die für die zahlreichen Adaptionen relevant sind. Der Einfluss der Vorlage auf die unterschiedlichen filmischen Interpretationen wird hervorgehoben.
- Quote paper
- M. Gundermann (Author), 2013, Aspekte der weiblichen Kindheit in Verfilmungen von "Alice im Wunderland", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439457