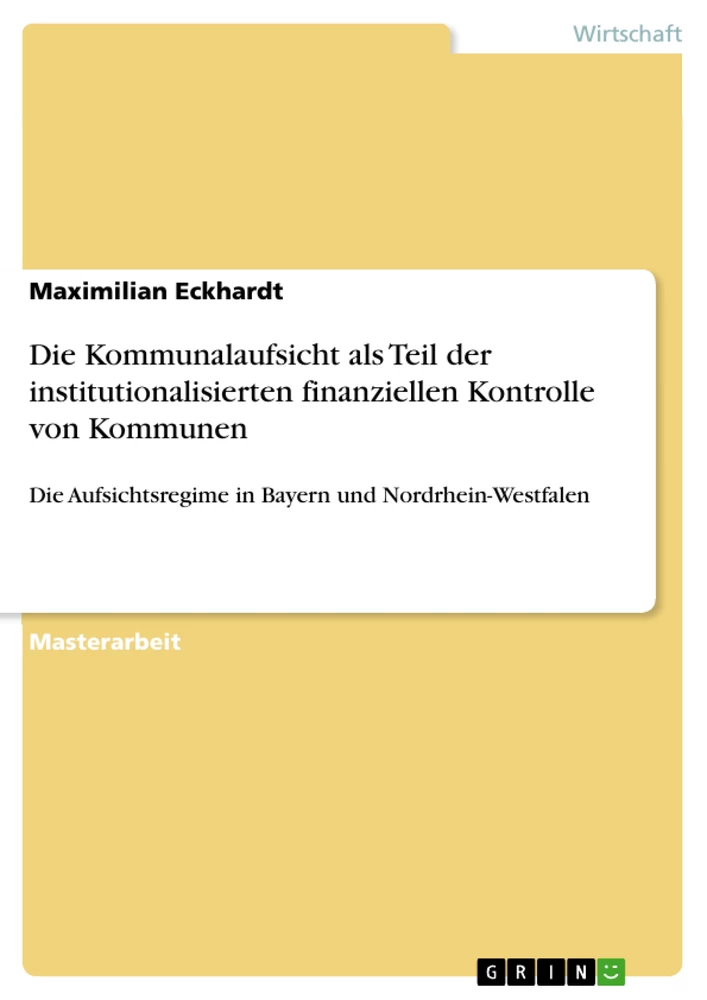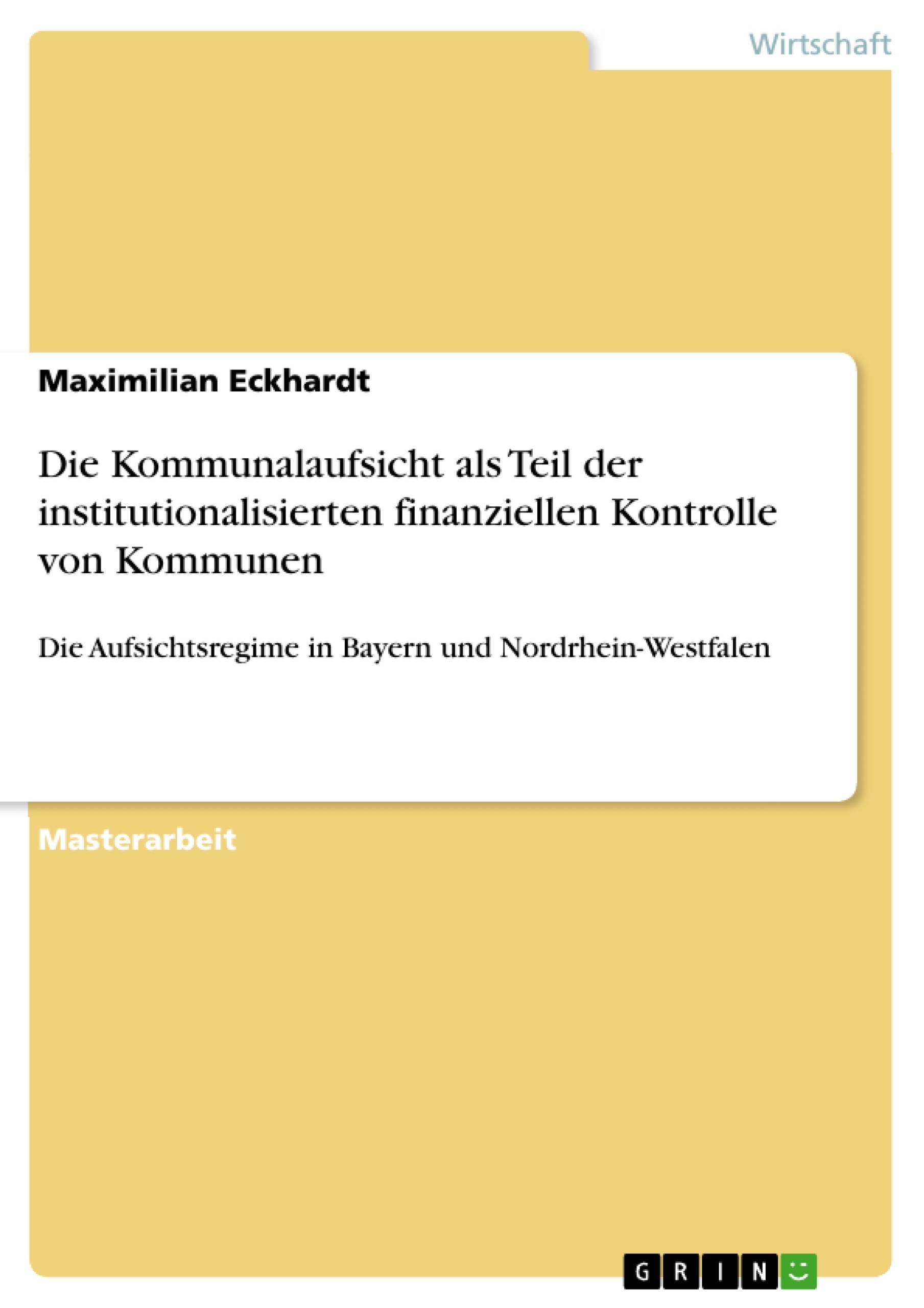Durch diese Arbeit soll ein detaillierter und vergleichender Blick auf die Kommunalaufsichtsregime in zwei Bundesländern gerichtet werden, da die bisherigen Ansätze in der Literatur den Rechtsrahmen vergleichsweise oberflächlich vergleichen und zudem überwiegend auf die Entwicklung neuer Lösungsansätze verzichten. In den Vergleichsländern ist die Kommunalaufsicht jeweils dreistufig aufgebaut und den Behörden stehen repressive sowie präventive Aufsichtsmittel zur Verfügung, um ihre gesetzlich festgelegten Aufgaben zu erfüllen.
Diese Aufgaben sind namentlich in der Ausübung der Wächter- sowie der Schutzfunktion zu sehen und erstrecken sich ebenso auf die Kontrolle des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinden. Der umfangreichste Teil der Arbeit behandelt den Vergleich der aufsichtsrechtlichen Mittel, welche den Behörden zur Verfolgung ihrer Ziele zur Verfügung stehen. Im Zuge des Vergleichs kann insbesondere konstatiert werden, dass Bayern im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen weitaus umfangreichere Genehmigungsvorbehalte in der Gemeindeordnung normiert, während Nordrhein-Westfalen stattdessen auf ein sanktionierendes Haushaltssicherungskonzept setzt. Zudem konnte bundeslandübergreifend festgestellt werden, dass der Einsatz repressiver Aufsichtsmittel lediglich nachrangig und zögerlich erfolgt und insofern von einer Kultur der Nichtanwendung gesprochen werden kann.
Die Analyse identifiziert sodann verschiedene Schwächen des Rechtsrahmens und zeigt auf, inwiefern die Kommunalaufsichtsbehörden durch die bestehenden Regeln an einer effektiven Aufgabenwahrnehmung gehindert werden. Hauptsächlicher Kritikpunkt ist dabei die Wahrnehmung der Wächter- sowie die Schutzfunktion durch die identische Behörde. Der Funktionsdualismus sorgt insofern für unklare Verantwortlichkeiten, da die Kommunalaufsicht regelmäßig zwei unterschiedlichen Anforderungsgedanken entsprechen muss und dadurch keine eindeutige Identität entwickeln kann.
Somit stellt der Funktionsdualismus auch eine sinnige Erklärung für die in der Praxis zu beobachtenden unterschiedlichen Aufsichtsphilosophien zwischen Aufsichtsbehörden dar. Stellt die Bewertung quasi die Diagnose dar, so sind in den anschließend vorgetragenen Lösungsansätzen Therapiemöglichkeiten zur Behebung der konstatierten Schwächen zu sehen. Die Formulierung von Lösungsansätzen unterscheidet die vorliegende Masterarbeit maßgeblich von weiten Teilen der bisherigen Literatur und stößt damit in eine klaffende Lücke.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stand der Literatur und Zielsetzung der Arbeit
- Fallauswahl und Vorgehen
- Zur kommunalen Verschuldung
- Interdependente Ursachenbündel kommunaler Haushaltsdefizite
- Exogene Ursachen kommunaler Haushaltsdefizite
- Endogene Ursachen kommunaler Haushaltsdefizite
- Opferthese versus Verschwendungsthese
- Unentbehrlichkeit eines Regimes der finanziellen Kontrolle
- Grundsätzliche Bedeutung der Kontrolle
- Unzulänglichkeiten der marktlichen Kontrolle
- Nicht-existenter Eigenkapitalmarkt
- Wenig disziplinierender Fremdkapitalmarkt
- Wenig disziplinierender Absatzmarkt
- Unzulänglichkeiten der Kontrolle durch die Wähler
- Ambivalente Interessen des Wählers
- Wahlparadoxon (paradox of voting)
- Implikationen des Konnexitätsprinzips
- Akteure der finanziellen Kontrolle von Kommunen
- Örtliche Prüfung
- Überörtliche Prüfung
- Kommunalaufsicht
- Staatliche Aufsicht in Abhängigkeit der wahrgenommenen Aufgaben
- Organisatorische Ansiedlung
- Wesen der Kommunalaufsicht
- Funktionen und Instrumente der Kommunalaufsicht
- Repressive Aufsichtsmittel
- Präventive Aufsichtsmittel
- Kommunalaufsicht im Vergleich der Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen
- Zum Begriff der Effektivität
- Organisatorische Ansiedlung und Aufgabenspektrum
- Organisatorische Ansiedlung der Kommunalaufsicht
- Aufgabenspektrum
- Aufsichtsrechtliche Mittel in Bayern und Nordrhein-Westfalen
- Informations-/Unterrichtungsrecht
- Beanstandungs- und Aufhebungsrecht
- Anordnungsrecht
- Recht der Ersatzvornahme
- Bestellung eines Beauftragten
- Der beratende Sparkommissar
- Auflösung der Vertretungskörperschaft
- Vorzeitige Beendigung der Amtszeit des Bürgermeisters
- Beratung
- Anzeige- und Vorlagepflichten
- Haushaltssatzung
- Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- Genehmigungsvorbehalte und Zulassung von Ausnahmen
- Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- Gesamtgenehmigung des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Einzelgenehmigung bei Kreditbeschränkungen nach dem StWG
- Genehmigungsvorbehalte bezüglich der Kassenkredite
- Gesamtgenehmigung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen
- Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes
- Tatsächliche Anwendung der Aufsichtsmittel
- Wenig restriktiver Mitteleinsatz
- Divergierende Aufsichtspraxis
- Zusammenfassung
- Bewertung
- Bewertungskriterien
- Unklare Verantwortlichkeiten
- Geeignetheit der präventiven Aufsichtsinstrumente
- Durchsetzbares Sanktionspotenzial
- Erarbeitung von Lösungsansätzen
- Zur Notwendigkeit neuer Lösungsansätze
- Zugrundeliegende Kriterien
- Lösungsansätze
- Trennung von Wächter- und Schutzfunktion
- Rotation des Aufsichtspersonals
- Punktuelle Erweiterung der Genehmigungsvorbehalte sowie des Haushaltssicherungskonzeptes
- Erweiterungen in Bayern
- Erweiterungen in Nordrhein-Westfalen
- Normierung eines Publikationsrechtes
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kommunalaufsicht als Teil der institutionalisierten finanziellen Kontrolle von Kommunen. Sie analysiert die Aufsichtsregime in Bayern und Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf ihre Effektivität und erarbeitet Lösungsansätze für eine optimierte Aufsichtspraxis.
- Die Bedeutung der finanziellen Kontrolle von Kommunen
- Die Herausforderungen der kommunalen Verschuldung
- Die Rolle der Kommunalaufsicht als Kontrollinstanz
- Der Vergleich der Aufsichtsregime in Bayern und Nordrhein-Westfalen
- Die Erarbeitung von Lösungsansätzen für eine effektivere Aufsichtspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Einleitung und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Es wird die Fallauswahl und das Vorgehen der Analyse vorgestellt. Das zweite Kapitel widmet sich dem Thema der kommunalen Verschuldung. Hier werden die Ursachen für kommunale Haushaltsdefizite analysiert, unterteilt in exogene und endogene Faktoren. Das dritte Kapitel untersucht die Notwendigkeit eines Regimes der finanziellen Kontrolle. Es werden die Unzulänglichkeiten der marktlichen Kontrolle und der Kontrolle durch die Wähler analysiert. Das vierte Kapitel stellt die Akteure der finanziellen Kontrolle von Kommunen vor. Die Örtliche und Überörtliche Prüfung werden erläutert, bevor die Kommunalaufsicht als zentrale Kontrollinstanz im Fokus steht. Das fünfte Kapitel vergleicht die Kommunalaufsicht in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Es werden die organisatorische Ansiedlung, das Aufgabenspektrum und die aufsichtsrechtlichen Mittel beider Bundesländer detailliert untersucht. Das sechste Kapitel erarbeitet Lösungsansätze für eine optimierte Kommunalaufsicht. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, um die Effektivität der Aufsichtspraxis zu verbessern.
Schlüsselwörter
Kommunalaufsicht, finanzielle Kontrolle, Kommunen, Haushaltsdefizite, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Effektivität, Lösungsansätze, Aufsichtsrecht, Präventive Aufsichtsmittel, Repressive Aufsichtsmittel.
- Quote paper
- Maximilian Eckhardt (Author), 2017, Die Kommunalaufsicht als Teil der institutionalisierten finanziellen Kontrolle von Kommunen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439408