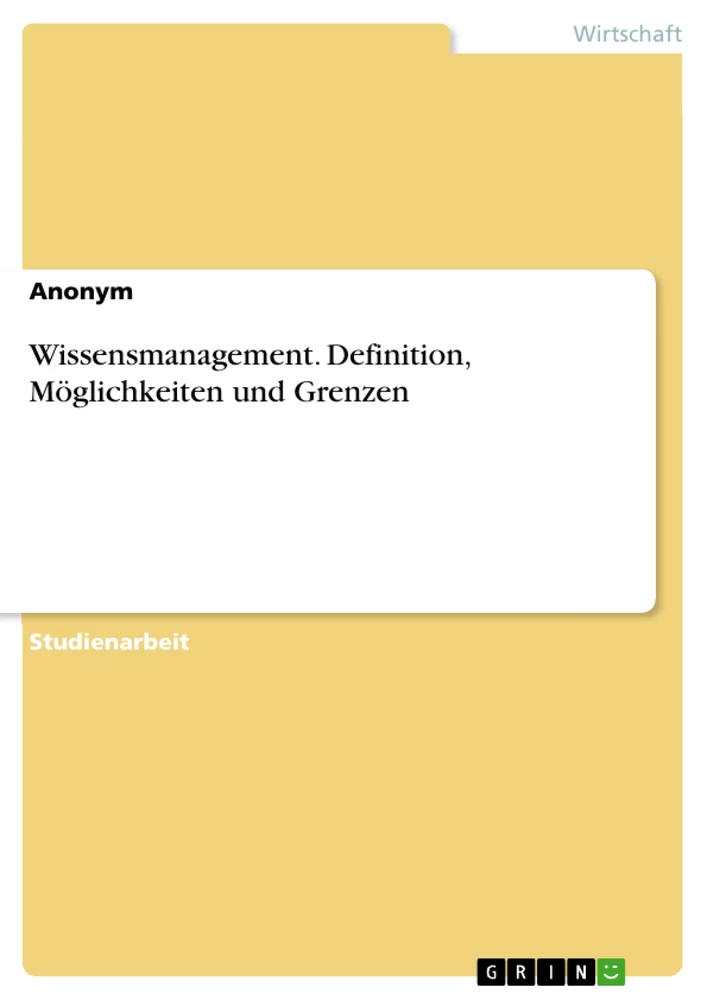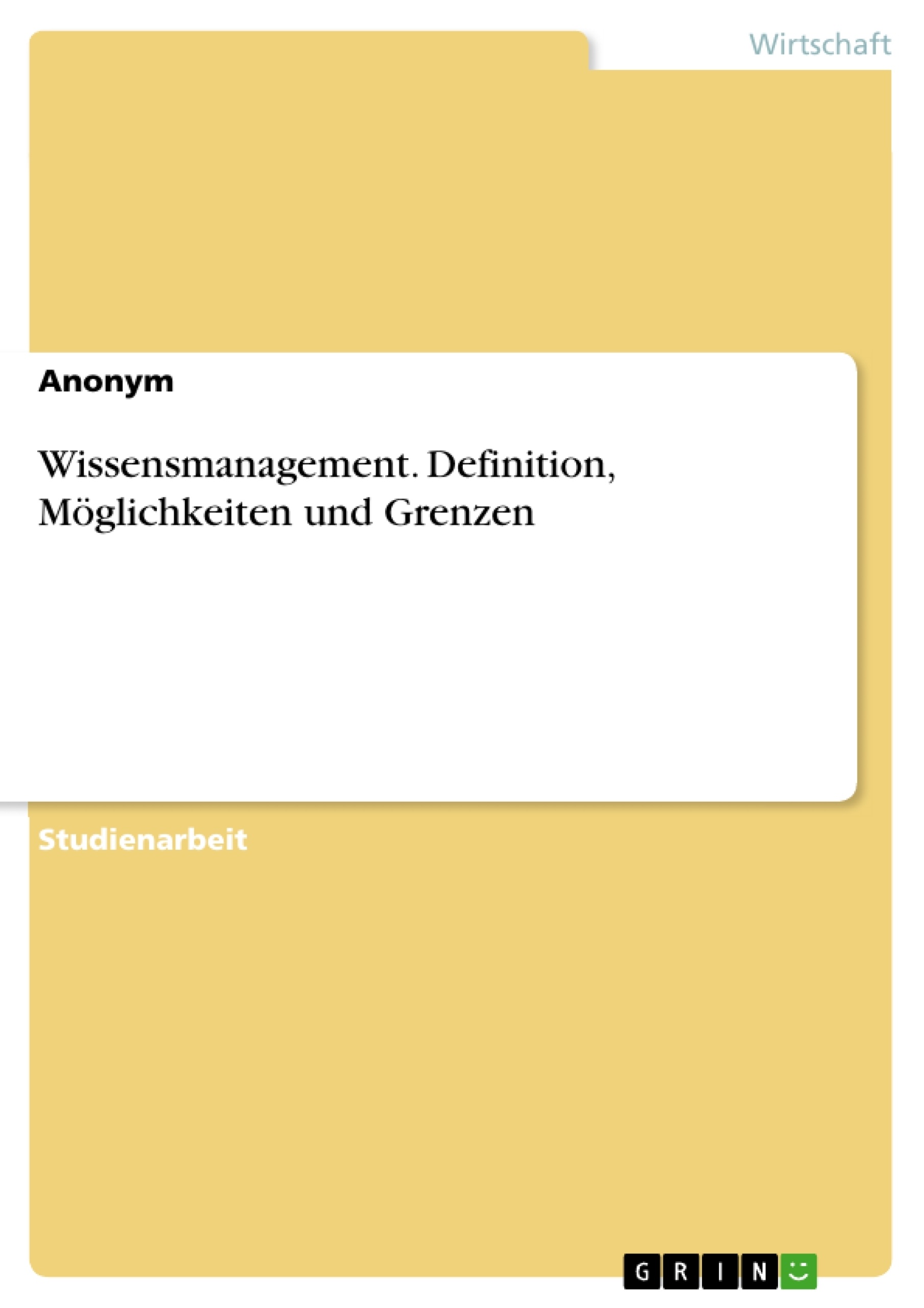Das Thema Wissen und die Verwendung bzw. Steuerung dessen als strategische Ressource nimmt aktuell einen hohen Stellenwert innerhalb der Unternehmen ein und wird auch zukünftig nicht an Gewicht verlieren. In den vergangenen Jahrzehnten vollzog sich ein immer stärker werdender Transfer von den klassischen Produktionsfaktoren, wie Kapital und Arbeit, hin zu einer wissenszentrierten Gesellschaftsform, dessen neues Mittel zur Generierung von Mehrwert und Vorteilen gegenüber den Wettbewerbern, der professionelle Umgang und die Erzeugung von Wissen im Unternehmen darstellt. Im Zuge der Globalisierung und der Notwendigkeit, dass Unternehmen sich immer schneller an sich verändernde innere als auch äußere Faktoren anpassen müssen, macht den effizienten Umgang mit Wissen zu einem essenziellen Faktor bei der Generierung von Wettbewerbsvorteilen. Wie wichtig der Erhalt von Wissen innerhalb der Organisation ist, wird gerade hinsichtlich des Themas Mitarbeiterfluktuation oder Reduzierung von Organisationsstrukturen erkenntlich, wenn zu spät festgestellt wird, dass plötzlich unternehmenswichtiges Wissen nicht mehr vorhanden ist. Im Zuge der zu erstellenden Hausarbeit werden zunächst, die für das Thema relevanten Begrifflichkeiten, erläutert und voneinander abgegrenzt, um im Anschluss zwei wesentliche Modelle des Wissensmanagements näher zu beleuchten, um abschließend die Grenzen, sowie Schwierigkeiten bei der Implementierung zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Aspekte des Wissensmanagements
- Grundlegende Begrifflichkeiten
- Zeichen, Daten, Informationen & Wissen
- Individuelles & Kollektives Wissen
- Implizites & Explizites Wissen
- Internes & Externes Wissen
- Wissensmanagement
- Modelle des Wissensmanagements
- Wissensspirale nach Nonaka / Takeuchi
- Sozialisation: von implizit zu implizit
- Externalisierung: von implizit zu explizit
- Kombination: von explizit zu explizit
- Internalisierung: von explizit zu implizit
- Anwendung auf die zwei Dimensionen der Wissensschaffung
- Bausteinmodell nach Probst et al.
- Wissensziele
- Wissensidentifikation
- Wissenserwerb
- Wissensentwicklung
- Wissens(ver)teilung
- Wissensnutzung
- Wissensbewahrung
- Wissensbewertung
- Wissensspirale nach Nonaka / Takeuchi
- Zusammenfassung und Vergleich der Modelle
- Grenzen des Wissensmanagements
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des Wissensmanagements in Unternehmen. Ziel ist es, grundlegende Begrifflichkeiten zu klären und zwei bedeutende Modelle des Wissensmanagements zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen bei der Implementierung von Wissensmanagement-Systemen.
- Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe des Wissensmanagements
- Analyse der Wissensspirale nach Nonaka/Takeuchi
- Untersuchung des Bausteine-Modells nach Probst et al.
- Vergleich der beiden Modelle hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen
- Identifizierung von Grenzen und Schwierigkeiten bei der Implementierung von Wissensmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
Aspekte des Wissensmanagements: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die weitere Arbeit, indem es zentrale Begriffe des Wissensmanagements wie implizites und explizites Wissen, individuelles und kollektives Wissen sowie internes und externes Wissen definiert und voneinander abgrenzt. Die klare Unterscheidung dieser Konzepte ist essentiell für das Verständnis der darauffolgenden Modelle und der Herausforderungen im Wissensmanagement. Die Darstellung der Wissenstreppe (Daten, Informationen, Wissen) bildet einen wichtigen Rahmen für die Betrachtung der Wissensgenerierung und -verarbeitung.
Modelle des Wissensmanagements: Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung und Analyse zweier prominenter Modelle: der Wissensspirale nach Nonaka/Takeuchi und dem Bausteine-Modell nach Probst et al. Die Wissensspirale verdeutlicht den dynamischen Prozess der Wissensgenerierung durch die vier Modi Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung. Das Bausteine-Modell hingegen bietet einen strukturierten Ansatz, der verschiedene Phasen des Wissensmanagements von der Zielsetzung bis zur Wissensbewahrung umfasst. Der Vergleich der Modelle hebt ihre jeweiligen Vor- und Nachteile hervor und zeigt, wie sie unterschiedliche Aspekte des Wissensmanagements adressieren.
Grenzen des Wissensmanagements: Dieses Kapitel befasst sich kritisch mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die bei der Implementierung und Anwendung von Wissensmanagement-Systemen auftreten können. Es werden potentielle Hindernisse wie Widerstände von Mitarbeitern, mangelnde Informationstechnologie oder ungeeignete Organisationsstrukturen diskutiert. Die Auseinandersetzung mit diesen Grenzen ist wichtig, um realistische Erwartungen an die Möglichkeiten des Wissensmanagements zu setzen.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Wissensspirale, Bausteine-Modell, implizites Wissen, explizites Wissen, Wissensgenerierung, Wissensteilung, Wissensbewahrung, Wettbewerbsvorteil, Organisationsstrukturen, Implementierungsherausforderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Wissensmanagement
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des Wissensmanagements in Unternehmen. Sie beleuchtet grundlegende Begrifflichkeiten, analysiert zwei bedeutende Modelle (die Wissensspirale nach Nonaka/Takeuchi und das Bausteine-Modell nach Probst et al.), und diskutiert Herausforderungen bei der Implementierung von Wissensmanagement-Systemen.
Welche Modelle des Wissensmanagements werden behandelt?
Die Arbeit analysiert detailliert die Wissensspirale nach Nonaka und Takeuchi mit ihren vier Modi (Sozialisation, Externalisierung, Kombination, Internalisierung) und das Bausteine-Modell nach Probst et al., welches die Phasen Wissensziele, -identifikation, -erwerb, -entwicklung, -(ver)teilung, -nutzung, -bewahrung und -bewertung umfasst. Die Modelle werden verglichen und ihre Stärken und Schwächen herausgestellt.
Welche zentralen Begriffe des Wissensmanagements werden definiert?
Die Arbeit definiert und grenzt zentrale Begriffe wie implizites und explizites Wissen, individuelles und kollektives Wissen sowie internes und externes Wissen voneinander ab. Die "Wissenstreppe" (Daten, Informationen, Wissen) wird als Rahmen für die Betrachtung der Wissensgenerierung und -verarbeitung dargestellt.
Welche Herausforderungen im Wissensmanagement werden diskutiert?
Die Arbeit identifiziert und diskutiert potentielle Hindernisse bei der Implementierung von Wissensmanagement-Systemen, wie z.B. Widerstände von Mitarbeitern, mangelnde Informationstechnologie oder ungeeignete Organisationsstrukturen. Die Grenzen des Wissensmanagements werden kritisch beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Abbildungsverzeichnis, Einleitung, Aspekte des Wissensmanagements (inkl. grundlegender Begrifflichkeiten, Wissensarten und Wissensmanagement selbst), Modelle des Wissensmanagements (Wissensspirale und Bausteine-Modell), Zusammenfassung und Vergleich der Modelle, Grenzen des Wissensmanagements, Fazit und Literaturverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Zielsetzung der Seminararbeit ist die Klärung grundlegender Begrifflichkeiten des Wissensmanagements und die Analyse zweier bedeutender Modelle. Sie soll die Herausforderungen bei der Implementierung von Wissensmanagement-Systemen beleuchten und ein umfassendes Verständnis des Themas vermitteln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Wissensmanagement, Wissensspirale, Bausteine-Modell, implizites Wissen, explizites Wissen, Wissensgenerierung, Wissensteilung, Wissensbewahrung, Wettbewerbsvorteil, Organisationsstrukturen, Implementierungsherausforderungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Wissensmanagement. Definition, Möglichkeiten und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439338