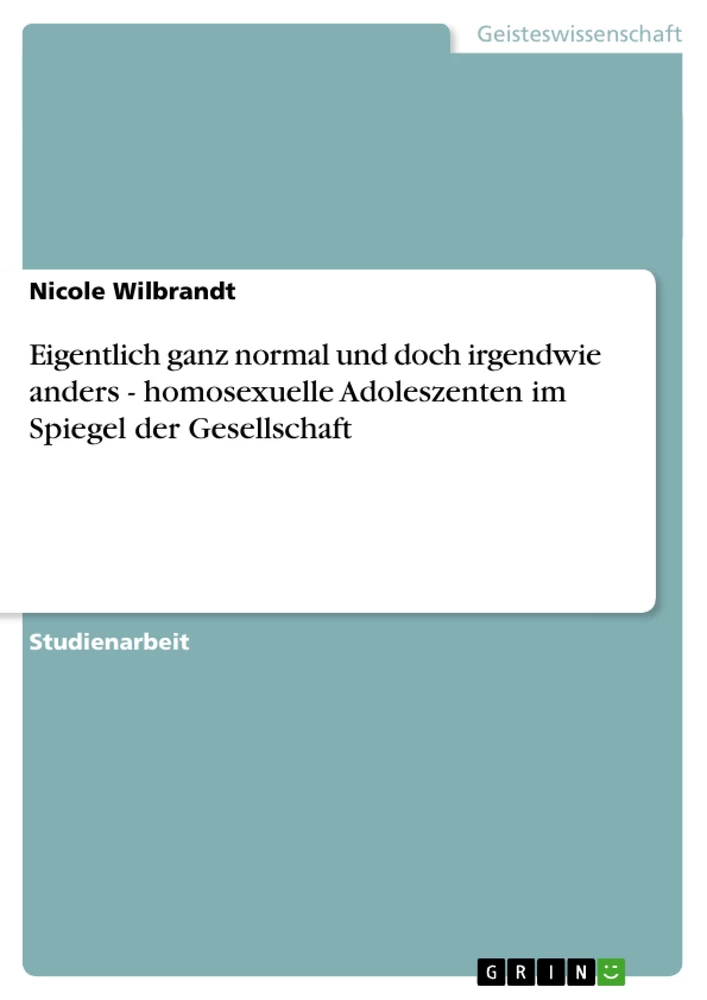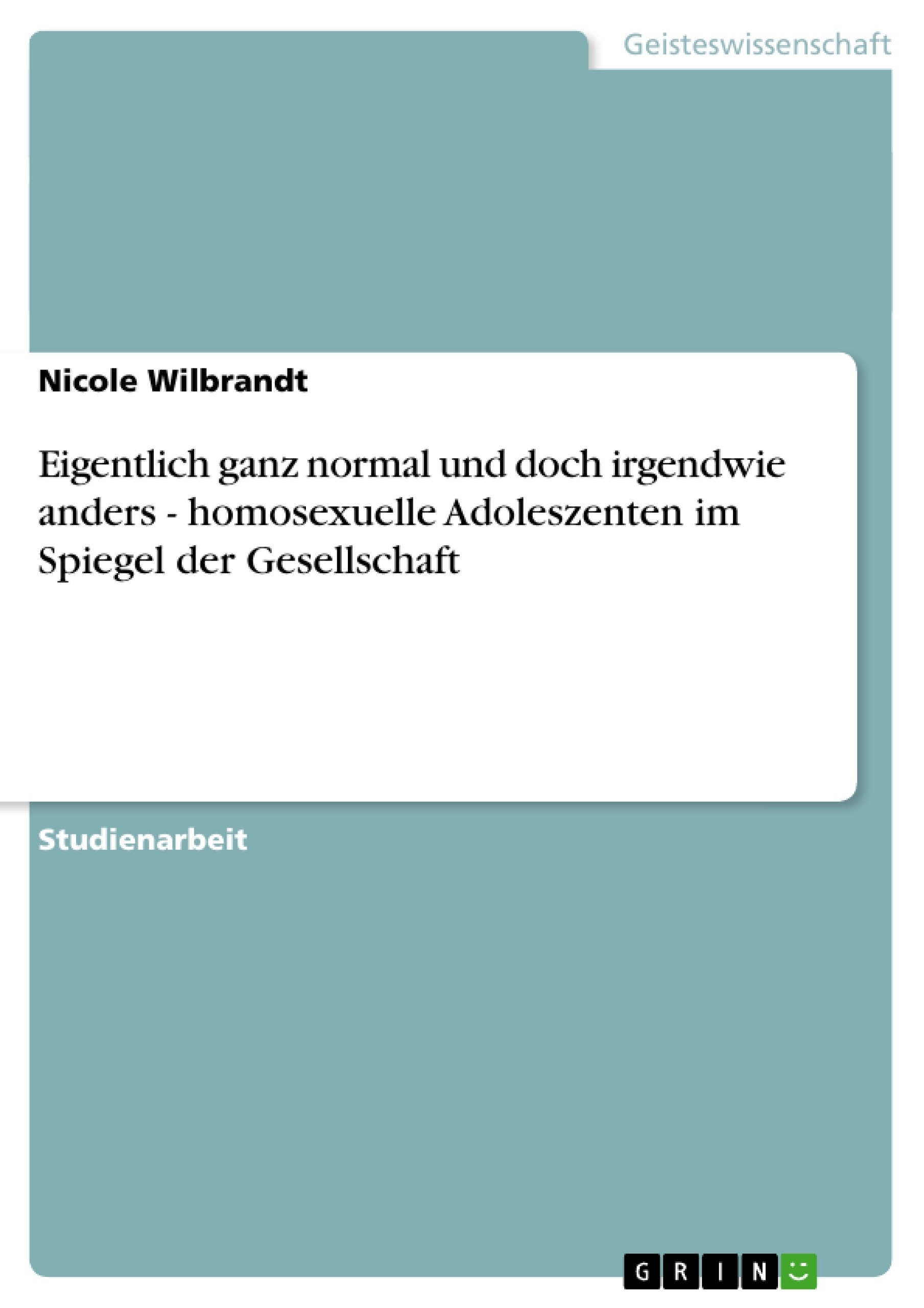Die Homosexualität wurde, obwohl sie in allen Kulturen und Gesellschaftsformen existiert, häufig als Abweichung von der Norm angesehen und mehr oder weniger geächtet. So wandelte sich der Umgang mit der Homosexualität ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts von einer zwar sündigen jedoch meist legalen Handlung zu einem Verbrechen, welches in fast ganz Europa mit dem Tod bestraft wurde. Eine enorme Verbesserung der Lebensumstände für homosexuelle Männer - denn Frauen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen führten wurden nach dem Motto: kein Sex ohne Mann, einfach nicht ernst genommen - stellte sich 1804 durch die französische Revolution und den daraus hervorgegangenen Code Civil ein, der nur noch Eingriffe in die Rechte Dritter unter Strafe stellte, somit jedoch den einvernehmlichen Verkehr zweier Männer legalisierte ( www.wikipedia.org ). Bereits 1872 wurde die Homosexualität, allerdings wieder, einhergehend mit ihrer Pathologisierung, insbesondere durch den Psychiater R. Kraft-Ebing, der Homosexualität als erblich bedingte neuropathologische Veranlagung bestimmte und somit durch die Auslegung der Homosexualität als sozial schädlich, sowie als Verbrechen an der Allgemeinheit und als Indikator zivilisatorischen Verfalls ein Fundament für Vorurteile schaffte, strafrechtlich verfolgt. Rechtliche Grundlage hierfür war der § 175 des Reichsstrafgesetzbuchs ( RstGB ).
Eine folgenreiche Verschärfung des Paragraphen im Nationalsozialismus führte zu einer Verzehnfachung der Verurteilten, weil der 1935 reformierte § 175 nicht nur vollführte sexuelle Handlungen unter Strafe stellte, sondern auch die bloße Absicht bzw. das objektive Empfinden einer Verletzung des Schamgefühls, wofür nicht einmal mehr Berührungen notwendig waren. Also konnte im Prinzip jeder Mann der Homosexualität beschuldigt werden und musste dann mit einer Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren rechnen, da im Zuge der Reformierung auch die Höchststrafe von sechs Monaten auf fünf Jahre erhöht wurde.
In der Nachkriegszeit war der Umgang mit dem Phänomen der Homosexualität in der DDR zunächst uneinheitlich bis sie 1968 ihr eigenes Strafgesetzbuch bekam, indem der § 151 sexuelle Handlungen von Erwachsenen mit unter 18 jährigen des gleichen Geschlechts mit Freiheitsstrafe oder Bewährung ahndete. Dieser Paragraph war geschlechtsneutral verfasst, so dass nun auch Frauen belangt werden konnten. Allerdings war die Homophilie unter Erwachsenen legal.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Geschichte der Homosexualität und Einleitung
- 2 Was ist Homosexualität?
- 3 Das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit - ein System der Zwangsheterosexualität und Ursache für Diskriminierung
- 4 Begriffsdefinitionen
- 4.1 Das Coming Out
- 4.2 Zum Identitätsbegriff
- 5 Adoleszenz und ihre besonderen Anforderungen für Homosexuelle
- 5.1 Rolle der Peer Group in der Adoleszenz und ihre besondere Problematik für homosexuelle Jugendliche
- 5.2 Positiv besetzte Vorbilder als selbstwertstärkende Instanzen
- 5.3 Die Rolle der Eltern, Reaktionen auf das Coming Out und die Folgen
- 6 Die Schule als wichtige Instanz für die Identitätsbildung
- 7 Handlungsanforderungen an die soziale Arbeit - am Beispiel des Lesben - Projekts „Ragazza” in München und einer Schwulengruppe in Köln
- 8 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Situation homosexueller Jugendlicher im Kontext gesellschaftlicher Erwartungen und Normen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Homosexualität und deren Auswirkungen auf die Identitätsfindung und den Alltag betroffener Jugendlicher. Ein Fokus liegt auf den Herausforderungen in der Adoleszenz, der Rolle von Peergroup und Familie sowie den Handlungsmöglichkeiten sozialer Arbeit.
- Historische Entwicklung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Homosexualität
- Herausforderungen der Identitätsfindung homosexueller Jugendlicher in der Adoleszenz
- Rolle von Peergroup und Familie im Coming-out-Prozess
- Bedeutung von positiven Vorbildern für die Selbstwertsteigerung
- Handlungsansätze der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Geschichte der Homosexualität und Einleitung: Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Homosexualität, von Sünde und Legalität im Mittelalter bis zur Kriminalisierung und Pathologisierung im 19. und 20. Jahrhundert. Sie zeigt die rechtlichen Veränderungen in Deutschland und der DDR, von drakonischen Strafen bis zur Legalisierung homosexueller Beziehungen und der Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes. Der Kontrast zwischen rechtlicher Gleichstellung und gesellschaftlicher Akzeptanz wird hervorgehoben und die Frage nach den Herausforderungen für homosexuelle Jugendliche im Kontext gesellschaftlicher Rollenerwartungen aufgeworfen.
2 Was ist Homosexualität?: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext und kann hier nicht ergänzt werden)
3 Das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit - ein System der Zwangsheterosexualität und Ursache für Diskriminierung: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext und kann hier nicht ergänzt werden)
4 Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie "Coming Out" und "Identität" im Kontext der homosexuellen Lebenswirklichkeit. Es analysiert die Bedeutung des Coming-out-Prozesses für die Selbstfindung und die Herausforderungen, die mit der Offenbarung der sexuellen Orientierung verbunden sind. Der Identitätsbegriff wird im Hinblick auf die spezifischen Bedingungen homosexueller Jugendlicher diskutiert, die zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und individueller Selbstwahrnehmung navigieren müssen.
5 Adoleszenz und ihre besonderen Anforderungen für Homosexuelle: Dieses Kapitel untersucht die besonderen Herausforderungen, denen sich homosexuelle Jugendliche in der Adoleszenz gegenübersehen. Es analysiert die Rolle der Peergroup, die oft geprägt ist von Homophobie und Ausgrenzung, und die Bedeutung von positiven Vorbildern für die Stärkung des Selbstwertgefühls. Besonders eingehend wird die Rolle der Eltern und ihre Reaktionen auf das Coming-out behandelt, wobei die weitreichenden Folgen für die psychosoziale Entwicklung der Jugendlichen herausgestellt werden.
6 Die Schule als wichtige Instanz für die Identitätsbildung: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext und kann hier nicht ergänzt werden)
7 Handlungsanforderungen an die soziale Arbeit - am Beispiel des Lesben - Projekts „Ragazza” in München und einer Schwulengruppe in Köln: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Unterstützung homosexueller Jugendlicher. Es analysiert am Beispiel des Lesben-Projekts "Ragazza" in München und einer Schwulengruppe in Köln, welche Maßnahmen und Strategien effektiv zur Förderung von Selbstwertgefühl, Integration und sozialer Teilhabe beitragen. Die Notwendigkeit von spezifischen Angeboten und die Bedeutung von geschlechtssensibler Sozialarbeit werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Homosexualität, Adoleszenz, Identitätsfindung, Coming-out, Peergroup, Familie, Diskriminierung, soziale Arbeit, gesellschaftliche Normen, Rollenerwartungen, Lebenspartnerschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Situation homosexueller Jugendlicher im Kontext gesellschaftlicher Erwartungen und Normen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Situation homosexueller Jugendlicher vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Erwartungen und Normen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Homosexualität und deren Auswirkungen auf die Identitätsfindung und den Alltag betroffener Jugendlicher. Ein Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen in der Adoleszenz, der Rolle von Peergroup und Familie sowie den Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit. Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zur Geschichte der Homosexualität, Definitionen zentraler Begriffe (Coming-out, Identität), eine Analyse der Herausforderungen in der Adoleszenz, die Rolle der Schule, und Beispiele guter Praxis aus der Sozialen Arbeit (Lesben-Projekt „Ragazza“ in München und eine Schwulengruppe in Köln).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Homosexualität, die Herausforderungen der Identitätsfindung homosexueller Jugendlicher in der Adoleszenz, die Rolle von Peergroup und Familie im Coming-out-Prozess, die Bedeutung positiver Vorbilder für die Selbstwertsteigerung und Handlungsansätze der Sozialen Arbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 behandelt die Geschichte der Homosexualität und stellt den Kontext dar. Kapitel 2 befasst sich mit der Definition von Homosexualität (Kapitelzusammenfassung fehlt im Original). Kapitel 3 analysiert das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit als System der Zwangsheterosexualität und Ursache für Diskriminierung (Kapitelzusammenfassung fehlt im Original). Kapitel 4 definiert zentrale Begriffe wie "Coming Out" und "Identität". Kapitel 5 untersucht die besonderen Herausforderungen homosexueller Jugendlicher in der Adoleszenz, einschließlich der Rolle der Peergroup, der Familie und positiver Vorbilder. Kapitel 6 befasst sich mit der Rolle der Schule bei der Identitätsbildung (Kapitelzusammenfassung fehlt im Original). Kapitel 7 beleuchtet die Handlungsansätze der Sozialen Arbeit anhand von Beispielprojekten in München und Köln. Kapitel 8 ist eine Schlussbemerkung.
Welche Rolle spielen die Familie und die Peergroup?
Die Arbeit untersucht die bedeutende Rolle der Familie und der Peergroup im Coming-out-Prozess und deren Einfluss auf die psychosoziale Entwicklung homosexueller Jugendlicher. Die Reaktionen der Eltern auf das Coming-out werden als besonders folgenreich hervorgehoben. Die Peergroup wird oft als Quelle von Homophobie und Ausgrenzung dargestellt, während positive Vorbilder als selbstwertstärkend beschrieben werden.
Welche Bedeutung hat die Adoleszenz für homosexuelle Jugendliche?
Die Adoleszenz wird als besonders herausfordernde Phase für homosexuelle Jugendliche dargestellt, da sie mit der Entwicklung der sexuellen Identität und dem Umgang mit gesellschaftlicher Homophobie und möglichen Diskriminierungserfahrungen verbunden ist. Die Arbeit betont die Notwendigkeit von Unterstützung und positiven Vorbildern in dieser Phase.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit?
Die Arbeit betont die wichtige Rolle der Sozialen Arbeit bei der Unterstützung homosexueller Jugendlicher. Anhand von Beispielen aus der Praxis (Lesben-Projekt „Ragazza“ in München und eine Schwulengruppe in Köln) werden effektive Maßnahmen und Strategien zur Förderung von Selbstwertgefühl, Integration und sozialer Teilhabe vorgestellt. Die Notwendigkeit von spezifischen Angeboten und geschlechtssensibler Sozialarbeit wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Homosexualität, Adoleszenz, Identitätsfindung, Coming-out, Peergroup, Familie, Diskriminierung, soziale Arbeit, gesellschaftliche Normen, Rollenerwartungen, Lebenspartnerschaft.
- Arbeit zitieren
- Nicole Wilbrandt (Autor:in), 2005, Eigentlich ganz normal und doch irgendwie anders - homosexuelle Adoleszenten im Spiegel der Gesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43928