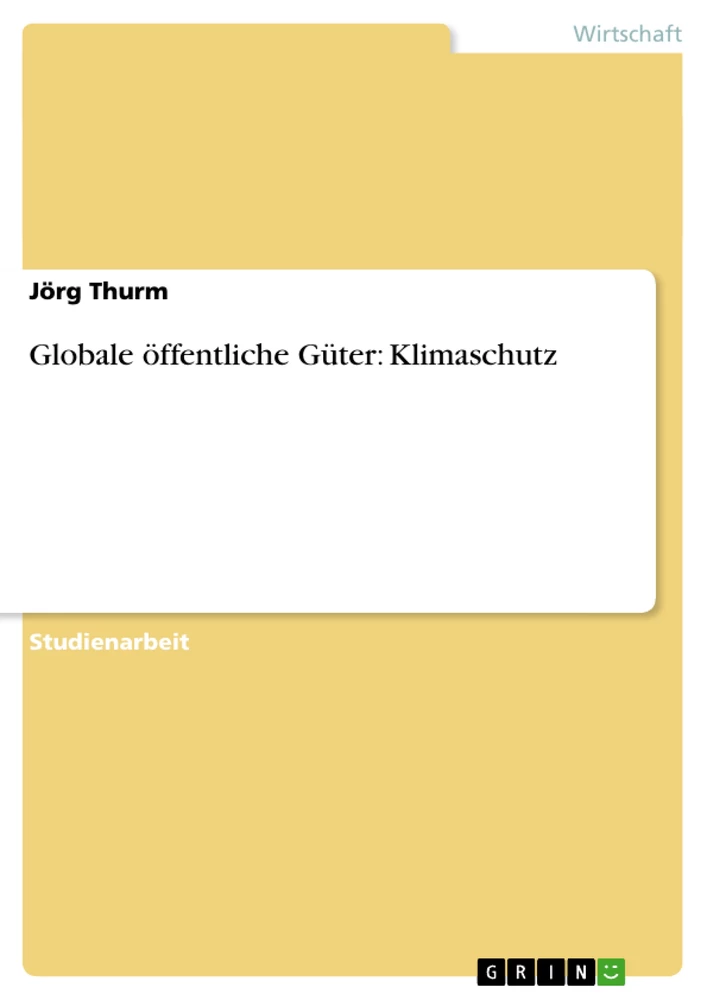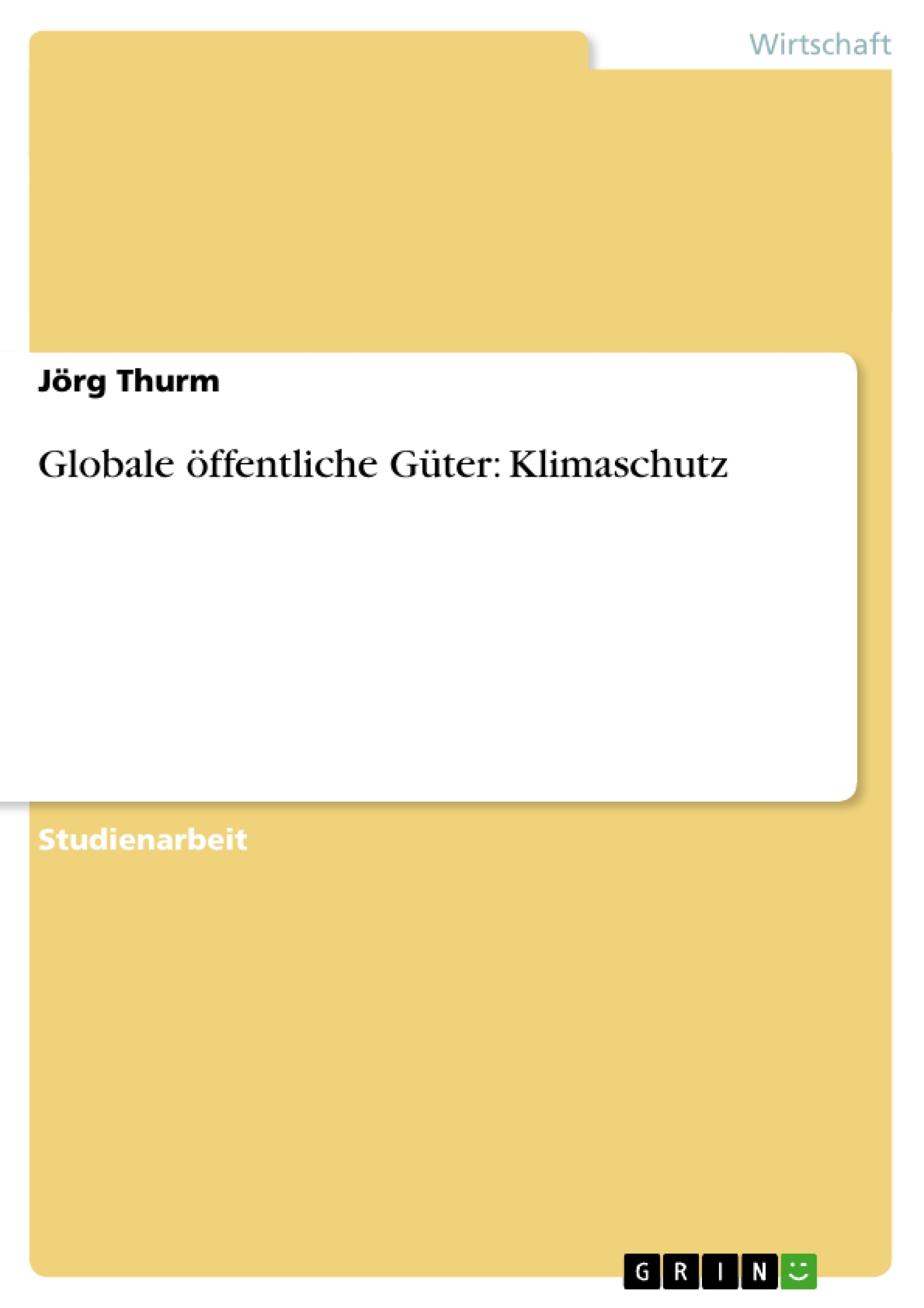Treibhausgase in der Atmosphäre um unsere Erde sorgen dafür, dass die Wärmestrahlung, die uns von der Sonne erreicht, in der Nähe des Planeten gehalten wird. Während dieser natürliche Treibhauseffekt für ein Leben auf der Erde unverzichtbar ist, macht der anthropogene, also vom Menschen gemachte Treibhauseffekt negative Schlagzeilen: Seit über 15 Jahren weiß man, dass die seit Beginn der Industrialisierung vermehrt stattfindende Anreicherung der Atmosphäre mit Treibhausgasen zu einer unnatürlichen Erwärmung der Erdatmosphäre führt. Die negativen Auswirkungen dieses Prozesses sind bereits jetzt immer deutlicher zu spüren. Doch obwohl Problem und Ursache bekannt sind, nimmt der weltweite Ausstoß an Klimagasen nach wie vor zu.
Um den Trend zu stoppen, wurde 1997 das Kyoto-Protokoll ausgehandelt. Auf Basis dieses Abkommens sollen zunächst 38 Staaten, die allerdings 86% des weltweiten Klimagasausstoßes verursachen, ihre Emissionen reduzieren. Der nach wie vor weitgehend ungezügelte Ausstoß der Treibhausgase wirft jedoch Fragen auf: Kann das Protokoll überhaupt Erfolg haben? Warum sollten die Industriestaaten in größerem Umfang in Klimaschutz investieren und wie ist der Ausstieg der USA aus dem Prozess zu beurteilen?
Ziel dieser Arbeit ist es, Klimaschutzbemühungen generell, sowie das Kyoto-Protokoll im speziellen ökonomisch zu analysieren. Dazu wird in Kapitel 2 zunächst der Bezug zur Theorie der (Globalen) Öffentlichen Güter hergestellt. Vor dem Hintergrund der Theorie und der darin vorgestellten unterschiedlichen Güterarten ist zu klären, warum es überhaupt zu einer Belastung der Atmosphäre kommt und wie das Gut Klimaschutz, gerade angesichts der globalen Dimension, effizient bereitgestellt werden kann. Kapitel 3 stellt die Entwicklung des Kyoto-Prozesses dar und beschreibt die einzelnen Instrumente des Abkommens. Anschließend wird das Protokoll auf Basis der in Kapitel 2 aufgestellten Anforderungen an ein effizientes Klimaabkommen untersucht und bewertet. In Kapitel 4 folgen Zusammenfassung und Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ökonomische Betrachtung des Klimaschutzes
- Das Konzept der öffentlichen Güter
- Rein öffentliche und private Güter
- Mischformen der öffentlichen Güter
- Einordnung und Probleme klimaschutzrelevanter öffentlicher Güter
- Instrumente zur Internalisierung externer Effekte
- Anforderungen an ein globales Klimaschutzprogramm
- Das Konzept der öffentlichen Güter
- Analyse des Kyoto-Protokolls
- Entwicklung und Bestandteile des Kyoto-Protokolls
- Bewertung des Protokolls und seiner Instrumente
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die ökonomische Analyse von Klimaschutzbemühungen im Allgemeinen und des Kyoto-Protokolls im Besonderen. Hierbei soll der Bezug zur Theorie der (Globalen) Öffentlichen Güter hergestellt werden. Vor diesem Hintergrund der Theorie und der darin vorgestellten unterschiedlichen Güterarten wird geklärt, warum es zu einer Belastung der Atmosphäre kommt und wie das Gut Klimaschutz, gerade angesichts der globalen Dimension, effizient bereitgestellt werden kann.
- Ökonomische Betrachtung des Klimaschutzes im Kontext der Theorie der öffentlichen Güter
- Analyse der Herausforderungen bei der Bereitstellung des globalen öffentlichen Gutes Klimaschutz
- Bewertung des Kyoto-Protokolls als Instrument zur Reduktion von Treibhausgasemissionen
- Untersuchung der Effizienz des Kyoto-Protokolls im Hinblick auf die Anforderungen an ein globales Klimaschutzprogramm
- Analyse der Bedeutung des Kyoto-Protokolls für die globale Klimaschutzpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Klimaschutz ein und erläutert die Problematik des anthropogenen Treibhauseffekts. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Effektivität des Kyoto-Protokolls und den Herausforderungen des Klimaschutzes dar. Die Arbeit gliedert sich in die einzelnen Kapitel.
- Ökonomische Betrachtung des Klimaschutzes: Dieses Kapitel stellt die Theorie der öffentlichen Güter vor und ordnet Klimaschutz als globales öffentliches Gut ein. Es beleuchtet die Probleme bei der Bereitstellung von öffentlichen Gütern, insbesondere die Herausforderung der Nicht-Ausschließbarkeit und der Nicht-Rivalität im Konsum. Darüber hinaus werden Instrumente zur Internalisierung externer Effekte, wie z.B. Pigou-Steuern oder Emissionshandel, vorgestellt.
- Analyse des Kyoto-Protokolls: In diesem Kapitel werden die Entwicklung und die Bestandteile des Kyoto-Protokolls beschrieben. Die einzelnen Instrumente des Abkommens werden vorgestellt und anhand der im vorherigen Kapitel aufgestellten Anforderungen an ein effizientes Klimaabkommen bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Klimaschutz, globale öffentliche Güter, Kyoto-Protokoll, Treibhausgasemissionen, externe Effekte, Internalisierung, Emissionshandel, Pigou-Steuer, effiziente Ressourcenallokation.
- Quote paper
- Jörg Thurm (Author), 2004, Globale öffentliche Güter: Klimaschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43903