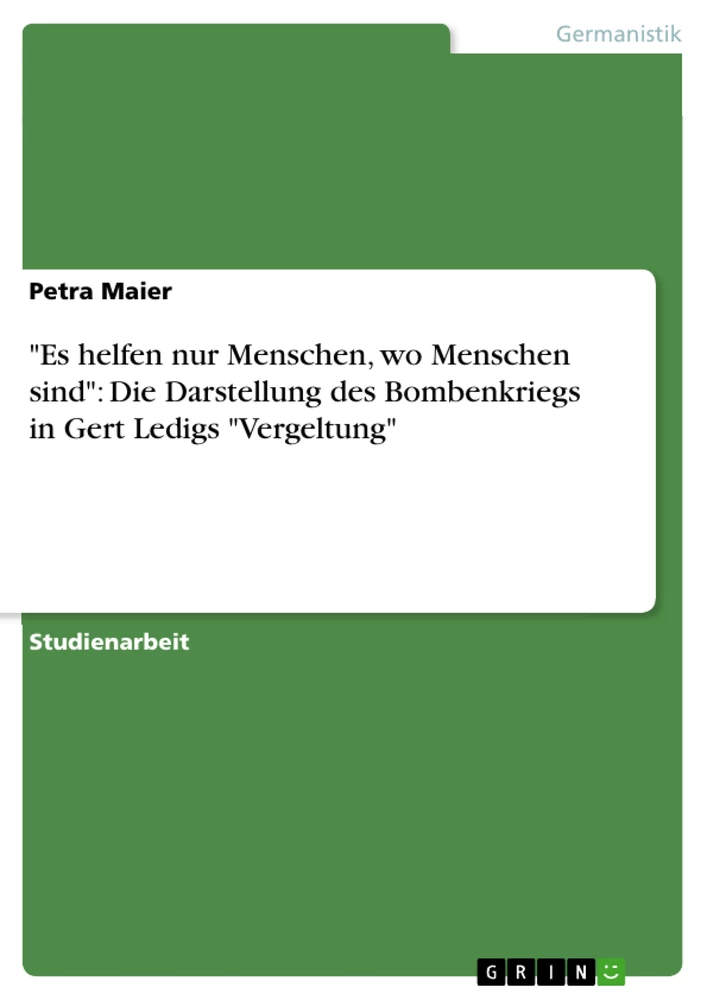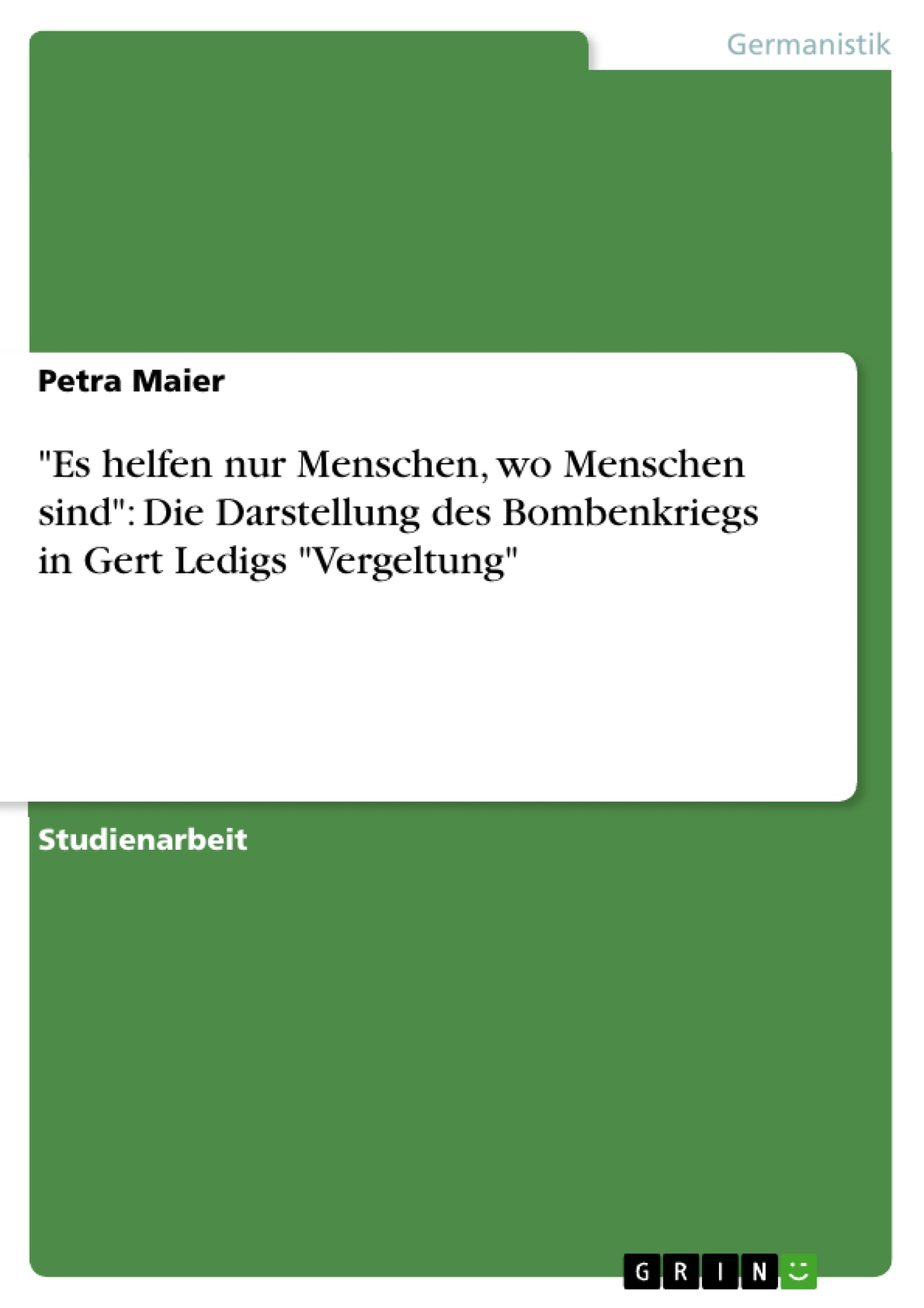„Ein 86- Millionen Volk, das man einst als Volk der Dichter und Denker rühmte, hat die schlimmste Katastrophe seiner jüngsten Geschichte mit Auslöschung seiner Städte und millionenfacher Vertreibung über sich ergehen lassen. Da fällt einem schwer zu glauben, dass diese Ereignisse nicht ein gewaltiges literarisches Echo gefunden haben.“ Als Ende 1997 der in England lebende deutsche Schriftsteller Winfried G. Sebald in seiner Züricher Poetikvorlesung beklagt, die Bombardierung deutscher Städte sei als literarisches Thema weitgehend tabuisiert und zu einer „Spukexistenz im kollektiven Unbewussten der Deutschen“ verdammt worden, ist Gert Ledigs Roman „Vergeltung“ noch verschollen.
1956 erscheint er zum ersten Mal, doch die Rezensionen sind fast durchgehend vernichtend. Es heißt, der Roman sei „peinlich“, „brutal“ und geschmacklos. Die FAZ empört sich über die „gewollt makabere Schreckensmalerei.“ Die Zeit sieht den „Rahmen des Glaubwürdigen und Zumutbaren“ verlassen. Der Rheinische Merkur glaubt „abscheuliche Perversität“ zu entdecken, ein „Gruselkabinett.“ So kommt es, dass der Roman schnell in Vergessenheit gerät und mit ihm sein „Schöpfer“ Gert Ledig. Erst als sich die Debatte um den literarischen Niederschlag des Bombenkriegs entfacht, rückt der Roman ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Doch die Neuauflage erlebt der Autor nicht mehr. Kurz vor dem Erscheinen 1999 stirbt Gert Ledig in einem Krankenhaus in Landsberg.
Ich möchte in meiner Arbeit untersuchen, wie Gert Ledig seine literarische Annäherung an das Thema Bombenkrieg akzentuiert. Was hat es mit dem Titel auf sich? Warum bedient er sich filmerischer Mittel? Welche Funktion hat die Religion in „Vergeltung“, welches Menschenbild enthüllt der Roman, und wie steht es um die im Roman vermittelten Werte? Ferner versuche ich eine Idee davon zu bekommen, warum sein Roman bei der Ersterscheinung im Vergleich zur Neuauflage so große Ablehnung erfährt.
Als Quellen ziehe ich vor allem die Zeitungsrezensionen und Aufsätze heran, die in den letzten Jahren infolge der Bombenkriegsdebatte nach Sebalds Vorlesung erschienen sind. Hier ist insbesondere Gabriele Hundrieser heraus zu heben, die sich mit Ästhetik von Gewalt und der Sinnlosigkeit des Krieges bei Ledig auseinander setzt. Desweiteren sind zu nennen Jan-Pieter Barbian, der die Bedeutung von Ledigs Werken für das 20. Jahrhundert skizziert und der Aufsatz von Karsmaker, die eine detaillierte Analyse des Romans vorlegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Titel: Vergeltung als Teufelskreis
- Filmerische Mittel als Rhetorik der Unruhe
- Und da ich schon wanderte im finsteren Tal...: Religion als Ausverkaufsware
- „Es helfen keine Menschen, wo Maschinen sind“: Der Mensch als aussterbende Gattung
- Ehre, Treue, Vaterlandsliebe, Heldentum: Radikale Absage an die Ideologie der Werte
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die literarische Annäherung von Gert Ledig an das Thema Bombenkrieg in seinem Roman „Vergeltung“. Dabei werden die Titelgestaltung, die filmerischen Mittel, die Rolle der Religion, das Menschenbild im Roman und die vermittelten Werte analysiert. Ziel ist es, ein Verständnis dafür zu gewinnen, warum Ledigs Roman bei der Ersterscheinung auf große Ablehnung stieß.
- Die Bedeutung des Titels „Vergeltung“ als zentrales Handlungsmotiv
- Der Einsatz filmerischer Mittel zur Darstellung der Gewalt und Unruhe
- Die Rolle der Religion als Instrument der Manipulation und Verzweiflung
- Die Dekonstruktion traditioneller Werte wie Ehre, Treue und Vaterlandsliebe
- Die Darstellung des Menschen als Opfer und Täter zugleich
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext des Romans und beleuchtet die kritischen Reaktionen auf die Ersterscheinung von „Vergeltung“ im Jahr 1956. Außerdem werden die Forschungsziele und die verwendeten Quellen vorgestellt.
- Der Titel: Vergeltung als Teufelskreis: Dieses Kapitel analysiert den Titel des Romans als zentrales Motiv. Es zeigt, wie sich die Vergeltung als ein sich selbst verstärkender Kreislauf durch den Roman zieht und sowohl auf personaler Ebene als auch zwischen Gruppen und Nationen wirksam wird. Anhand von Strenehens Schicksal wird der Teufelskreis der Vergeltung verdeutlicht, der ihn von der ersten Bombe bis zu seinem Tod verfolgt.
Schlüsselwörter
Bombenkrieg, Vergeltung, Filmerische Mittel, Religion, Menschenbild, Werte, literarische Verarbeitung, Debatte um den Bombenkrieg, Gert Ledig, „Vergeltung“, Rezeption
- Quote paper
- Petra Maier (Author), 2005, "Es helfen nur Menschen, wo Menschen sind": Die Darstellung des Bombenkriegs in Gert Ledigs "Vergeltung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43897