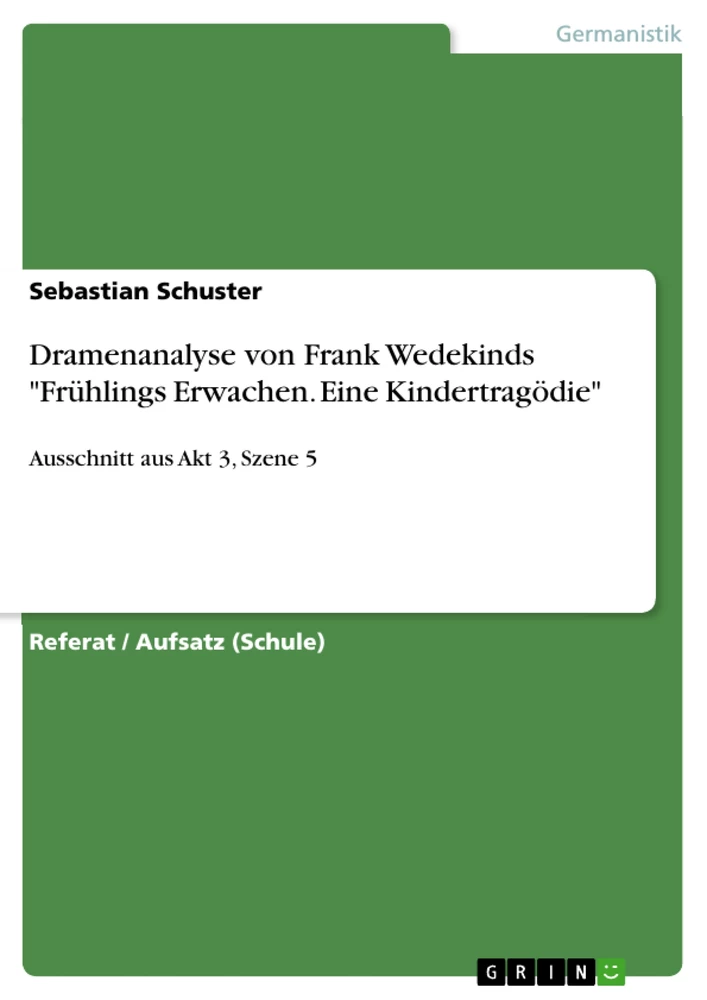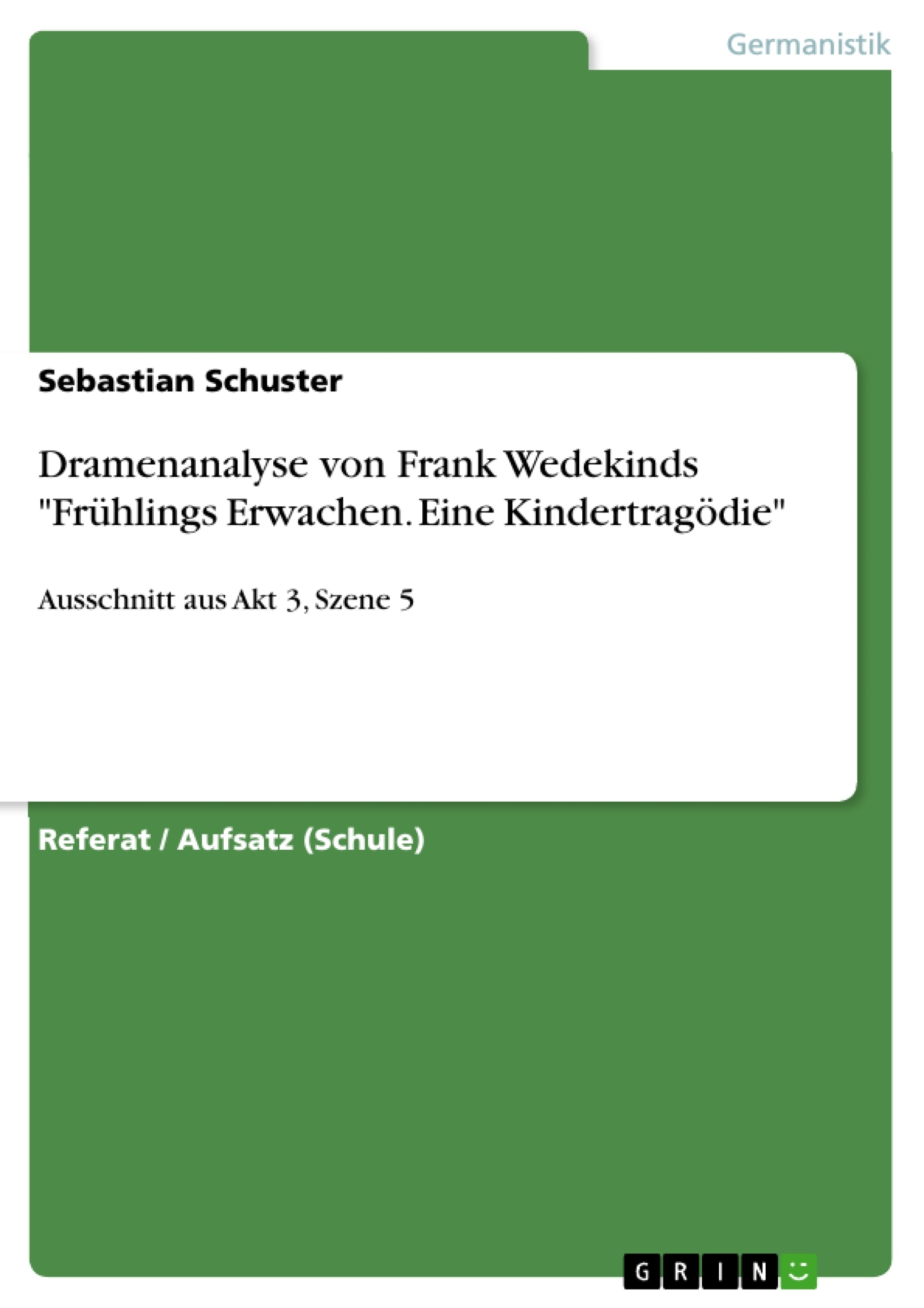Im Jahr 2017 stellt in der modernen mitteleuropäischen Gesellschaft das Ausführen des Geschlechtsaktes vor dem Geben des Eheversprechens kaum noch ein Problem dar. Heute ist es gesellschaftliche Realität, dass ein solches Ausleben des Sexualtriebes unabhängig vom Heiraten akzeptiert und praktiziert wird. Zunehmende Toleranz und gesellschaftliche Liberalisierung führte vor wenigen Monaten sogar dazu, dass die Ehe in der Bundesrepublik Deutschland auch für gleichgeschlechtlich lebende Partner geöffnet worden ist. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass die Gesellschaft dem Individuum heute ein hohes Maß an Freiheit, die eigene Sexualität zu entfalten, gewährt. Doch dies war nicht immer der Fall. So dominierten noch im 19. Jahrhundert traditionell-religiöse Vorstellungen das Bild von Sittlichkeit einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Ein Beispiel hierzu stellt Frank Wedekinds Drama „Frühlings Erwachen. Eine Kindertragödie“ dar, welches im Jahr 1891 spielt. Inhaltlich beschäftigt es sich mit sich in der Pubertät befindenden Jugendlichen, welche damit beginnen, ihre Sexualität auszuleben. Dies stößt allerdings aufgrund gesellschaftlicher Intoleranz auf starken Gegenwind, während die Jugendlichen gleichzeitig mit psychischer Instabilität zu kämpfen haben.
Inhaltsverzeichnis
- Schreibplan
- A Der Geschlechtsakt vor der Ehe - Damals und heute
- B Erschließung von Frank Wedekinds Drama „Frühlings Erwachen. Eine Kindertragödie“ (III/5)
- I. Inhaltsangabe und Analyse der Gesprächsführung
- 1. Frage nach Wendlas Krankheit
- 2. Konfrontation Wendlas mit ihrer Schwangerschaft
- 3. Vertiefung der Problematik und emotionale Annäherung
- 4. Unterbrechung durch ein Klopfen an der Haustür
- II. Dramaturgische Mittel
- 1. Form der Kommunikation
- 1.1 Zuspitzung des Gesprächs im ersten Sinnabschnitt
- 1.2 Vorwürfe und Rechtfertigungen
- 1.3 Wechsel der vorwerfenden Person
- 1.4 Gelingen der Kommunikation
- 2. Verteilung der Redeanteile
- 3. Figurendarstellung
- 4. Raumgestaltung
- 5. Zeitgestaltung
- III. Sprachlich-stilistische Analyse
- 1. Ausruf mit Wiederholung
- 2. Zweifache Wiederholungen
- 3. Dreifache Wiederholung ergänzt durch einen religiösen Ausdruck
- 4. Religiöser Ausdruck mit dreifacher Namenswiederholung
- 5. Religiöse Ausdruckswahl
- 6. Sprachliche Hervorhebung der Nähe von Mutter und Tochter
- 7. Metonymien: Herz als Symbol der Liebe
- 8. Parataktischer Satzbau
- 9. Vergleich
- 10. Widersprüchliche Aussagen
- IV. Vergleich mit Gotthold Ephraim Lessings Drama „Emilia Galotti“
- 1. Grundsätzliche Schilderung der Situation in „Emilia Galotti“
- 2. Vergleich der Ausgangsbedingungen
- 3. Gegenüberstellung von Emilia und Wendla bezüglich der Schuld
- 4. Gegenüberstellung von Emilia und Wendla bezüglich der Unschuld
- 5. Gesamtaussage über Schuld und Unschuld
- C Heutige Situation von Frauen in der religiös-fundamentalistischen Welt
- Einleitung
- Inhaltsangabe und Gesprächsführung
- Dramaturgische Mittel
- Sprachlich-stilistische Analyse
- Vergleich mit „,Emilia Galotti“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert einen Ausschnitt aus Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“ und untersucht die dramaturgischen, sprachlichen und stilistischen Mittel. Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Mutter und Tochter zu beleuchten und diese mit Lessings „Emilia Galotti“ zu vergleichen. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Schuld und Unschuld im Kontext der vor- und außerehelichen Schwangerschaft im 19. Jahrhundert.
- Kommunikation zwischen Mutter und Tochter
- Darstellung von Schwangerschaft und Schuld im 19. Jahrhundert
- Vergleich mit Lessings „Emilia Galotti“
- Dramaturgische und sprachliche Mittel in Wedekinds Drama
- Gesellschaftliche Normen und sexuelle Moral im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt einen Kontrast zwischen der heutigen liberalen Einstellung zum vor-ehelichen Geschlechtsverkehr und den traditionellen, religiös geprägten Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts dar. Wedekinds „Frühlings Erwachen“ wird als Beispiel für die Konflikte jugendlicher Sexualität in dieser Zeit eingeführt. Der Text legt den Fokus auf die gesellschaftliche Intoleranz und die damit verbundene psychische Belastung der Jugendlichen.
Inhaltsangabe und Gesprächsführung: Dieser Abschnitt analysiert die fünfte Szene des dritten Aktes von Wedekinds Drama. Die Szene gliedert sich in vier Sinnabschnitte, die die Konfrontation zwischen Wendla und ihrer Mutter behandeln. Der erste Abschnitt beschreibt die Verwirrung um Wendlas Krankheit (Bleichsucht/Wassersucht). Der zweite Abschnitt enthüllt Wendlas Schwangerschaft und die folgenden Vorwürfe der Mutter. Im dritten Abschnitt versucht Wendla, sich zu rechtfertigen und ihre Mutter für die fehlende Aufklärung verantwortlich zu machen. Der vierte Abschnitt wird durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen.
Schlüsselwörter
Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“, Dramenanalyse, Mutter-Tochter-Beziehung, Schwangerschaft, Schuld und Unschuld, 19. Jahrhundert, sexuelle Moral, gesellschaftliche Normen, Dramaturgie, Sprachstil, Emilia Galotti, Vergleich, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse eines Auszugs aus Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert einen Ausschnitt aus Frank Wedekinds Drama „Frühlings Erwachen“, genauer die fünfte Szene des dritten Aktes, die das Gespräch zwischen Wendla und ihrer Mutter über Wendlas Schwangerschaft behandelt. Die Analyse fokussiert auf dramaturgische, sprachliche und stilistische Mittel und vergleicht die Darstellung von Schuld und Unschuld mit Lessings „Emilia Galotti“.
Welche Aspekte des Textes werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Inhaltsangabe und Gesprächsführung, die dramaturgischen Mittel (Kommunikationsform, Redeanteile, Figurendarstellung, Raum- und Zeitgestaltung), eine sprachlich-stilistische Analyse (Wiederholungen, religiöse Ausdrucksweise, Metaphern, Satzbau etc.) und einen Vergleich mit Lessings „Emilia Galotti“ hinsichtlich Schuld und Unschuld der Protagonistinnen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Kommunikation zwischen Mutter und Tochter zu beleuchten, die Darstellung von Schwangerschaft und Schuld im 19. Jahrhundert zu untersuchen und diese mit der Darstellung in Lessings „Emilia Galotti“ zu vergleichen. Der Fokus liegt auf der gesellschaftlichen Intoleranz gegenüber außerehelicher Schwangerschaft und den damit verbundenen psychischen Belastungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die den historischen Kontext und die Relevanz des Themas beleuchtet, gefolgt von einer detaillierten Analyse der ausgewählten Szene aus „Frühlings Erwachen“, einschließlich Inhaltsangabe, Gesprächsführung, dramaturgischer und sprachlich-stilistischer Mittel. Ein abschließender Vergleich mit „Emilia Galotti“ und ein Fazit runden die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“, Dramenanalyse, Mutter-Tochter-Beziehung, Schwangerschaft, Schuld und Unschuld, 19. Jahrhundert, sexuelle Moral, gesellschaftliche Normen, Dramaturgie, Sprachstil, Emilia Galotti, Vergleich, Kommunikation.
Wie wird der Vergleich mit „Emilia Galotti“ durchgeführt?
Der Vergleich mit Lessings „Emilia Galotti“ konzentriert sich auf die Darstellung von Schuld und Unschuld im Kontext der vor- und außerehelichen Schwangerschaft. Es werden die Ausgangsbedingungen, die Charaktere (Emilia und Wendla) und die jeweilige Zuschreibung von Schuld und Unschuld gegenübergestellt, um allgemeinere Aussagen über Schuld und Unschuld in den beiden Werken zu treffen.
Welche gesellschaftlichen Aspekte werden thematisiert?
Die Arbeit thematisiert die gesellschaftlichen Normen und die sexuelle Moral des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Intoleranz gegenüber vor- und außerehelicher Schwangerschaft und deren Auswirkungen auf die betroffenen Frauen und Mädchen. Ein Vergleich mit der heutigen Einstellung zum Thema wird in der Einleitung angedeutet.
- Quote paper
- Sebastian Schuster (Author), 2017, Dramenanalyse von Frank Wedekinds "Frühlings Erwachen. Eine Kindertragödie", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438886