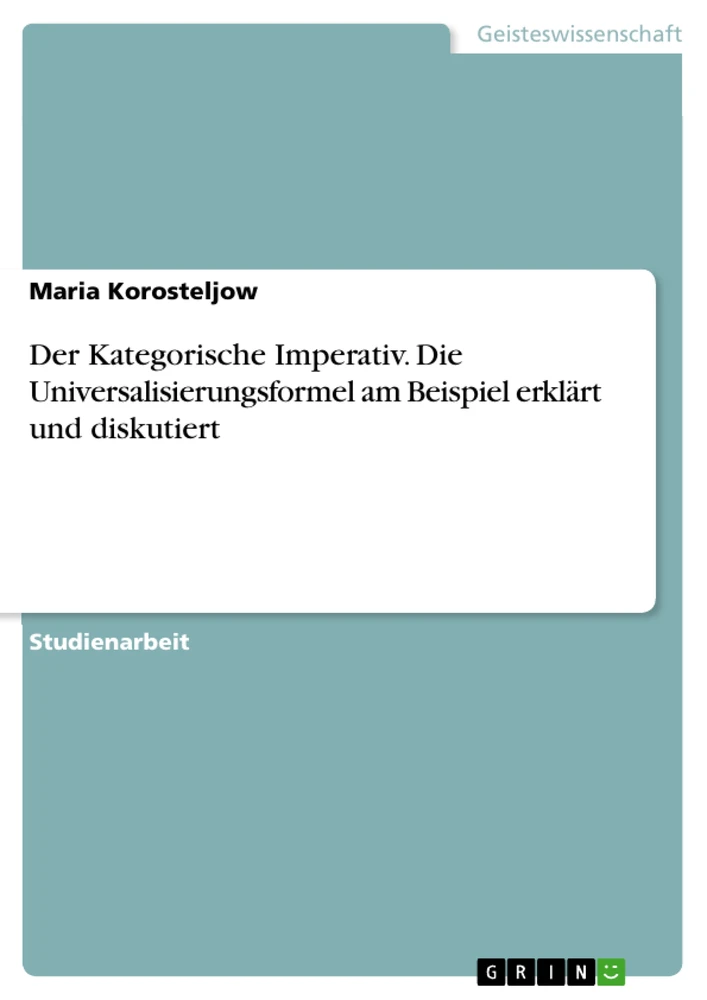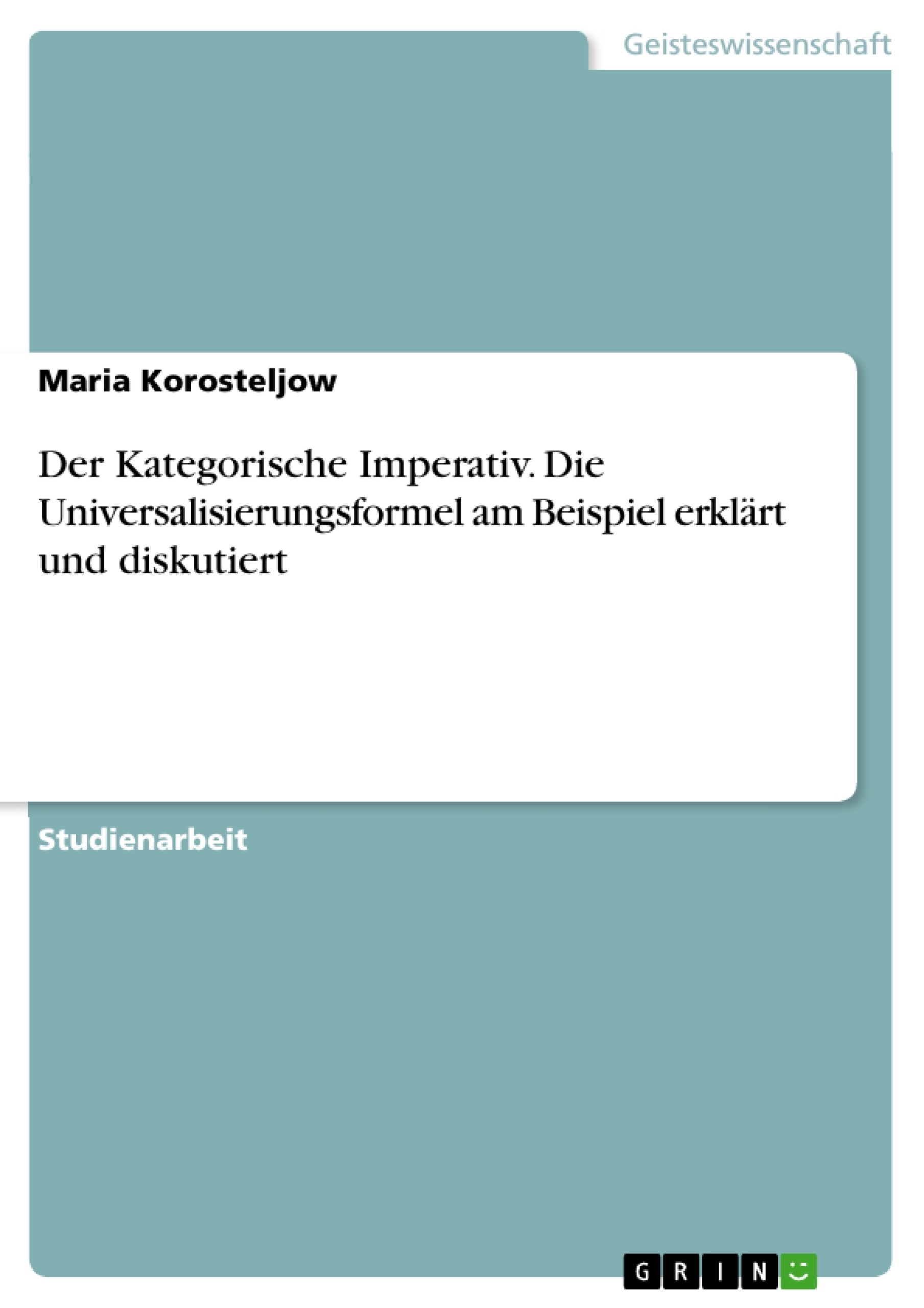Immanuel Kant – einer der größten deutschen Philosophen und bedeutendsten europäischen Schriftsteller und Denker der Neuzeit. Bis heute dienen seine Werke als Basis ethischer und philosophischer Analysen und bilden den Höhepunkt in der Geschichte des modernen Handels und Denkens. Durch seine Arbeiten revolutionierte er nicht nur Ethik als Disziplin, sondern beeinflusste auch den Prozess der deutschen Aufklärung maßgeblich. Bis heute werden seine Gedanken, Ideen und Prinzipien geachtet und immer wieder gerne in zeitgenössische Untersuchungen mit eingebracht. Der kategorische Imperativ, eines der bekanntesten Konzepte Kants, versteht sich als die höchste ethische Handlungsweisung in der Philosophie und als ein absoluter Meilenstein in der Analyse der menschlichen Moral. Als Teil des Werkes Grundlegung zur Metaphysik der Sitten zeichnen Kants Überlegungen einen fundamentalen Schritt im Fachbereich Ethik auf, nachdem Kant sich vorher hauptsächlich mit der theoretischen Philosophie beschäftigt hat. Allein durch den kategorischen Imperativ entwickelte Kant einen universellen Wegweiser zu moralisch wertvollem und guten Handeln. Dabei muss eine Situation oder eine mögliche Handlung immer auf ihre Moralität und Vertretbarkeit hin überprüft werden. Ein wichtiger Bestandteil dieses Konzeptes ist die Universalisierungsformel, mit deren Hilfe man jederzeit seine Intentionen oder Handlungen überprüfen kann. Dieser Thematik widme ich mich nun im Rahmen dieser Hausarbeit. Ich beginne mit einer detaillierten Erläuterung des kategorischen Imperativs und der Universalisierungsformel. Danach gehe ich noch tiefer in die Materie ein und wende die Universalisierungsformale an Hand eines konkreten Beispiels an. Sobald also das genaue Prozedere der Moralüberprüfung nach Kant aufgezeigt ist, diskutiere ich die Plausibilität dieses Konzeptes zur Bestimmung von moralischer Richtigkeit. Ich beende meine Ausführungen mit einem kurzen Fazit, in dem ich die Erkenntnisse im Rahmen der Fragestellung abschließend reflektiere.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der kategorische Imperativ
- Die Universalisierungsformel
- Beispiel
- Diskussion der Plausibilität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem kategorischen Imperativ, einem zentralen Konzept der Moralphilosophie von Immanuel Kant. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Universalisierungsformel, eine der wichtigsten Formeln des kategorischen Imperativs, näher zu erläutern und an einem konkreten Beispiel zu diskutieren.
- Der kategorische Imperativ als höchstes ethisches Handlungsprinzip
- Die Universalisierungsformel als Prüfstein für moralische Handlungen
- Die Anwendung der Universalisierungsformel in der Praxis
- Diskussion der Plausibilität und Anwendbarkeit der Universalisierungsformel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt den kategorischen Imperativ sowie die Universalisierungsformel als zentrale Konzepte der Ethik von Immanuel Kant vor.
- Der kategorische Imperativ: Dieses Kapitel erläutert den kategorischen Imperativ als grundlegendes Prinzip moralischen Handelns nach Kant. Es werden die wichtigsten Merkmale des kategorischen Imperativs sowie seine verschiedenen Formeln vorgestellt.
- Die Universalisierungsformel: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Universalisierungsformel, der ersten Formel des kategorischen Imperativs. Es werden die Bedeutung und die Funktionsweise der Formel im Detail erklärt.
- Beispiel: Dieses Kapitel wendet die Universalisierungsformel auf ein konkretes Beispiel an, um die praktische Anwendung der Formel zu demonstrieren.
Schlüsselwörter
Im Zentrum dieser Hausarbeit stehen die Konzepte des kategorischen Imperativs, der Universalisierungsformel und der moralischen Handlungsbeurteilung nach Immanuel Kant. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie man anhand der Universalisierungsformel die Moralität von Handlungen überprüfen kann und diskutiert die Plausibilität dieses Ansatzes.
- Quote paper
- Maria Korosteljow (Author), 2018, Der Kategorische Imperativ. Die Universalisierungsformel am Beispiel erklärt und diskutiert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438857