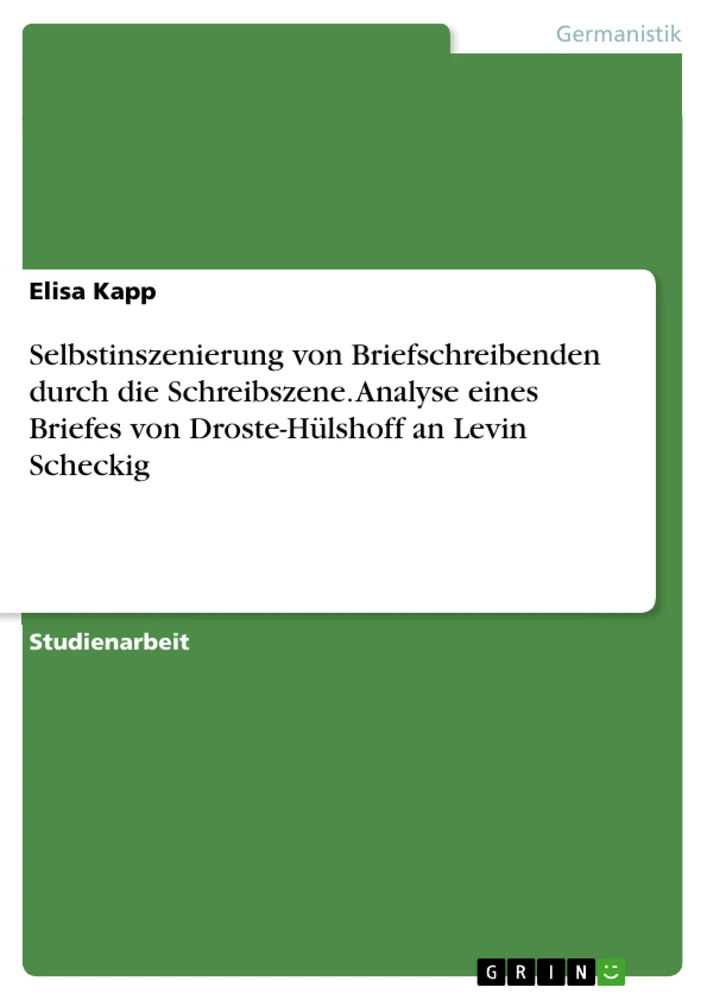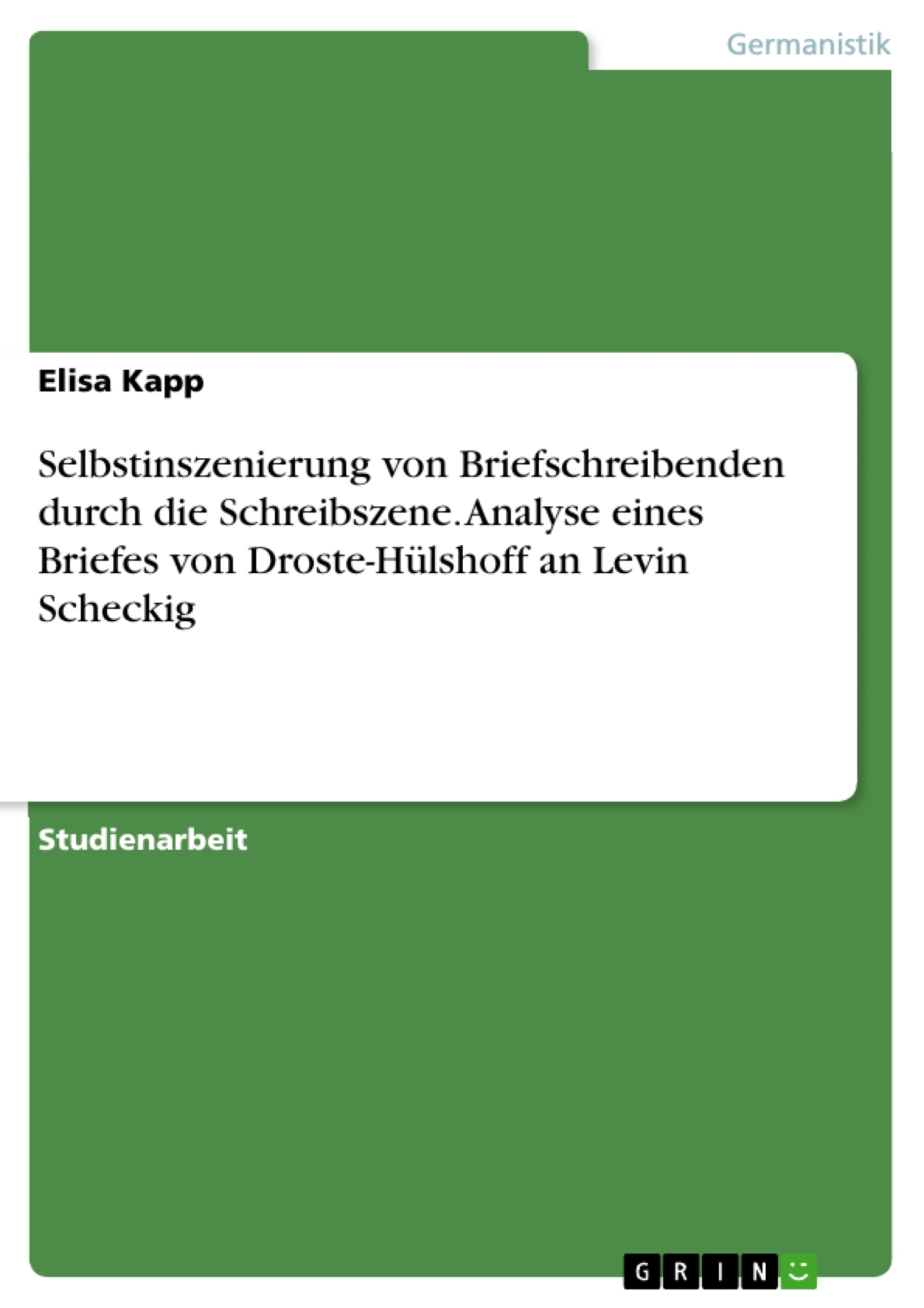Ein literarisches Werk – wie beispielsweise ein Brief – entsteht, indem es geschrieben wird. Was banal klingen mag umschließt bei näherer Betrachtung eine geistige und gleichzeitig sinnlichkörperliche Vielfalt an Erfahrungen für den Schreibenden (und später für den Lesenden). Der Akt des Schreibens konstruiert – vereinfacht nach Roland Barthes – loslösbar vom Autor das Werk als solches. Schreiben als Tätigkeit ist eine sinnliche Erfahrung des ganzen Körpers, insbesondere, wenn klecksende Tinte und ein kratzender Federkiel, rauer Löschsand zur Vermeidung von Tintenflecken und glattes, faltbares Papier den Schreibvorgang rahmen. Ein Brief gilt schon seit jeher als Mittel der Kommunikation und der Selbstdarstellung. Der Privatbrief bot früher einen Raum für die schriftlich-literarische Darstellung von intimen Gedanken und Gefühlen, die Möglichkeit zur realen und fiktiven Selbstdarstellung und zur Selbstreflexion. In der florierenden Briefkultur des 18./19. Jahrhunderts nutzen insbesondere Frauen diesen Weg, weil sie durch das Briefeschreiben neben der Kontaktpflege einen Zugang zur Literaturszene und ersten Autorschaft bekamen. Das weibliche Leben und Erleben konnten in Briefen den Ausdruck finden, der in der Literaturlandschaft noch nicht gewährt wurde. Auch konnten Frauen im Rahmen des Briefeschreibens leichter Beziehungen eingehen und unterhalten, als es ihnen im täglichen Leben möglich war. Ein Brief diente daher im 18./19. Jahrhundert nicht nur der Übermittlung von Informationen, sondern ersetzte die vielen Facetten, die auch eine direkte Begegnung aufweisen würde: Das tiefgehende Gespräch, die sinnliche Berührung von Hand (zu Papier) zu Hand, die in der Handschrift erkennbare individuelle Gestik eines Menschen, das hörbare Knistern des Papiers und die sichtbare Einzigartigkeit der Schrift mitsamt Schönheitsflecken und Korrekturen und sogar im erotischen Sinne das Erleben vom „Entkleiden“ des Briefes beim Aufbrechen des Siegels, Entfalten und (glatt) Streiche(l)n des Papiers.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die schriftliche und zeichnerische Inszenierung des Schreibens
- 2.1 Die Schreibszene
- 2.2 Das Schreibwerkzeug
- 2.3 Räumlichkeiten
- 3. Beigefügte Skizzen und Zeichnungen von Räumlichkeiten in Briefen
- 4. Intentionen und Selbstdarstellung am Beispiel von Levin Schücking
- 4.1 Der Brief: Schücking an Droste
- 4.2 Die Zeichnung: Das Zimmer
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Selbstinszenierung von Briefschreibenden anhand der Schreibszene. Ziel ist es, die Bedeutung der Schreibszene – sowohl räumlich als auch zeitlich – für die Selbstdarstellung im Brief zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die materielle und körperliche Dimension des Schreibakts gelegt.
- Die Rolle der Schreibszene in der Selbstinszenierung
- Die Bedeutung von Schreibwerkzeugen und räumlichen Gegebenheiten
- Analyse der Selbstinszenierung anhand eines Briefes von Levin Schücking
- Die Schreibszene als Ausdruck von Identität und Teilhabe an der Literaturszene
- Der Brief als Medium der intimen Selbstdarstellung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Selbstinszenierung von Briefschreibenden ein und betont die sinnlich-körperliche Erfahrung des Schreibakts. Sie verweist auf die Bedeutung des Briefs als Medium der Kommunikation und Selbstdarstellung, insbesondere im 18./19. Jahrhundert, wo er Frauen einen Zugang zur Literaturszene ermöglichte. Der Brief wird als mehrschichtiger Akt beschrieben, der über die bloße Informationsübermittlung hinausgeht und sinnliche und emotionale Aspekte umfasst. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse eines Briefes von Levin Schücking an Annette Droste-Hülshoff, um die Selbstinszenierung des Schreibenden anhand der dargestellten Schreibszene zu untersuchen.
2. Die schriftliche und zeichnerische Inszenierung des Schreibens: Dieses Kapitel definiert und differenziert die Schreibszene in zeitliche und räumliche Dimensionen. Es werden die materiellen Voraussetzungen des Schreibens (Schreibwerkzeug, Papier, Raum) sowie die körperliche Geste des Schreibenden betont. Die Schreibszene wird nicht nur als Schauplatz, sondern als vom Schreibenden aktiv mitgestaltete und erschaffene Umgebung verstanden, die Ausdruck seiner Identität und Kreativität ist. Die Darstellung von Schreibszene in der Bildkunst seit dem 16. Jahrhundert wird als Beleg für deren Bedeutung herangezogen.
3. Beigefügte Skizzen und Zeichnungen von Räumlichkeiten in Briefen: (Annahme: Dieses Kapitel existiert und analysiert Skizzen in Briefen. Da der Text keine Details enthält, muss diese Zusammenfassung hypothetisch sein.) Dieses Kapitel untersucht, wie beigefügte Skizzen und Zeichnungen von Räumlichkeiten in Briefen die Schreibszene erweitern und zusätzliche Informationen über die Selbstinszenierung des Schreibenden liefern. Die Analyse der visuellen Elemente wird mit der schriftlichen Kommunikation verknüpft, um ein umfassenderes Bild der Selbstdarstellung zu gewinnen. Die Interpretation der Skizzen konzentriert sich auf die Bedeutung der räumlichen Darstellung für das Verständnis des Schreibenden und seiner Intentionen.
4. Intentionen und Selbstdarstellung am Beispiel von Levin Schücking: Dieses Kapitel analysiert einen Brief von Levin Schücking an Annette Droste-Hülshoff, um die Selbstinszenierung des Briefschreibenden zu untersuchen. Die Schreibszene wird sowohl textual als auch durch eine beigefügte Skizze des Zimmers rekonstruiert. Die Analyse beleuchtet die Wahl der Worte, den Schreibstil und die visuelle Darstellung, um die Intentionen Schückings und seine Selbstdarstellung zu verstehen. Die Verbindung zwischen schriftlicher und visueller Darstellung wird besonders hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Selbstinszenierung, Brief, Schreibszene, Schreibwerkzeug, räumliche Dimension, zeitliche Dimension, Selbstdarstellung, materielle Kultur, Levin Schücking, Annette Droste-Hülshoff, Briefkultur 18./19. Jahrhundert, Handschrift.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Selbstinszenierung von Briefschreibenden anhand der Schreibszene
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Selbstinszenierung von Briefschreibenden anhand ihrer Schreibszene. Der Fokus liegt dabei auf der materiellen und körperlichen Dimension des Schreibakts, einschließlich der räumlichen und zeitlichen Aspekte der Schreibumgebung.
Welche Aspekte der Schreibszene werden untersucht?
Die Untersuchung umfasst die Rolle der Schreibszene in der Selbstinszenierung, die Bedeutung von Schreibwerkzeugen und räumlichen Gegebenheiten, sowie die Analyse von beigefügten Skizzen und Zeichnungen in Briefen. Es wird untersucht, wie diese Elemente zur Selbstdarstellung des Briefschreibers beitragen.
Welches Beispiel wird im Detail analysiert?
Ein Brief von Levin Schücking an Annette Droste-Hülshoff dient als Fallbeispiel. Die Analyse umfasst sowohl den schriftlichen Text als auch eine beigefügte Skizze des Zimmers, um die Selbstinszenierung Schückings zu rekonstruieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Die schriftliche und zeichnerische Inszenierung des Schreibens, Beigefügte Skizzen und Zeichnungen von Räumlichkeiten in Briefen, Intentionen und Selbstdarstellung am Beispiel von Levin Schücking, und Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Schreibszene – sowohl räumlich als auch zeitlich – für die Selbstdarstellung im Brief zu analysieren. Sie untersucht, wie die Schreibszene als Ausdruck von Identität und Teilhabe an der Literaturszene fungiert und den Brief als Medium der intimen Selbstdarstellung nutzt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstinszenierung, Brief, Schreibszene, Schreibwerkzeug, räumliche Dimension, zeitliche Dimension, Selbstdarstellung, materielle Kultur, Levin Schücking, Annette Droste-Hülshoff, Briefkultur 18./19. Jahrhundert, Handschrift.
Wie wird die Schreibszene definiert?
Die Schreibszene wird sowohl in zeitlicher als auch räumlicher Dimension definiert. Sie umfasst die materiellen Voraussetzungen des Schreibens (Schreibwerkzeug, Papier, Raum) sowie die körperliche Geste des Schreibenden. Sie wird als vom Schreibenden aktiv mitgestaltete Umgebung verstanden, die seine Identität und Kreativität ausdrückt.
Welche Rolle spielen beigefügte Skizzen?
Beigefügte Skizzen und Zeichnungen erweitern die Schreibszene und liefern zusätzliche Informationen zur Selbstinszenierung. Die visuelle Darstellung wird mit der schriftlichen Kommunikation verknüpft, um ein umfassenderes Bild der Selbstdarstellung zu gewinnen.
Welche Bedeutung hat der Brief im Kontext dieser Arbeit?
Der Brief wird als mehrschichtiger Akt beschrieben, der über die bloße Informationsübermittlung hinausgeht und sinnliche und emotionale Aspekte umfasst. Insbesondere im 18./19. Jahrhundert ermöglichte er Frauen einen Zugang zur Literaturszene.
- Quote paper
- Master of Arts Elisa Kapp (Author), 2016, Selbstinszenierung von Briefschreibenden durch die Schreibszene. Analyse eines Briefes von Droste-Hülshoff an Levin Scheckig, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438087