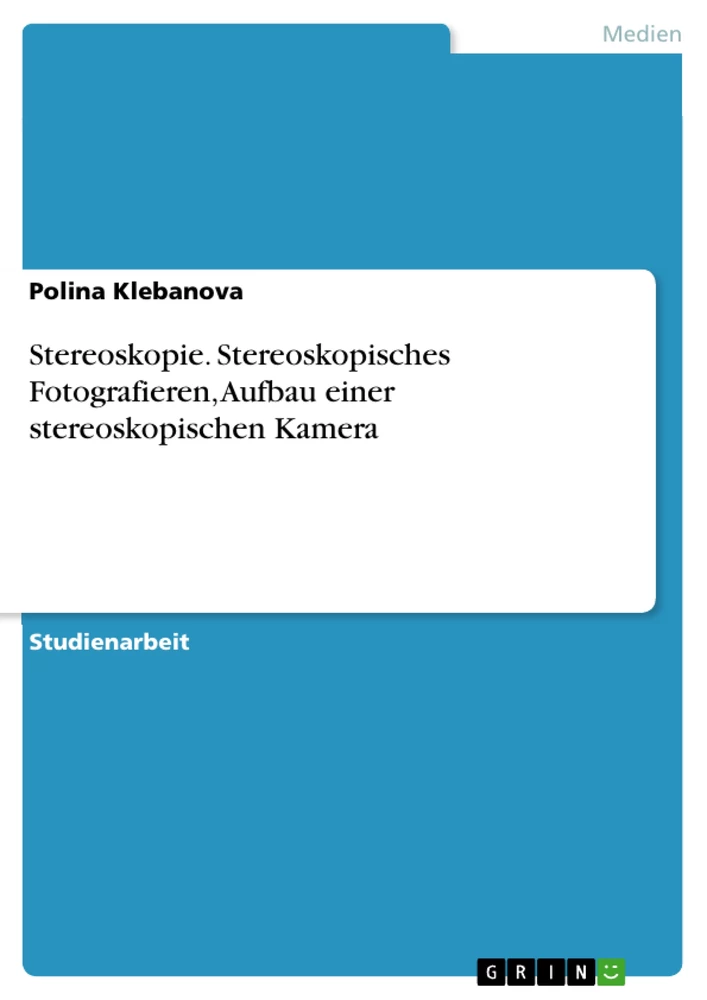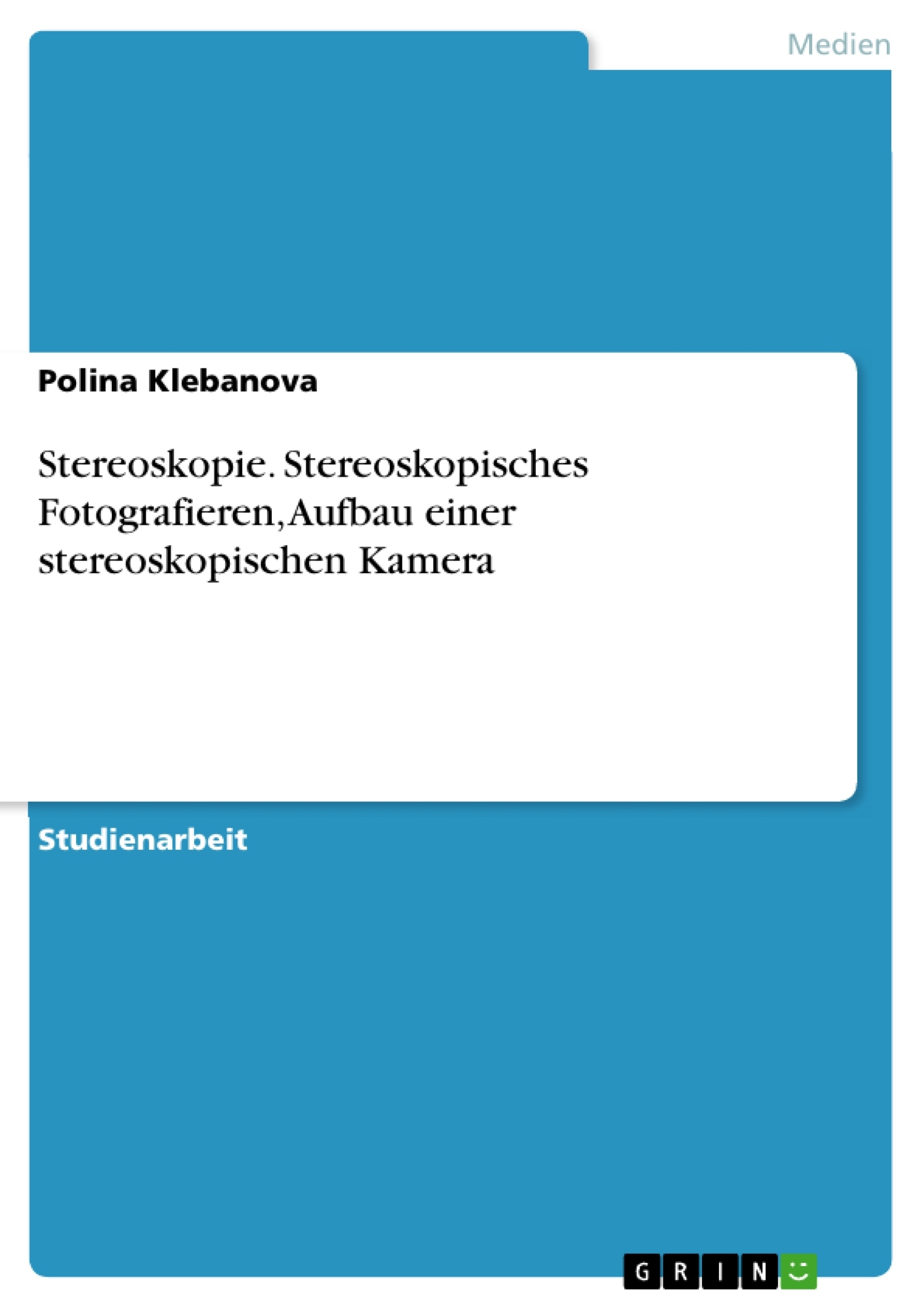Stereoskopie ermöglicht ein Erstellen der Bilder, die mit beiden Augen wahrgenommen werden können. Die Fähigkeit des Menschen mit zwei Augen zu sehen, gibt ihm die Möglichkeit, die Plastizität der Umwelt zu erfassen und die Tiefe der Objekte zu ermitteln. Die Voraussetzung dafür ist eine Zusammenwirkung vieler physiologischer Faktoren. Das Prinzip der Stereofotografie greift diese Gesetzmäßigkeiten auf, um die Illusion einer räumlichen Wahrnehmung in zweidimensionalen Medien zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Räumliches Sehen
- Konvergenz und Akkomodation
- Stereoskopisches Fotografieren
- Fachbegriffe
- Stereobasis
- Parallaktische Verschiebung
- Deviation
- Konvergenzwinkel/Konvergenzpunkt
- Scheinfenster
- Nah- und Fernpunkt
- Tiefenumfang
- Liliputismus
- Gigantismus
- Fachbegriffe
- Aufbau einer stereoskopischen Kamera
- Stereokamera mit zwei Objektiven
- Bau eines Kamera-Gespanns
- Hochformat
- Querformat
- Überkopfmontage mit einer Z-Halterung
- Synchronisation der Kamera-Gespanne
- Synchronisation mit Kabel-Fernauslöser
- Synchronisation durch Funk-Fernauslöser
- Kamerasteuerung über den LANC-Controler
- Objektive
- sukzessive Aufnahmeverfahren
- Aufnahmentechniken ohne Hilfsmittel
- Aufnahmetechniken mit Hilfsmittel
- Die drei goldenen Regeln nach Gerhard P. Herbig
- Aufnahmeregel
- Kritische Blende und Schärfentiefe
- Stereobasis
- Tiefenbereich eines Objektes
- Rahmungs- oder Montageregel
- Wiedergaberegel
- Aufnahmeregel
- Weitere Fehlerquellen
- Unterschiede der Schärfentiefe
- Helligkeitsunterschiede in Teilbildern
- Höhenversatz der Halbbilder
- Rotationsunterschiede der Halbbilder
- Asynchrone Bilder
- Wiedergabetechniken
- Hilfsmittelfreie Wiedergabe
- Stereoskop
- Passive/Aktive Wiedergabe
- Passive Wiedergabe
- Anaglyphen
- Polarisationstechnik
- Lineare Polarisation
- Zirkulare Polarisation
- Aktive Wiedergabe
- Shutterverfahren
- Autostereoskopische Displays
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Facharbeit „Stereoskopie“ zielt darauf ab, das Prinzip der Stereokamera und dessen Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Fotografie zu erläutern. Die Arbeit beschäftigt sich mit den technischen Aspekten der dreidimensionalen Bildaufnahme, der Funktionsweise des menschlichen Raumsehens sowie den verschiedenen Wiedergabetechniken für Stereoskopie.
- Die Funktionsweise des menschlichen Raumsehens und deren Relevanz für die Stereoskopie
- Technische Aspekte der Stereokamera: Aufbau, Synchronisation, Objektivwahl
- Aufnahmetechniken: Aufnahme mit Stereo-Gespanne, sukzessive Aufnahmeverfahren
- Die drei goldenen Regeln der Stereografie nach Gerhard P. Herbig
- Verschiedene Wiedergabetechniken für Stereobilder: passive, aktive, autostereoskopische
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema Stereoskopie ein und beschreibt den historischen Kontext der dreidimensionalen Bildaufnahme. Es werden die Grundlagen des räumlichen Sehens erläutert, indem die Funktionsweise des menschlichen Auges und die relevanten Prozesse, wie Konvergenz und Akkomodation, beschrieben werden.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem stereoskopischen Fotografieren und erklärt die wichtigsten Fachbegriffe, wie Stereobasis, parallaktische Verschiebung und Tiefenumfang. Dabei wird auch auf die Entstehung von Effekten wie Liliputismus und Gigantismus eingegangen.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Aufbau einer stereoskopischen Kamera. Es werden verschiedene Modelle, wie Stereokameras mit zwei Objektiven und Kamera-Gespanne, sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Hoch- und Querformat vorgestellt. Weiterhin werden die verschiedenen Synchronisationsmöglichkeiten für die Kameraauslösung, wie die Verwendung von Kabel-Fernauslösern, Funk-Fernauslösern und LANC-Controllern, erläutert.
Kapitel fünf beschreibt die sukzessiven Aufnahmeverfahren, bei denen zwei Stereo-Halbbilder mit einer Kamera zeitversetzt aufgenommen werden. Diese Methode wird vor allem für die Aufnahme unbeweglicher Objekte eingesetzt und es werden die notwendigen Hilfsmittel, wie Stereoschlitten und Stereowippe, vorgestellt.
In Kapitel sechs werden die drei goldenen Regeln der Stereografie nach Gerhard P. Herbig präsentiert. Die Regeln befassen sich mit den Aufnahmebedingungen, der Bildgestaltung und den Wiedergabemerkmalen, um einen natürlichen dreidimensionalen Eindruck zu gewährleisten.
Kapitel sieben geht auf verschiedene Fehlerquellen ein, die bei der Aufnahme und Betrachtung von Stereobildern zu einer unscharfen oder unnatürlichen Darstellung führen können. Dazu zählen beispielsweise Unterschiede in der Schärfentiefe, Helligkeitsunterschiede in Teilbildern, Höhenversatz der Halbbilder, Rotationsunterschiede der Halbbilder und asynchrone Bilder.
Das achte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Wiedergabetechniken für stereoskopische Bilder. Es werden sowohl die Hilfsmittelfreie Wiedergabe mit Parallel- und Kreuzblick als auch die verschiedenen Methoden der passiven und aktiven Wiedergabe, wie Anaglyphentechnik, Polarisationstechnik und Shutterverfahren, erläutert. Abschließend wird die Funktionsweise von autostereoskopischen Displays beschrieben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Facharbeit „Stereoskopie“ beschäftigt sich mit den Grundlagen des räumlichen Sehens, der technischen Aspekte der Stereokamera und den verschiedenen Wiedergabetechniken für dreidimensionale Bilder. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Stereobasis, parallaktische Verschiebung, Konvergenzwinkel, Scheinfenster, Anaglyphen, Polarisationstechnik, Shutterverfahren, autostereoskopische Displays.
- Quote paper
- Polina Klebanova (Author), 2014, Stereoskopie. Stereoskopisches Fotografieren, Aufbau einer stereoskopischen Kamera, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437860